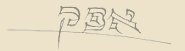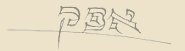| Rückblick
auf Jom Ijun vom Sonntag, 24. Juni 2001 in Basel
Eine Menschenschlange bildete
sich vor der Anmeldung, als in den Räumlichkeiten der Israelitischen
Gemeinde Basel (IGB) zum ersten mal in dieser Art ein Lerntag stattfand,
der sich an der Lernwoche in Nottingham in England orientierte, bekannt
unter dem Namen «Limmud», wo jeweils etwa Ende Dezember gegen
2000 Männer, Frauen und Kinder teilnehmen. Die Organisatorinnen, Valérie
Rhein und Emily Silverman, erarbeiteten ein Programm, das sich sehen lassen
konnte. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, insgesamt drei Schiurim/Sessions
à 1,5 Stunden zu besuchen. Dabei konnten sie jeweils zwischen drei
verschiedenen Themen wählen, so dass das Angebot also insgesamt neun
Schiurim umfasste.
Die Themen:
|
613 Gebote Lust oder Frust. Einblicke
in die Bedeutung der Mitzwot,
mit Eva Pruschy-Gregor,
Zürich. |
|
Von Mensch zu Mensch. Elf Jahre jüdisch-palästinensische
Gesprächsgruppe Basel,
mit Dr. Edward Badeen und
Dr. Peter Dreyfus, Basel. |
|
Das Benschen. Musikalische und textliche
Vielfalt im Tischgebet,
mit Marcel Lang, Basel. |
|
Der Begriff «Lernen» im Talmud.
Chawruta (Lernen in Zweiergruppen),
mit Esther Kontarsky, Berlin. |
|
Aaron Annäherung an eine biblische
Figur,
mit Dr. Alfred Bodenheimer,
Luzern. |
|
0,3 Prozent im Spiegel der Schweizer Medien.
Ein Blick auf jüdische Themen in der Schweizer Medienlandschaft,
mit
Pierre Weill, Basel. |
|
Von der Traube zum Wein. Blicke in die
Geschichte des Koscherweins,
mit Steffi Bollag, Basel. |
|
Die Tora hat 70 Gesichter. Einführung
in den Midrasch,
mit Michael Bollag, Zürich. |
| |
Mirjam auf den Spuren einer Prophetin,
mit Adina Ben-Chorin,
Zürich. |
Ich selbst hatte also die
«Qual der Wahl». Obwohl mein Sternzeichen Zwilling ist, musste
ich mich doch entscheiden und besuchte die Schiurim mit den ReferentInnen
Eva Pruschy, Pierre Weill und Michael Bollag. Alle Schiurim waren trotz
des sehr schönen und warmen Wetters gut besucht. In den Pausen und
beim reichhaltigen Mittagessen, das vom koscheren Restaurant «Topas»
bereitgestellt wurde, entstanden interessante Gespräche mit allen
Altersgruppen und religiösen Richtungen, was einer der wichtigsten
«Begleiterscheinungen» war und ist.
Natürlich war es nicht
immer leicht, allem und allen zu folgen, da die Konzentration nach einer
bestimmten Zeit nachlässt, dennoch konnte ich Neues lernen und Bekanntes
vertiefen. So bei dem Schiur von Michael Bollag und Pierre Weill, wo entweder
der Referent einen recht lebhaften Vortrag gab oder die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer interessiert und lebhaft mit dem Thema umgingen. Sicherlich
gab es auch «Kinderkrankheiten», zum Beispiel das Fehlen deutscher
Übersetzungen für englische Arbeitstexte, die jedoch, und das
hoffe ich, beim nächsten «Schweizer Mini-Limmud» sicherlich
der Vergangenheit angehören. So bleibt zu hoffen, dass in naher Zukunft
eine solche Veranstaltung wiederholt werden kann und die Teilnehmerzahl,
von dieses mal geschätzten 100, dann übertroffen wird.
Zum Ende meines Berichts
kann ich sagen, ohne Lobhudelei, dass sich der Einsatz und die Teilnahme
für die Organisatoren, Helfer und Besucher gelohnt hat. Danke.
Richard Ernst
Erschienen in den Gescher-Mitteilungen
(Freiburg i. Br.), Herbst 2001
[zurück
zum Inhalt]
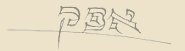
Von
Mensch zu Mensch
Elf Jahre jüdisch-palästinensische
Gesprächsgruppe Basel
Dr. Edward Badeen und
Dr. Peter Dreyfus
Seit 1990 treffen sich in
der Region Basel lebende palästinensische und jüdische Frauen
und Männer. Aus den Begegnungen von Fremden, aus Gesprächen und
Diskussionen über Politik, Vorurteile und persönliche Ängste
ist gegenseitiges Verständnis entstanden. Freundschaften haben sich
gebildet. Edward Badeen und Peter Dreyfus berichten über ihre Erfahrungen,
ihre Ziele und Aktivitäten und laden ein zur Diskussion.
Protokoll
Peter Dreyfus kennt Jehad
Mazarwe seit 1989 und ist seither mit ihm befreundet. In Israel hat er
Friedensprojekte wie zum Beispiel Neve Shalom kennengelernt und sich jahrelang
aktiv dafür engagiert. Von Peter Liatowitsch wurde er schliesslich
auf das Thema «Friedensarbeit» aufmerksam gemacht, worauf ein
erstes Treffen mit Jehad Mazarwe stattfand. Die Gruppe hat sich rasch gebildet.
Seit 1990 treffen sich die zwölf Mitglieder drei bis viermal im Jahr.
Am Anfang stand das Kennenlernen im Vordergrund. Es folgten zum Teil sehr
schwierige Diskussionen, und es gab auch schwierige Zeiten, zum Beispiel
während des Golfkrieges. Trotzdem wurden die Diskussionen fortgesetzt.
Und schliesslich hat sich die Gruppe entschlossen, an die Öffentlichkeit
zu treten.
Peter Dreyfus Motivation,
sich in der jüdisch-palästinensischen Gesprächsgruppe zu
beteiligen, war seine Liebe zu Israel und das Bedürfnis, die Leute
in diesem Land zu unterstützen, zum Beispiel in Bezug auf den Umgang
mit Minoritäten. Das Überleben des Staates Israel ist ihm sehr
wichtig. Die jüdisch-palästinensische Gesprächsgruppe gibt
ihm die Möglichkeit, aktiv zu sein. Voraussetzungen für das Gelingen
der Treffen sind Offenheit, Respekt, das Ernst nehmen der Anderen sowie
eine Identifikation mit dem Gegenüber.
Als Edward Badeen gefragt
wurde, ob er an der jüdisch-palästinensischen Gesprächsgruppe
teilnehmen würde, hat er sofort zugesagt. Seine Frau ebenfalls. Seiner
Meinung nach ist die Gruppe erst dann so richtig entstanden, als die Lage
im Nahen Osten ziemlich aussichtslos zu sein schien, also vor Madrid und
Oslo. Welchen Sinn so fragten sie sich damals hat es denn, da mit zu
machen. Die Politiker und das Militär würden entscheiden. Doch
gerade in dieser Situation erwies sich diese Gruppe als Lichtpunkt im langen,
dunklen Tunnel. Und dieses kleine Licht darf nicht erlöschen, im Gegenteil,
es muss grösser werden.
Edward Badeen hat an der
Hebräischen Universität einen Zweijahreskurs in israelischer
Geschichte belegt. Dabei hat er Verständnis gewonnen dafür, was
auf der «anderen» Seite stattfindet. Anhand eines Beispiels
illustrierte er, wie der Hass gezielt geschürt werden kann. 1961 haben
israelische Zeitungen unter dem Titel «Paraschat Navon» einen
Skandal aufgedeckt. In den fünziger Jahren hat der damalige Ministerpräsident
David Ben Gurion israelische Soldaten angewiesen, sich als Araber zu verkleiden,
um einen Bus bei Beerscheva anzugreifen. Dabei sind 17 Kinder ums Leben
gekommen. Ebenfalls in den fünfziger Jahren hat Ben Gurion ohne das
Wissen des zuständigen Itzhak Navon Leute vom Geheimdienst nach Bagdad
geschickt, um dort einen Anschlag auf die Synagoge zu verüben. Ziel
war es, den dortigen Juden Angst einzuflössen, damit sie nach Israel
auswanderten. Auch das müsse man, so Edward Badeen, wissen. Es macht
Mut, wenn man Gleichgesinnte findet, mit welchen man aktiv für den
Frieden arbeiten kann. Die Diskussionen während der Erarbeitung der
elf Punkte umfassenden Deklaration aus dem Jahre 1997 haben auch zu Spannungen
geführt, doch die kulinarische Seite der Treffen hat sicher zum Abbau
dieser Spannungen beigetragen.
Peter Dreyfus forderte das
Publikum auf, die Deklaration der jüdisch-palästinensischen Gesprächsgruppe
zu lesen und anschliessend Fragen zu stellen. Die Erstellung der Deklaration
dauerte ca. ein Jahr. Sie kann auf dem Internet unter der Adresse http://www.isra-pal-peace.ch
gelesen und unterschrieben werden. Die Gesprächsgruppe hat vorwiegen
positive Reaktionen darauf erhalten. Es gibt bis heute Interessenten dafür.
Zudem wurden durch sie Kontakte zu anderen ähnlichen Formationen in
der Welt möglich. Insgesamt existieren über 100 ähnliche
Gruppierungen. In Israel sind die Friedensaktivisten sehr froh um jegliche
Solidarität und Unterstützung aus der Diaspora.
Publikum: Wie haben
in Israel lebende Verwandte der Referenten ihre Aktivitäten aufgenommen?
Edward Badeen: Bei
einigen erlebte er Angriffe und Ablehnung, bei den vernüftigeren eine
abwartende Haltung.
Peter Dreyfus: Die Tatsache
an sich, dass er an solchen Diskussionen teilnimmt, hat niemand in Frage
gestellt. Doch der Inhalt wurde kritisiert. Heute sieht die Situation etwas
anders aus, da man Dank Internet zu ähnlichen Informationen gelangen
kann. Er sieht jedoch einen Unterschied zwischen sich selbst und den Israelis,
die den Krieg miterlebt haben.
Publikum: Es fehlt in der
Deklaration ein Aspekt, nämlich die Aufforderung, die Hetze auf beiden
Seiten abzusetzen. Dies bildet unter anderem einen Nährboden für
Attentate.
Peter Dreyfus: Der vierte
Punkt der Deklaration (vollständige Gleichberechtigung) versucht,
diesem Umstand gerecht zu werden. Übrigens setzt sich zum Beispiel
die Palästinenserin Sumaya Farhat-Naser sehr für eine friedliche
Lösung ein, ist nun aber selber in Gefahr. Diese Frau erbringt eine
grosse Leistung.
Edward Badeen: Als Islamist
erkläre er, dass der wahre Islam sich für einen friedlichen Dialog
ausspricht. Man darf weder verallgemeinern noch darf man fragen, wer den
ersten Stein geworfen hat.
Publikum: Der elfte Punkt
der Deklaration (kultureller und wirtschaftlicher Austausch) sollte nicht
nur eine Anregung sein, sondern tatsächlich umgesetzt werden. Gibt
es diesbezüglich konkrete und materielle Unterstützung?
Edward Badeen weiss, wie
wichtig dies ist und wie sehr Attentate den Frieden zerstören. Und
obwohl momentan Kontakte zwischen den beiden Völkern verboten sind,
werden sie, unter sehr schwierigen Umständen, zum Teil fortgeführt.
Mutige Leute machen einfach weiter.
Peter Dreyfus: Institutionen
wie Neve Shalom/Wahat al-Salam und Givat Haviva initiieren hunderte von
Begegnungsprojekten. Auch diese sind auf jegliche Art von Unterstützung
angewiesen.
Publikum: Im Buch «Thymian
und Steine» verurteilt Sumaya Farhat-Naser einseitig nur die israelische
Seite.
Edward Badeen: Das ist ja
eigentlich logisch, da sie nur ihre Seite vertreten kann.
Publikum: Politiker haben
viel Macht. Was würde passieren, wenn Yassir Arafat nicht mehr da
wäre? Welchen Ersatz gäbe es?
Edward Badeen hat sich vor
über zehn Jahren schon eine andere Figur gewünscht als Arafat.
Doch war eben nur er fähig, die wichtige Unterschrift zu leisten.
Vor 1967 war Arafat nicht populär. Danach aber hat er als Kämpfer
der kleinen Leute an Achtung gewonnen. Es war damals psychologisch sehr
wichtig, dass gekämpft und nicht hilflos alles erduldet wurde. Hanan
Ashrawi fände er allerdings die geeignetere Person, da sie nicht korrupt
und zudem eine phantastische Persönlichkeit ist.
Publikum: In diesem Konflikt
muss auch die Frage der Religion ausgeleuchtet werden, das fehlt in der
Deklaration. Auch der Einfluss der Religion auf die Politik, auf das Volk
etc. Nur so lässt sich wirklich eine friedliche Lösung finden.
Zudem besteht ein Unterschied zwischen religiösen und territorialen
Ansprüchen.
Edward Badeen hat versucht,
die Religion zu ignorieren, weil diese zu keiner Lösung führt.
Zwei Jahre hat man in der Knesset darüber debattiert, wer Jude ist
und wer nicht. Er betrachtet die Religion als eine Privatangelegenheit.
Publikum: Die Extremisten
jedoch werden sich immer auf die Religion beziehen. Leider spielt sie doch
eine grosse Rolle. Der Friedensprozess wird kein Ziel erreichen, bevor
nicht eine Lösung für die Religion gefunden ist. Bei den Islamisten
gewinnt man den Eindruck, dass diese alles mit Gewalt lösen wollen.
Edward Badeen: Was sich
in der Religion abspielt, findet sich parallel natürlich auch in der
Politik. Religionen sind, wie die Geschichte zeigt, schon immer für
bestimmte Zwecke missbraucht worden.
Peter Dreyfus wird sich
überlegen, diesen Punkt in der jüdisch-palästinensischen
Grsprächsgruppe zu thematisieren.
Publikum: Die israelischen
Fundamentalisten sind ebenso gewalttätig wie die Islamisten. Mit der
Deklaration ist sie einverstanden, mit Ausnahme des neunten Punktes (Jerusalem
als ungeteilte Stadt und Hauptstadt zweiter souveräner Staaten). Dieser
ist ihrer Meinung nach nicht realistisch. Sie kann sich nicht eine gemeinsame
Hauptstadt für die beiden Völker vorstellen. Für Muslime
ist Jerusalem der drittheiligste Ort, für Juden aber der Heiligste,
das Zentrum des Judentums. Ist es denn für Muslime wirklich so wichtig,
Jerusalem als Hautstadt zu haben?
Edward Badeen: Wichtig ist,
was die Resolution verlangt. Besetzt ist besetzt. Die religiösen Ansprüche
interessieren ihn nicht. Es wäre dasselbe, was die Kreuzfahrer früher
schon gemacht haben. Das hat nichts mit Souveränität zu tun.
Wenn sich der vierte Punkt der Deklaration (vollständige Gleichberechtigung)
verwirklichen liesse, wäre damit auch das Problem von Jerusalem gelöst.
Peter Dreyfus: Es handelt
sich hier nicht einfach um schöne Ziele, sondern es braucht sehr viel
Einsatz. Alle können dazu beitragen, indem sie selbst einem kleinen
Ort etwas unternehmen.
Protokoll: Berta Rasumowsky
Homepage der jüdisch-palästinensischen
Gesprächsgruppe: http://www.isra-pal-peace.ch
[zurück
zum Inhalt]
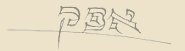
Das
Benschen.
Musikalische und textliche
Vielfalt im Tischgebet
Marcel Lang
Wir kennen drei verschiedene
Arten von Brachot/Segenssprüchen (Matbea Kazar, Matbea Aroch und Bracha
Hasmucha Lachawerta). Im Benschen, dem Tischgebet, sind alle drei Bracha-Formen
enthalten. Vielfältig ist das Benschen auch in bezug auf seine Melodien.
Wir lernen verschiedene inhaltliche und musikalische Varianten des Tischgebetes
kennen und vergleichen sie miteinander.
Protokoll
Birkat Hamason, das Tischgebet,
ist zusammengesetzt aus verschiedenen Brachot (Segnungen), die gesungen
und gebetet werden, nachdem die Mahlzeit beendet wurde. Das unterscheidet
das Gebet von anderen, deren Brachot gesagt werden, bevor etwas getan wird.
Zum Beispiel Schewa Brachot, die Segenssprüche zur Hochzeit, der Segensspruch
des Händewaschens, der unter anderem vor dem Abtrocknen der Hände
und vor dem Segen über das Brot gesagt wird.
Der Zusammenhang von Segen
auch vor dem Essen wird hergeleitet aus einem einzigen Vers in der Bibel:
Schemuel 1, 9-13 «(...) denn das Volk isst nicht, bis er gekommen,
denn er segnet das Opfermahl ein, nachher essen die Geladenen.»
Brachot werden formal eingeteilt
in drei Versionen:
- Matbea Kazar, die kurze
Bracha, bei der das «Baruch ata Haschem» am Anfang der Bracha
steht, wie die Brachot für die Genussmittel.
- Matbea Aroch, die lange
Bracha, an deren Anfang und Ende das «Baruch ata Haschem» steht.
Zum Beispiel die Bracha nach «Barchu» oder die erste Bracha
der Amida.
- Hasmucha Lachawerta, die
Anschluss-Bracha, zum Beispiel in der «Amida», dem 18- bzw.
19-Bitten-Gebet wird die erste Bracha mit dem «Baruch ata Haschem»
begonnen und die folgenden Bitten schliessen ohne das «Baruch ata»
an.
Im Tischgebet sind alle drei
Varianten vertreten (S. 127ff.*):
Es beginnt mit Birkat Hazan,
der ersten Bracha, die eine lange Bracha ist, denn an ihrem Anfang und
Ende steht das «Baruch ata Haschem».
Die zweite Bracha, Birkat
HaArez, ist eine Anschluss-Bracha, denn sie beginnt mit «Wir
danken dir.»
Ebenso die dritte Bracha,
Birkat Jeruschalajim, die «Erbarme Dich» beginnt. Sie schliesst
mit «Baruch ata Haschem» und einer Besonderheit: Amen.
Die vierte Bracha Birkat
Hatow weHametiw ist kurz, sie beginnt mit «Baruch ata Haschem»
und hat eine Verlängerung Bakaschot Nossafot.
Das Tischgebet wird von
Frauen und Männern gebetet, nach talmudischer Diskussion, nach dem
Genuss von:
· einer der sieben
Arten (Rabbi Gamliel; Quelle: 5. B.M., 8. 810)
· Brot (Chachamim)
· Weizen, Gerste,
Dinkel/Buchweizen, Hafer, Roggen
· Kol ma schehu ochel
(Rabbi Akiwa); nach jedem Essen.
Am Anfang des Essen steht
nach der Tradition die Bracha über das Brot.
Das Tischgebet in der Form,
wie wir es heute kennen, geht in den ersten drei Brachot vermutlich auf
die Zeit Ezras zurück zum Inhalt, also nach der Rückkehr eines
Teils des jüdischen Volkes aus dem babylonischen Exil. Sie beziehen
sich auf die Torah.
Birkat Hazan, die erste
Bracha stellt den Bezug her zu Mosche Rabbenu und das Man des Himmels =
die Speise. Das Lob Gottes richtet sich auf seine Eigenschaften: Güte,
Gnade, Liebe und Erbarmen. Der Dank gilt dem Gegenwärtigen und die
Bitte der Zukunft.
Birkat HaArez, die zweite
Bracha bezieht sich auf Jehoschua, der das Volk in das versprochene Land
führt. Hier steht der Dank für das Land, ( Erde, aus der die
Speise kommt), den Bund, die Torah und die Befreiung im Mittelpunkt. Als
biblische Quellen sind 1. B.M., 17, 8., 5. B.M., 8,1 sowie Psalmen 105,
45 und 46 in das Gebet eingeflossen. In den Formen: Nodeh lecha und anachnu
modim lach (für die weibliche grammatikalische Form gibt es mehrere
Gründe ) drückt sich der Dank aus, ebenso im Al Hanissim, in
den Einschüben für Chanukka und Purim .
Birkat Jeruschalajim, die
dritte Bracha bezieht sich auf die Könige David und Schlomo, auf die
Stadt und den Tempel. Biblische Quelle: Hosea 3,5.
Birkat Hatow weHametiw,
die vierte Bracha, nimmt auch inhaltlich eine Sonderstellung ein. Sie stellt
den Bezug zu den Rabbinen von Jawne her und zu dem historischen Ereignis
des Bar Kochba-Aufstandes ( 135 vZ).
Die zusätzlichen Gebetsteile
können als persönliche Bitten und Dank angesehen werden.
Modifizierungen dieses Gebetsteiles
sind in topographischen, historischen und homiletischen Zusammenhängen
erfolgt.
Die Bitte am Schluss der
Bracha um die Sendung des Maschiach bezieht sich auf Psalmen 132,15 und
17.
Im Laufe der Jahrhunderte,
unter den verschiedenen Lebensbedingungen, in denen sich die Tradition
veränderte, hat sich auch das Benschen verändert insbesondere
sind Verkürzungen bis hin zu Kürzestformen entstanden, mit dem
Ziel, das Gebot des Tischgebetes im Alltag zu befolgen.
Die gesungene Form ist besonders
vom deutschen Judentum gepflegt worden.
Protokoll: Sabine Pistor
* Literatur:
Semirot Michal, Morascha Verlag, Basel/Zürich 1993, S. 123 ff.
[zurück
zum Inhalt]
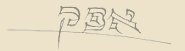
Der Begriff «Lernen»
im Talmud
Chawruta (Lernen in Zweiergruppen)
Esther Kontarsky
Chawruta ist das klassische Studium
jüdischer Quellentexte aus Tenach (Bibel), Talmud und weiteren Schriften
in Zweiergruppen. Thema des Chawruta-Lernens von Jom Ijun ist der Begriff
«Lernen» im Talmud. Gemeinsam mit einem Lernpartner oder einer
Lernpartnerin werden Quellentexte (mit deutscher Übersetzung) gelesen
und diskutiert. Esther Kontarsky vermittelt eine kurze Einführung
in die Technik der Chawruta und beantwortet Fragen zum Thema oder zur Lernmethode.
Protokoll
Die Bedeutung von Chawruta: Gemeinsames
Lernen und Studieren von Quellen unter Freunden; alle an einer Chawruta
Beteiligten sind gleichwertig.
Methode:
1. Text auf Deutsch und Hebräisch
laut vorlesen. Verständnisfragen zum Text (nicht zum Thema) sofort
besprechen.
2. Gruppen von zwei bis maximal drei
Leuten formieren.
3. In der Kleingruppe ca. 30 Minuten
über den Text diskutieren. Laut und assoziativ Gedanken mitteilen,
Fragen aufwerfen.
4. In der grossen Gruppe teilen die
einzelnen «Paare» mit, was ihnen am Text aufgefallen ist und
was sie speziell beschäftigt hat.
Ansatzpunkte zur Textanalyse:
· Was will der Text dieser
Chawrute zum Thema Lernen sagen?
· Welches sind die verschiedenen
Vorgehensweisen von Hillel und Sammaj in Bezug auf das Lernen mit Nichtjuden?
Aufgeworfene Aspekte und Fragen in
der Diskussion:
· Wie muss der Lehrer seine
Pflichten gegenüber seinen Schülern wahrnehmen? Welche Verantwortung
trägt der Schüler?
· Sammaj wählt die radikale
Methode und weist keinen Erfolg auf. Hillel geht subtiler vor; wesentlich
ist für ihn der Erfolg.
· Hillel hat Vertrauen in den
Menschen; Sammaj nicht.
· Hillel ist bereit zu geben.
Er weiss, dass er nur etwas verändern kann, wenn er selbst zu geben
bereit ist.
· Gibt Hillel billige Antworten?
Haben diese keinen Wert?
· Was ist die Funktion des
Lernens?
Protokoll: Nora Refaeil
[zurück
zum Inhalt]
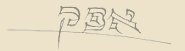
0,3
Prozent im Spiegel der Schweizer Medien
Ein
Blick auf jüdische Themen in der Schweizer Medienlandschaft
Pierre
Weill
Die
in der Schweiz lebenden Jüdinnen und Juden sind eine verschwindend
kleine Minderheit: Bei einer Bevölkerung von sieben Millionen sind
18'000 Personen jüdisch. Berichten die Medien tatsächlich überproportional
über jüdische Themen oder handelt es sich um das Phänomen
der selektiven Wahrnehmung? Der Journalist Pierre Weill wirft einen kritischen
Blick auf die Berichterstattung und auf die Reaktionen bei den Leserinnen
und Lesern.
Protokoll
Nach einem kurzen
Überblick, was an sogenannten jüdischen Themen in letzter Zeit
in den Medien behandelt wurde, legte Pierre Weill den Workshop-Teilnehmern
ein Thesenpapier vor, welches im Folgenden lebhaft diskutiert wurde.
Thesen:
1)
Die Juden erscheinen überproportional in den Medien, weil sie überproportional
viel Einfluss auf die Medien haben.
2)
Die Juden erscheinen überproportional in den Medien, weil sie überproportional
viel Einfluss auf die Schweiz haben.
3)
Die Berichterstattung über die Juden ist von antisemitischen Vorurteilen
geprägt.
4)
Die Berichterstattung über den Nahost-Konflikt ist von unterschwelligen
antisemitischen Vorurteilen geprägt.
5)
Die Medienarbeit der jüdischen Organisationen in der Schweiz ist dilettantisch
bis inexistent.
6)
Welche Folgen sind zu ziehen?
Bemerkung eines
Teilnehmenden:
Theodor Herzl wollte
das jüdische Problem in die Welt bringen, wollte, dass alle Völker
seine Ideen unterstützen, und heute sieht man in der Schweiz, dass
er Erfolg gehabt hat. Wenn man aus Israel in die Schweiz kommt, fühlt
man sich bereits nach kurzer zeit als «Experte» für schweizerische
Fragen, aber je länger man da ist, desto differenzierter geht man
mit dem Problemkreis um. Man will sich integrieren, aber nicht auffallen.
Wenn man als Ausländer
im Tram nach dem Weg fragt, ist jeder Schweizer gleich sehr hilfsbereit.
Andererseits musste sich der Votant auch von seinem Nachbarn, einem Arzt,
der ihn jahrelang kennt, anhören, «es sei doch bekannt, dass
DIE Juden die Banken kontrollieren». Nie kann man 100prozentig sicher
sein, ob eine geäusserte Kritik antisemitisch ist oder nicht. Israel
ist jetzt der Goliath, ein Image, mit dem wir schlecht leben können.
Wir wollen eigentlich noch David sein, klein sein, allerdings auch nicht
zu klein. Man kann hingegen nicht alles vom jüdischen Standpunkt aus
diskutieren. Das christliche theologische Gedankengut ist tief in der Kultur
Europas verwurzelt, aber es soll den Schmerz der Juden anerkennen.
Pierre Weill
zu dem genannten Vorurteil: Es gibt in der Schweiz 400 Banken, nur vier
davon sind jüdisch.
These 1 und 2
Darüber herrscht
unter den Workshop-Teilnehmern allgemeiner Konsens, nämlich: Das ist
«Blödsinn».
Pierre Weill:
Gemäss Volkszählung sind in den Schweizer Medien 15000 Personen
beschäftigt, davon 121 Juden. Laut Umfrage glauben 21% der Schweizer,
dass zwischen 30000 und 80000, 15% sind gar der Meinung, dass über
200000 Juden in der Schweiz leben. In Wirklichkeit sind es nur 18000.
Es gab/gibt wenige
Minderheiten in der Weltgeschichte, die sich einerseits integrieren, andererseits
aber doch ihre Besonderheit behalten wollten. Häufig gestellte Fragen
sind: Fühlst du dich mehr als Jude oder mehr als Schweizer? Der Ehrenpräsident
der Israelitischen Cultusgemeinde, Sigi Feigel, sagte einmal: Die Schweiz
ist unser Vaterland, Israel unser Mutterland.
Es herrschte Konsens
darüber, dass das Fremdsein und Anderssein Angst macht.
Eine Teilnehmerin
erzählt, dass sie seit 25 Jahren einen Kampf gegen die Presse führe
und meinte, dass die Berichte nicht immer antisemitisch, sondern häufig
einfach nur dumm seien. Wir müssten lernen, weniger empfindlich zu
sein. Es gehe bei den Juden ja um Volks- und um Religionszugehörigkeit.
Zur besonderen
Rolle de Juden: Bei ähnlichen Situationen bezüglich Fahrenden
und Juden werden die Fahrenden weitestgehend ignoriert. Ein Teilnehmer
macht darauf aufmerksam, dass es in der Schweiz auch 200000 Moslems gebe.
Pierre Weill bestätigt: Juden sind Teil des Establishments, Fahrende
und Moslems sind zum Teil Nicht-Schweizer, und sie haben keine Lobby.
These 3 und 4
Pierre Weill berichtet
über zwei Artikel. Im einen Fall ging es um Raubgut aus der Zeit des
Zweiten Weltkrieges und einer dazu stattfindenden Tagung, im anderen um
Afrika und einen Bericht,dass eine ganze Generation von Menschen dort durch
Kriege und Aids gestorben sei. Von dem Afrika-Thema spräche so gut
wie keiner (fehlende Lobby), jedoch von jüdischen Themen überproportional
viele.
Zur Wortwahl und
der Erwähnung des Adjektivs "jüdisch" in den Medien:
Ein Teilnehmer
wirft die Frage auf, ob die Medien etwa berichten würden, dass ein
Katholike in den Bundesrat käme? "DieJuden" in Israel möchten
lieber "Israelis" genannt werden. Die Bezeichnung "der jüdische Staat"
für Israel sei laut Pierre Weill jedoch O.K. Die Medien in USA hätten
von J.F. Kennedy auch berichtet, er sei der erste katholische Präsident.
Es sei eben im Allgemeinen so, dass das Ungewöhnliche hervorgehoben
werde. "Hund beisst Mann" sei keine Nachricht, "Mann beisst Hund" würde
man bringen, das sei aussergewöhnlich.
Welchen Eindruck
man durch Medienberichte erhält, sei aber auch eine Frage der selektiven
Wahrnehmung. Wir sind sehr betroffen und geradezu fixiert auf Berichte
über Israel/Palästinenser/Intifada etc., aber Berichte über
den Kosovo würden wir schnell wieder vergessen.
These 5
Pierre Weill: Die
Palästinenser leisteten sehr gute Medienarbeit (gutes Auftreten, gute
Rhethorik), Israelis träten weniger gut auf, quasi frei nach Golda
Meir: "Wir wollen einfach ÜBERLEBEN".
Punkt 6 (Konsequenzen):
Vorschläge:
Die jüdischen
Journalisten in der Schweiz sollten Aufklärungssymposien unter Kollegen
machen und jüdische Gemeinden sollten Pressekonferenzen abhalten.
Wie sehen wir uns
eigentlich selbst im Spiegel? Leben wir überhaupt noch in der Diaspora/im
Exil? Sollte es ein Gremium geben, dass sich mit jüdischen Fragen
auseinendersetzt? Der SIG? Sollte der SIG im Luzerner Medienzentrum (MAZ)
obligatorische Journalistenseminare abhalten? Oder sollte mit der Aufklärung
bereits in den Schulen während der obligatorischen Schulzeit begonnen
werden?
Man sollte in Zukunft
nicht so häufig vom Holocaust sprechen, sondern auch von anderen Themen.
Protokoll: Cornelia Haberlandt Krüger
[zurück
zum Inhalt]
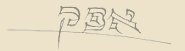
Von der
Traube zum Wein
Blicke in die Geschichte des Koscherweins
Steffi Bollag
In vielen Ländern der
Welt wird Koscherwein produziert, auch im benachbarten Elsass. Was ist
Koscherwein und wie wird er hergestellt? Ausgehend von einer biblischen
Quelle zum Thema vermittelt Steffi Bollag Einblicke in die Geschichte und
Tradition der Koscherwein-Produktion.
Protokoll
Im Talmud werden drei Arten
von Wein unterschieden:
1) Jajin Kascher, der koschere
Wein
2) Stam Jenam, der gewöhnliche,
tägliche Wein
3) Jajin Nessach, der Opfer-
oder Messwein.
Eigentlich unterscheiden
sich Jajin Kascher und Stam Jenam weder in der Herstellungsart, dem Anbaugebiet
noch in den Traubensorten. So wurde in Weingebieten wie dem Elsass der
Wein bei einem Bauer im Fass gekauft. Man kannte den Weinbauer und wusste,
woher die Trauben stammten und wie der Wein gekeltert wurde. Mit der einfachen
Formel Wein = Kiddusch = Koscher, also Wein = Koscher, war die Verwendung
im jüdischen Leben geregelt.
Dies galt natürlich
nicht für der Jajin Nessach. Jajin Nessach wurde extra als Opfer-
oder Messwein hergestellt. Dieser Wein stammte und stammt noch heute aus
klösterlichen Weingütern. Dieser Messwein, der sich in der Herstellung
von den andern Weinen nicht unterscheidet, ist unkoscher wegen des Verwendungszweckes.
Da im Christentum der Messwein mit Blut assoziiert wird, ist dieser Wein
doppelt unkoscher und der Gebrauch im Judentum strengstens verboten.
Eine Legende, die besagt,
dass Juden keinen Alkohol trinken, stimmt nicht. So wurde in Gegenden mit
Weinbau immer, auch im gewöhnlichen Alltag, Wein getrunken. In Gegenden
ohne Weinbau (Osteuropa) trank man eher «geistige» Getränke
wie Wodka. Dort wurde der Kidduschwein eingeführt. Dieser Wein kam
von weit her. Nur wenige sehr süssen Sorten waren transportfähig
und über längere Zeit haltbar. Dieser Wein kam aus der Türkei
oder aus Ungarn. Meistens wurde er aus Rosinen hergestellt, da diese süss
und billig waren. Durch die osteuropäischen Einwanderer wurde diese
Art von Tradition im 20. Jahrhundert bei uns eingeführt und bis in
die siebziger Jahre gepflegt. Mit den modernen Transportmöglichkeiten
haben wir heute sehr guten Wein aus kontrollierten Anbaugebieten aus Israel.
Wer darf wem Wein einschenken?
Darf ein Jude mit einem Nichtjuden Wein trinken? Diese Fragen kannte man
in den Weingegenden nicht, da der Wein zu Hause getrunken und vom Hausherr
eingeschenkt wurde. Grundsätzlich galt, dass ein Jude den Wein öffnen
und auch einem Nichtjuden einschenken durfte.
Eine andere Art von Koscherwein
ist der Wein Jajin Mevuschal. Dies ist eine Abfüllmethode, die im
babylonischen Talmud beschreiben und die wieder vermehrt in Israel praktiziert
wird. Dabei wird der Wein rasch und ganz kurz soweit erhitzt, bis die Hand
zuckt (ca. 82.4° C). Der Grundgedanke dieser Methode ist, dass der
Wein stabil bleibt und sich nicht weiter verändern kann. Durch die
Erhitzung werden auch alle schlechten, nicht koscheren Einflüsse beseitigt.
Ein so gekelterter Wein ist dann in seiner Entwicklung abgeschlossen, er
kann nicht weiter reifen, wie das bekannte grosse Weine in der Regel tun.
Steffi Bollag verwöhnte
uns nach ihrem interessanten Vortrag mit einem Gläschen guten israelischen
Koscherwein.
Protokoll: Yves Schneider
[zurück
zum Inhalt]
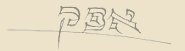
Jom
Ijun Lerntag
Sonntag, 24. Juni 2001
in den Räumlichkeiten
der Israelitischen Gemeinde Basel
Leimenstrasse 24, 4003 Basel
Eine Veranstaltung von IGB
und Ofek
Programmübersicht (Schiurim/Sessions
à 1,5 Stunden):
A: 10.30 bis 12.00 Uhr
B: 13.15 bis 14.45 Uhr
C: 15 bis 16.30 Uhr
-
613 Gebote Last oder Lust?
Einblicke in die Bedeutung der MizwotEva Pruschy-Gregor
-
Der Begriff «Lernen»
im Talmud. Chawruta (Lernen in Zweiergruppen)Esther Kontarsky
-
Von der Traube zum Wein. Blicke
in die Geschichte des Koscherweins. Steffi Bollag
-
Von Mensch zu Mensch. Elf Jahre
jüdisch-palästinensische Gesprächsgruppe Basel.Dr. Edward
Badeen und Dr. Peter Dreyfus
-
Aaron Annäherungen an
eine biblische FigurDr. Alfred Bodenheimer
-
Die Tora hat 70 Gesichter. Einführung
in den Midrasch Michel Bollag
-
Das Benschen. Musikalische und
textliche Vielfalt im Tischgebet Marcel Lang
-
0,3 Prozent im Spiegel der Schweizer
Presse. Ein Blick auf jüdische Themen in der Schweizer Medienlandschaft
Pierre Weill
-
Mirjam auf den Spuren einer
ProphetinAdina Ben-Chorin (Schiur in englischer Sprache)
A: 10.30 bis 12.00 Uhr
A-1
613 Gebote Last oder Lust?
Einblicke in die Bedeutung der Mizwot
Eva Pruschy-Gregor
Rabbi Chanina sagte: «Bedeutender
ist der, dem etwas geboten ist und es tut, als der, dem es nicht geboten
ist und es tut» (Kidd. 31b). Beschäftigen uns heute die gleichen
Fragen zur Bedeutung der Mitzwot wie unsere rabbinischen Vorfahren? Anhand
verschiedener rabbinischer und moderner Textquellen (Gemarah und jüdische
Philosophen der Neuzeit) untersuchen wir Parallelen und Unterschiede und
vergleichen sie mit unseren eigenen Ansprüchen.
A-2
Von Mensch zu Mensch. Elf
Jahre jüdisch-palästinensische Gesprächsgruppe Basel
Dr. Edward Badeen und Dr.
Peter Dreyfus
Seit 1990 treffen sich in
der Region Basel lebende palästinensische und jüdische Frauen
und Männer. Aus den Begegnungen von Fremden, aus Gesprächen und
Diskussionen über Politik, Vorurteile und persönliche Ängste
ist gegenseitiges Verständnis entstanden. Freundschaften haben sich
gebildet. Edward Badeen und Peter Dreyfus berichten über ihre Erfahrungen,
ihre Ziele und Aktivitäten und laden ein zur Diskussion.
A-3
Das Benschen. Musikalische
und textliche Vielfalt im Tischgebet
Marcel Lang
Wir kennen drei verschiedene
Arten von Brachot/Segenssprüchen (Matbea Kazar, Matbea Aroch und Bracha
Hasmucha Lachawerta). Im Benschen, dem Tischgebet, sind alle drei Bracha-Formen
enthalten. Vielfältig ist das Benschen auch in bezug auf seine Melodien.
Wir lernen verschiedene inhaltliche und musikalische Varianten des Tischgebetes
kennen und vergleichen sie miteinander.
B: 13.15 bis 14.45 Uhr
B-1
Der Begriff «Lernen»
im Talmud. Chawruta
(Lernen in Zweiergruppen)
Esther Kontarsky
Chawruta ist das klassische
Studium jüdischer Quellentexte aus Tenach (Bibel), Talmud und weiteren
Schriften in Zweiergruppen. Thema des Chawruta-Lernens von Jom Ijun ist
der Begriff «Lernen» im Talmud. Gemeinsam mit einem Lernpartner
oder einer Lernpartnerin werden Quellentexte (mit deutscher Übersetzung)
gelesen und diskutiert. Esther Kontarsky vermittelt eine kurze Einführung
in die Technik der Chawruta und beantwortet Fragen zum Thema oder zur Lernmethode.
B-2
Aaron Annäherungen
an eine biblische Figur
Dr. Alfred Bodenheimer
Aaron, der erste Hohepriester
Israels, steht oft im Schatten seines jüngeren Bruder Moses. An der
entscheidenden Stelle, wo er in eigener Verantwortung handeln muss, versagt
er: Er ist nicht imstande, die Herstellung des Goldenen Kalbes zu verhindern.
Dennoch wird er und nicht Moses oder etwa Josua zum Hohenpriester bestimmt.
Weshalb?
Durch die Untersuchung einzelner
Textstellen wollen wir uns mit der biblischen und der rabbinischen Darstellung
Aarons auseinandersetzen. Schließlich sollen auch noch moderne Darstellungen
Aarons (bei Arnold Schönberg und Thomas Mann) in den Blick genommen
werden.
B-3
0,3 Prozent im Spiegel der
Schweizer Medien. Ein Blick auf jüdische Themen in der Schweizer Medienlandschaft
Pierre Weill
Die in der Schweiz lebenden
Jüdinnen und Juden sind eine verschwindend kleine Minderheit: Bei
einer Bevölkerung von sieben Millionen sind 18'000 Personen jüdisch.
Berichten die Medien tatsächlich überproportional über jüdische
Themen oder handelt es sich um das Phänomen der selektiven Wahrnehmung?
Der Journalist Pierre Weill wirft einen kritischen Blick auf die Berichterstattung
und auf die Reaktionen bei den Leserinnen und Lesern.
C: 15 bis 16.30 Uhr
C-1
Von der Traube zum Wein.
Blicke in die Geschichte des Koscherweins
Steffi Bollag
In vielen Ländern der
Welt wird Koscherwein produziert, auch im benachbarten Elsass. Was ist
Koscherwein und wie wird er hergestellt? Ausgehend von einer biblischen
Quelle zum Thema vermittelt Steffi Bollag Einblicke in die Geschichte und
Tradition der Koscherwein-Produktion.
C-2
Die Tora hat 70 Gesichter.
Einführung in den Midrasch
Michel Bollag
Midraschim sind Teil der
rabbinischen Literatur und beinhalten Interpretation und Auslegung biblischer
Texte. Es gibt eine Fülle von Midraschim im Talmud und in späteren
rabbinischen Schriften. Sie haben die Funktion, Unverständliches verständlich
zu machen, Lücken zu füllen, biblischen Protagonisten eine Stimme
zu verleihen. Anhand verschiedener Midraschim vermittelt Michel Bollag
Einblicke in das Wesen des Midrasch.
C-3
Mirjam auf den Spuren
einer Prophetin
Adina Ben-Chorin
Mirjam begegnen wir in der
Tora viermal. Dreimal spielt dabei das Element Wasser eine wichtige Rolle.
Ähnlich wie bei den meisten bekannten biblischen Fauenfiguren ist
der Toratext über die Prophetin Mirjam knapp und unvollständig,
Teile ihres Lebens bleiben Fragmente. Unbestritten aber ist Mirjam eine
starke Persönlichkeit mit einem festen Platz in der jüdischen
Tradition. Wir lesen die vier Textstellen (mit englischer und deutscher
Übersetzung) und diskutieren sie anhand von rabbinischen und zeitgenössischen
Midraschim. Adina Ben-Chorin leitet diesen Schiur in englischer Sprache.
Die Leiterinnen und Leiter
der Schiurim/Sessions
Dr. Edward Badeen wurde 1944
in Nazareth, Palästina, geboren. Er studierte Arabische und
Englische Literatur in Jerusalem, Islamwissenschaft, Englische Literaturwissenschaft,
Psychologie und Semitische Philologie in Basel und unterrichtet an den
Universitäten Basel und Zürich. Wissenschaftliche Veröffentlichungen
in Islamwissenschaft und Mitwirkung an Übersetzungen aus der modernen
Arabischen Literatur. Edward Badeen ist aktiv im Dialog zwischen Palästinensern
und Juden.
Adina Ben-Chorin wurde in
den USA geboren und lebt seit fünf Jahren in Zürich, wo ihr Mann
Tovia Ben-Chorin als Rabbiner der Jüdischen Liberalen Gemeinde Or
Chadasch tätig ist. Adina Ben-Chorin ist Stadtplanerin und Übersetzerin.
Seit vielen Jahren unterrichtet sie und hält Vorträge. Ihre Lehrtätigkeit
umfasst Fächer der Judaistik. Zu ihren Themenschwerpunkten gehören
Bibelstudium sowie die Rolle der Frau im Judentum in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft.
Dr. Alfred Bodenheimer ist
Lehr- und Forschungsbeauftragter für Judaistik an der Universität
Luzern. Er hat an der Universität
Basel, der Yeshiva University New York und der Yeshivat Hamivtar (Israel)
studiert. Seine Hablilitation über die Authentizität der jüdischen
Moderne zwischen Heinrich Heine und Philip Roth wird demnächst an
der Universität Genf eingereicht. Alfred Bodenheimers Spezialgebiete
sind moderne jüdische Literaturgeschichte, Bibelexegese und Rabbinertum
im 20. Jahrhundert sowie jüdische Historiografie.
Michel Bollag ist Rabbinatsassistent
der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) und leitet gemeinsam
mit Dr. theol. Hanspeter Ernst das Zürcher Lehrhaus. Michel Bollag
hat Pädagogik, Psychologie und Philosophie studiert und arbeitet seit
den siebziger Jahren in der ICZ, anfänglich als Lehrer und später
auch als Rektor der Religionsschule. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören
jüdische Spiritualität und Gebetspraxis sowie jüdische Religionsphilosophie.
Steffi Bollag wurde in Basel
geboren und ist Krankenschwester, Hebamme und Lehrerin für Krankenpflege.
Seit vielen Jahren ist sie auch journalistlisch tätig. Zu den Themenschwerpunkten
von Steffi Bollag gehört die koschere Küche in Theorie und Praxis.
Dr. Peter Dreyfus ist Psychoanalytiker
und engagiert sich seit etwa 20 Jahren aktiv für die friedliche Koexistenz
zwischen Juden und Palästinensern.
Esther Kontarsky ist in Deutschland
geboren und aufgewachsen. Sie hat Musikwissenschaft, Romanistik und Judaistik
studiert. Esther Kontarsky lebt in Berlin und ist dort als Übersetzerin
und Mitarbeiterin in verschiedenen Projekten tätig.
Marcel Lang studierte Gesang
bei Kurt Widmer und Hans Riediker an der Musikakademie Basel und dem angeschlossenen
Opernstudio. In Zürich absolvierte er anschliessend ein Psychologiestudium.
Während neun Jahren war Marcel Lang Oberkantor der Israelitischen
Gemeinde Basel, seit 1991 ist er ständiger Gastkantor der Jüdischen
Gemeinde Düsseldorf. Im Rahmen seiner Konzerttätigkeit tritt
er als Interpret von synagogaler Musik und jiddischen Liedern sowie als
Konzert- und Oratoriensänger auf.
Eva Pruschy-Gregor hat an
der Universität Zürich Englisch und Geschichte und in den USA
Judaistik studiert. Sie ist bei der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich
angestellt und dort für das Pädagogische Zentrum und die Lehrmittelentwicklung
zuständig. Daneben beschäftigt sie sich mit jüdischer Philosophie
und mit der Stellung der Frau im Judentum.
Pierre Weill ist Wirtschaftsredaktor
bei der Basler Zeitung. Er blickt auf eine langjährige Erfahrung als
Journalist bei zahlreichen Medien Tagesschau DRS, Jüdische Rundschau,
TagesAnzeiger (Korrespondent in Washington), Cash zurück zum Inhalt.
Er ist Autor von «Der Milliarden-Deal. Holocaust-Gelder wie sich
die Schweizer Banken frei kauften.»
[zurück
zum Inhalt]
|