Soziale Identitätspsychologie
©2002 beim Verfasser.
schützt das Gemüt
vor dem Verstand
Wenn wir heute feststellen, dass das zwanzigste Jahrhundert eines der abscheulichsten Rassen- und Religionskriege war, dann dürften wir, nach den ersten Erfahrungen des neuen Jahrtausends, beunruhigt erkennen, dass unser neues Jahrhundert nichts Besseres verheisst. Gemessen an der Kriegsgeschichte war ja jedes Zeitalter abscheulich, denn Kriege scheinen unvermeidbare Formen menschlicher Impulsleistungen zu sein. Freilich lassen sich grosse und kleine Kriege feststellen, die sich aber in Nichts im Leid unterscheiden, das sich Menschen gegenseitig antun. Die Werkzeuge des Kriegshandwerks sind wohl zu immer gewaltigeren Vernichtungsmitteln entwickelt worden, aber die Motivation, einander vernichten zu wollen, ist stets dieselbe geblieben. Grössere Kollektive verkörpern ein grösseres Machtpotential als kleinere, auch wenn sich das nicht immer auch als Machtüberlegenheit auszahlt. Die Kriegsrethorik entspricht nicht immer dem Potential, aber doch wohl dem Ingrimm der feindlichen Parteien. An diesen Geschehnissen ist abzulesen, dass es so etwas wie eine Kollektivseele geben könnte, weil einzelne Menschen wohl kämpfen und leiden, aber nicht Kriege darstellen.
Der Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts bescherte uns eine exzessive Bedrohungslage mit der Möglichkeit erneuter Weltkriege. Das Drohritual ist auch bei unterschiedlichen Machtmitteln überall gleich. Die Interessenlage ist an den rituellen Aufzügen erkennbar, aber nicht an der Verbalisation. Die Gewaltlüsternen sagen etwas anderes als sie meinen, so dass unabhängig von den Kräfteverhältnissen, stets dieselbe Rhetorik zu hören ist. Das neue Jahrtausend begann mit den besonders brisanten Konflikten:
Israel versus Palästina; USA versus afghanische Taliban in aller Welt;
Russland versus Tschetschenien; Indien versus Pakistan.
Atommächte bedrohen die Habenichtse an atomaren Arsenalen, in einem Fall stehen sich zwei Atommächte gegenüber, die aber über enorm ungleiche Ressourcen verfügen. Indien hat ein mehrfach grösseres Menschen-, Wirtschafts- und Bewaffnungspotential zur Hand, als das Objekt seiner Kriegsgelüste, Pakistan.
Weil die Schwächeren stets durch die ihnen angetanen Erniedrigungen fanatisiert werden, wird diese Situation auf lange Dauer mit Sprengstoff geladen, der auch unvermittelt explodieren kann. Mit der Resignation hingegen, würde ein Subjekt verenden. Erschreckend ist die Gleichzeitigkeit der Krisen, und doch gibt es ältere Vorgaben für spätere Nachahmer. Die Kriegsrhetorik scheint aus einer antiken Kultursprache, vor der wir sonst grosse Ehrfurcht haben, in alle zeitgemässen Idiome der beteiligten Völker übersetzt. Gemäss dem rhetorischen Regelmass treibt die schwächere Partei Terrorismus, während die stärkere Seite straft. Das Recht zu strafen scheint sich von der Erfolgsquote im Töten herzuleiten. Die Summe bringt's. Die Bösen sollen mehr Tote zu beklagen haben als die Guten. Die Taktik ist erpresserisch: Auf die Selbstmordaktion eines einzelnen Lebensmüden, wird mit schwerem Geschütz, Panzern und Bulldozern zur Vernichtung von Wohnraum, Kulturland und Infrastruktur, sowie mit der Aufsplitterung der Siedlungsräume und der Ghettoisierung (Gaza und Westbank 2002 = Warschau 1943) des Umfeldes der Einzeltäter geantwortet. Panzergranaten gegen handgeschleuderte Steine, Köpfe um Augen, Hälse um Zähne sind die Regel.
Es sind nicht durchgehend dieselben Bewunderer des gegen die Engländer und die palästinensischen Araber gerichteten Terrorismus, dank dem die seinerzeitigen zionistischen Immigranten sich 1947 ihren Staat ertrotzten, die heutigentags die harte israelische Repression des palästinensischen Terrors bewundern. Schliesslich liegt mehr als ein halbes Jahrhundert zwischen den Geschehnissen, indem diese tun, was jene taten und haben, was diese hatten. Israel geht es teils unverhohlen um die Vertreibung der nichtjüdischen Bevölkerung Palästinas, doch vorerst um die Ausschaltung der Partisanen, die sich als Freiheitskämpfer verstehen, aber von Israel als Terroristen angesehen werden.
Den Vereinigten Staaten von Nordamerika geht es darum "Flagge zu zeigen", um ihre selbstgewählte Rolle als Weltordnungsmacht mit eigener Ideologie von Weltwirtschaft, Weltgesetzen, in aller Welt gleichen Regierungs- und Rechtsformen, bei ungleicher Verteilung der Reichtümer und Ressourcen durchzusetzen; vorerst aber um die Eliminierung von Widerstandsformen fanatisierter Glaubensbekenner, die sich als Gotteskämpfer verstehen, aber von den USA als Terroristen angesehen werden.
Russland geht es um die territoriale Einverleibung Tschetscheniens, und vorerst um die Ausschaltung der Partisanen, die sich als Freiheitskämpfer verstehen, aber von Russland als Terroristen angesehen werden.
Indien geht es um die endgültige Einverleibung Kaschmirs und vorerst um die Ausschaltung von dessen Partisanen, die sich als Freiheitskämpfer verstehen, aber von Indien als Terroristen angesehen werden.
Obwohl in allen Beispielen das Selbstlob der Mächtigen auffällt, verdeckt die rhetorische Gewandtheit doch nicht, dass deren Kriegsmaschinerien angelaufen sind. Leider gibt es noch mehr aktuelle Kriegsschauplätze als die hier genannten.
Der Vorgang ist überall gleich, die Sprachen sind zwar phonetisch verschieden, aber die Zeremonien der Macht sind so direkt, dass sie auch ohne Vokabular verstanden werden. Die Vorgänge sind wahr, nicht die Beteuerungen. Die Machtmittel sind Gebrauchsgegenstände im Dienste einer Dynamik, die unmöglich von einer humanitären Logik ausgehen kann. Das Kalkül ist simpel: Der Schwache wird zum Feind, gegen den der Stärkere sein Faustrecht einfordert, und Tätlichkeiten sollen klären, wer der Stärkere ist.
Keine Psychologie unseres Zeitalters hat für diesen Irrsinn eine Therapie entwickelt, weil keine Psychologie dieser Zeit die treffende Diagnose des kollektiven Wahnsinns kennt. Solche beziehen sich immer auf als Individuen gesehene Subjekte und lassen den Einbezug der Einzelnen in grössere Identitätseinheiten aus.
Wir haben Grund zur Annahme, dass das Erleben, Fühlen und Denken des Menschen vornehmlich in Beziehungsbereichen, in Kreisen und deren Ausdehnung zur Horizonterweiterung erfolgt, also räumlich ist. Dafür stehen Begriffe wie Platz, Raum, Bereich, Sphäre, Umfeld, und auch der seiner Etymologie entfremdete Begriff Freiheit, der besonders oft nichts anderes meint denn Spielraum, und den nehmen auch wir in Anspruch, um unsere Thesen zu stützen.
Um praxisnah zu bleiben, orientieren wir uns am politischen Tagesgeschehen. Nachvollziehbare Beispiele sind somit leicht zur Hand, um die Struktur der Abläufe anschaulich vorstellen zu können. Gegenwärtig (rund um die Jahrtausendwende) fallen z.B. die "Globalisierungsbestrebungen" auf, die von Gewaltprotesten begleitet werden. "Weltwirtschaftsgipfel", die sich mit einer noch zu schaffenden weltweiten "Chancengleichheit" befassen, werden spontan und auch durch generalstabsmässig geplante Massenproteste behindert. Ökonomischer Internationalismus wird von aggressiven Kollektiven bekämpft, auf deren Fahnen oft gleichzeitig die Symbole des politischen, nun bereits bankrotten marxistischen Wirtschafts-Internationalismus flattern. Das ist paradox, denn der eine Internationalismus ist durch den anderen nicht zu widerlegen. Die bekannten Gewaltszenen zwischen den verschiedenen Globalisierungsideologien sind sachlich nicht begründet, und dennoch sind sie wirklich. Es dürfte sich um Manifeste eines "Unbehagens im Grenzenlosen" handeln. Die humane Wirklichkeit ist durch ihre humanen Grenzen bestimmt und wird durch diese fasslich. Entscheidend für das subjektive Wohlbefinden ist immer der engere Sozialbereich. Von hier aus wird Miss- oder Wohlbehagen auf die Umwelt übertragen. Soziale Probleme sind eine Ausstrahlung summierten, subjektiven Befindens. Das gilt besonders für die Wirtschaft, die jedermanns Lebensgrundlage ist. Sie muss fassbar sein, um Wohlbehagen zu erlauben. Den Randalierern geht es nicht darum, ungünstige Wirtschafts- bzw. Lebensbedingungen zu verteidigen, sondern darum, ihr gesteigertes Missbehagen durch Wut in Tätlichkeiten umzusetzen. Wie solche "Sozialgefühle" beschaffen sind, sollte sozialpsychologisch dargelegt werden. Die oberflächliche Diagnose, es handle sich um Auswüchse politischer Agitation, genügt nicht, denn damit eine solche wirken kann, ist die entsprechende Ausrichtung einer Grundstimmung vorausgesetzt. Um diese handelt es sich, die verstanden werden muss, um Agitation neutralisieren zu können.
Die offene Frage ist, aus welchen Grundstimmungen welche Dynamik entkeimt. Die "Strukturen der mentalen Wirklichkeit" müssen erforscht werden, um die "sich aus sich selbst heraus organisierende Gewalt" verstehen zu können, welche sozio-emotionale Ladungen explodieren lässt. Darüber gibt Demoskopie nur rudimentäre Auskunft, denn es sind unterschwellige Stimmungen dafür verantwortlich, die nicht einfach auf der Zunge liegen, und es müsste auch schon die Fragestellung gemäss entsprechenden Vorkenntnissen gebildet sein.
Der zweite Weltkrieg (1939-1945) hatte zwar Anlass gegeben, das Augenmerk vermehrt auf kollektivpsychologische Phänomene zu lenken, aber während der fetten Jahre der zweiten Jahrhunderthälfte war die dabei entstandene Fachliteratur obsolet geworden. Um die Grundzüge der sozialen Identitätspsychologie zu diskutieren, sollte sie jedoch in Betracht gezogen werden. Es wäre unklug, diesen latenten, bisweilen sehr akuten Problemen mit der Floskel auszuweichen, dass es sich um Theoreme handle, die viel zu praxisfern seien, um sich damit beschäftigen zu müssen. Sie brennen uns ja auf den Nägeln.
Auffällig sind auch die Rassenunruhen, denen man durch Antirassismusgesetze herr zu werden glaubt. Solche Gesetze sind jedoch zugespitzte Charakterisierungen, die eher zur Polarisierung als zur gegenseitigen Annäherung führen. Das Problem liegt anderswo. Wenn Zuwanderungen besonderer Kulturgruppen eine proportional kritische Grösse zur autochthonen Bevölkerung erreichen, dann assimilieren diese Immigranten sich nicht, sondern behaupten ihre kulturelle Eigenständigkeit mit dem Anspruch auf sogenannte "Gleichstellung", was aber "Dominanz" meint. Es setzt die Dynamik zur Schaffung einer neuen Rangstufenordnung ein. Das geschieht nicht nur bei sichtbar unterschiedlichen Rassenmerkmalen, sondern auch innerhalb derselben Rasse, wenn Kulturunterschiede zum Klassenkampf führen, und im Ansatz gibt es das gleiche Phänomen ebenfalls bei den grossen Generationenkonflikten. Es genügt der Blick zurück auf die 68er Unruhen, als die damaligen Jungakademiker mit dem Schlachtruf "Traue keinem über 30!" ihren Marsch durch die Institutionen in die hierarchischen Positionen antraten, die sie nun besetzen, um zu ahnen, dass wir es dabei mit naturgesetzlichen Abläufen, deren Strukturen erforscht werden sollten, zu tun haben. Sie waren sehr emotional, die Wortführer von damals. Mittlerweile sind sie selbst über die fünfzig gealtert und dabei alternde Wortführer einer alten Generation geworden.
Hier wird die Meinung vertreten, dass sich ohne die nun zu entwickelnden Grundlagen, das politische und allgemein soziale Tagesgeschehen weder ordnen noch verstehen liesse. Die sozialpsychologische Dynamik muss ja – notwendigerweise – einer natürlichen Anlage folgen, und mit dieser Arbeit über die soziale Identität werden solche Strukturen der emotionalen Wirklichkeit vorgestellt, die unser Wahrnehmen, Fühlen und Handeln bestimmen. Es geht nicht darum zu moralisieren, nicht um die Kunst, durch polarisieren von Adjektiven Ereignisse zu thematisieren, die wie Wohlklang durch das Gehör in die moralische Instanz eines obwohl virtuellen, aber dennoch real dynamisierenden Über-Ich gelangen. Es geht um Vorgänge, also darum zu verstehen, wie Lebendiges sich vom Statischen unterscheidet. Es geht nicht um gut oder böse, recht oder schlecht, sondern um gekünstelt oder echt! Was wirklich ist beschäftigt uns, auch wenn es unangenehm wirkt, denn auch das ist wirklich. Wir versuchen die untheologische Daseinsbetrachtung, versuchen die Gestaltswahrnehmung der Vorgänge auch zu erfassen, die wir ohne es zu wollen ständig erfahren, indem wir leben und sind.
Am Anfang stand die Feststellung, dass Identität und Intimität von ein – und derselben Struktur seien, die zudem in den grammatischen Grundformen des Gebrauchs der Personalpronomina festgelegt ist und Ausdruck findet. Auf der Ebene der Gestaltwahrnehmung verbleibend, gehen wir der mentalen Wirklichkeit nach, um dieses Gefüge darzustellen.
verbleibend, gehen wir der mentalen Wirklichkeit nach, um dieses Gefüge darzustellen.
Wir sind der Meinung, dass die theoretischen Tiefenpsychologien, die vor allem mit der Schuld der Eltern an den Fehlentwicklungen der Triebbefriedigung ihrer Zöglinge operieren, auf die realistische Basis der Selbstregulierung von endogenen Veranlagungen, ergänzt durch postnatale Prägungen freier Potentiale durch zeittypische, allgemeine Moralvariablen, zurückgeführt werden sollten; auch sehen wir den Sexualtrieb nicht als alleinige Quelle und Ziel unseres Sinnens und Trachtens. Die Selbstdarstellung, mit ihren mannigfaltigen Ausprägungen, zeigt zumindest, dass es uns treibt, als ein Selbst im sozialen Umfeld wahrgenommen und anerkannt zu werden. Die aktuelle Wirklichkeit scheint jeweilen der Prüfstein zur Feststellung des Eigenwertes zu sein.
Wir gehen folglich von Aktualitäten aus, um vor allem zu klären, ob es eine neue, bis dato nicht bekannte Dynamik psychosozialer Funktionen gibt (Gestaltwandel), und inwiefern die Funktionsdynamik ein endogener Automatismus (Instinkt) und/oder eine exogene, das heisst eine freie, von aussen bestimmte Angelegenheit ist.
Wir suchen die Gliederung solcher Mechanismen zu erkennen, die, falls es endogene Verhaltensmuster gäbe, ja notwendigerweise dazugehören würde. Es geht uns also darum, Gefüge von emotionalen Vorgängen darzustellen, deren Koordinaten durch soziale Bindungsbereiche gegeben sind .
.
Der Vorsatz, Strukturen von Verhaltensweisen, die das Zusammenleben steuern, an konkreten Beispielen festzumachen, lenkt unser Augenmerk auch auf gewalttätige Auseinandersetzungen. Uns beelendet die Drangsalierung der Schwächeren, und wir rufen nach Gerechtigkeit! Aber Recht ist eine Normgrösse, die in einem soziologischen Inkreis verbindlich ist, und inkreisspezifische Normen befremden im Auskreis. In der Begegnung an den Trennlinien ist die gegenseitige Angleichung der gesellschaftlichen Grundregeln jedoch möglich. Die Geissel der Menschheit ist nicht die Verschiedenheit der Ansichten (die ist eher belebend), sondern der emotionale Zustand Fanatismus, mit dem versucht wird, Konformität in allen zwischenmenschlichen Kontaktbereichen zu erzwingen.
Wir nehmen an, dass die impulsive Steuerung des individuellen Sozialverhaltens als Empfindung des "In-guten-Treuen rechtens zu handeln" wirkt, weil die funktionale Natur des Menschen grundsätzlich sozial bestimmt ist. Folglich bemühen wir uns hier um Argumente zur Stützung dieser These. Es ist eine Psychologie, die das Individuum in die umfassendere Identität einer sozialen Intimität einschliesst.
"Völker werden von Völkern beeinflusst, und entscheidend ist dabei das jeweilige Selbstverständnis, das sich im Verhalten all ihrer Vertreter auf allen Ebenen ausdrückt." So hat Max Frenkel in seinem Aufsatz zum Stand der Dinge, mit dem Titel: "Lorbeeren sind da kaum zu holen", den politisch entscheidenden Funktionskreis dargestellt. Was liegt näher, als die Struktur dieser Vorgänge aufzuschlüsseln? Das soll nun im Folgenden diskutiert werden.
So hat Max Frenkel in seinem Aufsatz zum Stand der Dinge, mit dem Titel: "Lorbeeren sind da kaum zu holen", den politisch entscheidenden Funktionskreis dargestellt. Was liegt näher, als die Struktur dieser Vorgänge aufzuschlüsseln? Das soll nun im Folgenden diskutiert werden.
Nichts ist ohne Grund so wie es ist.
Die Selbstdarstellung fordert dem Menschen viel Phantasie und schöpferischen Impetus ab. Sie hat sozusagen keine Grenzen innerhalb alles Menschenmöglichen. Diese Erkenntnis ist zwar biblischen Alters, aber dort bekennt sich nur der Qohèlet dazu. Ansonsten wird, im gegenseitigen Bescheidwissen, solche intime Gewissheit nur aus der Defensive heraus angriffig verbalisiert, denn sie ist peinlich. Selbstdarstellung spielt auf der Klaviatur der Tugenden wie der Untugenden, sie übertreibt allenfalls in Güte wie in Bösartigkeit, sie ist ein Individualtrieb wie auch ein Kollektivphänomen und drückt sich in ausgewogener Beziehungskunst wie in Massenpsychosen aus. Die Welt ist eine Schaubühne der Eitelkeiten, und der Bühnenprospekt ist in der Politik besonders breit angelegt. Eitelkeit macht blind für die Grenzen des Angemessenen. Welche Bedeutung die Nachahmung bei diesen Aktivitäten hat, wird greifbar anschaulich auf dem Laufsteg der Modeschauen vorgeführt. Es scheint mit dieser Nachahmung auch die Verführung zur progressiven Steigerung der Protagonisten verbunden. Die Spielregeln sind in allen Bereichen, die wir modisch nennen, gleich, von der Damenkonfektion bis hin zur Konjunktur der Weltanschauungen.
dazu. Ansonsten wird, im gegenseitigen Bescheidwissen, solche intime Gewissheit nur aus der Defensive heraus angriffig verbalisiert, denn sie ist peinlich. Selbstdarstellung spielt auf der Klaviatur der Tugenden wie der Untugenden, sie übertreibt allenfalls in Güte wie in Bösartigkeit, sie ist ein Individualtrieb wie auch ein Kollektivphänomen und drückt sich in ausgewogener Beziehungskunst wie in Massenpsychosen aus. Die Welt ist eine Schaubühne der Eitelkeiten, und der Bühnenprospekt ist in der Politik besonders breit angelegt. Eitelkeit macht blind für die Grenzen des Angemessenen. Welche Bedeutung die Nachahmung bei diesen Aktivitäten hat, wird greifbar anschaulich auf dem Laufsteg der Modeschauen vorgeführt. Es scheint mit dieser Nachahmung auch die Verführung zur progressiven Steigerung der Protagonisten verbunden. Die Spielregeln sind in allen Bereichen, die wir modisch nennen, gleich, von der Damenkonfektion bis hin zur Konjunktur der Weltanschauungen.
Bei den Bemühungen, die seelischen Vorgänge der menschlichen Natur zu verstehen, ist davon auszugehen, dass es eine grundlegend endogene Steuerung des Verhaltens gibt . Es ist nicht jeden Tag neu, aber kann jeden Tag in einer anderen Anpassung an die Umfeldvariablen erscheinen. Es stimmt zwar, dass jede Generation sich ihre eigene Welt jeweilen erstmals erschafft, neu entdeckt; aber es ist eine alte Welt, und deren Neuerschaffung geschieht stereotyp. Den typischen einmaligen Tyrannen? Jede Generation hat den ihren, und wenn sie ihn nicht haben sollte, würde sie einen erfinden.
. Es ist nicht jeden Tag neu, aber kann jeden Tag in einer anderen Anpassung an die Umfeldvariablen erscheinen. Es stimmt zwar, dass jede Generation sich ihre eigene Welt jeweilen erstmals erschafft, neu entdeckt; aber es ist eine alte Welt, und deren Neuerschaffung geschieht stereotyp. Den typischen einmaligen Tyrannen? Jede Generation hat den ihren, und wenn sie ihn nicht haben sollte, würde sie einen erfinden.
Jede Epoche hat ihren Menschenrechtsapostel, und oftmals ist gerade er der für die Zeit typische Tyrann. Terror wird mit Forderungen ausgeübt, und somit kann sogar das gute Beispiel zum Terror gereichen. Tugendanforderungen können ganze Sippschaften nötigen, ihrer Natur zuwider zu handeln und somit sich selbst fremd zu sein; aber das wird dann Erziehung genannt.
Um die Dynamik von Verhaltensformen am Objekt studieren zu können, eignet sich jedes Geschehnis, in welches Gruppen und Körperschaften politischer, sportlicher, kirchlicher, beruflicher, gesellschaftlicher und verwandtschaftlicher Natur verquickt sind. Es kann auch jede von Menschen bewohnte oder beanspruchte Region Anschauungsmaterial zu Feldstudien bieten, und kriegerische Ereignisse sind darin die akuten Episoden, an denen sich erforschen lässt, ob die erkannten Abläufe den Wert naturgesetzlicher Normen haben. Einen Sinn für Naturgesetzlichkeit müsste ein Forscher allerdings mitbringen.
Zu diesem Sachgebiet liegt einige Literatur vor, beginnend mit den Verhaltensstudien an Tieren, angefangen von den Bienen , über hierarchische Organisationen höherer Säuger, bis zur Humanethologie. Adolf Portmann
, über hierarchische Organisationen höherer Säuger, bis zur Humanethologie. Adolf Portmann , selbst Biologe, sagt dazu: "Die Wege zu solchem Wissen führen über das wissenschaftliche Erkennen, dessen Einsichten voll eingehen müssen in das umfassendere Erfahren von den Gestalten, wenn die Beziehung zum andern Leben nicht blosses freies Schwärmen des Gefühls, sondern Weg zu wahrem vertieftem Erleben sein soll", womit er selbst sich eine schwärmerische Dimension erhalten hat. Eine solche legt Zeugnis von den Gefühlen ab die uns bewegen und gilt deshalb als edel. Unser Denken ist stets auch gefühlsbestimmt.
, selbst Biologe, sagt dazu: "Die Wege zu solchem Wissen führen über das wissenschaftliche Erkennen, dessen Einsichten voll eingehen müssen in das umfassendere Erfahren von den Gestalten, wenn die Beziehung zum andern Leben nicht blosses freies Schwärmen des Gefühls, sondern Weg zu wahrem vertieftem Erleben sein soll", womit er selbst sich eine schwärmerische Dimension erhalten hat. Eine solche legt Zeugnis von den Gefühlen ab die uns bewegen und gilt deshalb als edel. Unser Denken ist stets auch gefühlsbestimmt.
Die Evolution (Biologie) ist der lebendige Prozess, der den Erkenntnisgewinn belegt, welcher dem Vorgang selbst innewohnt. Im Bereiche der Morphologie geschieht dies unbewusst. Die phsysikalischen Eigenschaften des Wassers bestimmen die Zweckmässigkeit der Struktur der Flossen von Wasserbewohnern; die Physik der Luft entscheidet über die Sinnfälligkeit der Morphologie derer, die sich in die Lüfte erheben. Die zweckmässigen Organe sind auf die Bedingungen zu entwickelt. Zerebrale Systeme sind ihrer Umwelt angemessen, so auch dasjenige des Menschen, das den bewussten Erkenntnisgewinn ermöglicht . Es ist ein Phänomen des kreisartigen Prozesses des sich gegenseitig bedingenden Wechselspiels zwischen Organismus und Umwelt, Umwelt und Organismus (Gestaltkreis
. Es ist ein Phänomen des kreisartigen Prozesses des sich gegenseitig bedingenden Wechselspiels zwischen Organismus und Umwelt, Umwelt und Organismus (Gestaltkreis ).
).
Übertragen wir diese, zur allgemeinen Grundbildung gehörenden Einsichten auf bestimmte menschliche Talente, dann ist zu schliessen, dass auch das Empfindensspektrum in solchen Wechselfunktionen strukturiert ist.
Immanuel Kant war der Ansicht, dass Anschauungsformen a priori vorgegeben seien, gewissermassen als Brillen, ohne welche wir nicht sehen könnten. Konrad Lorenz
war der Ansicht, dass Anschauungsformen a priori vorgegeben seien, gewissermassen als Brillen, ohne welche wir nicht sehen könnten. Konrad Lorenz kam mit seinen Forschungen zum Schluss, dass Anschauungsformen als Funktionen unserer Sinne und des Gehirns stammesgeschichtlich entstanden seien, und so sich auf Grund einer Jahrmillionen alten Auseinandersetzung mit, und Anpassung an reale Gegebenheiten bildeten. Für das Individuum sind sie vorausgesetzt, für die Art sind sie Ergebnis. Der Geist fiel nicht vom Himmel, titelte Hoimar v. Ditfurth, als er die Evolution unseres Bewusstseins beschrieb
kam mit seinen Forschungen zum Schluss, dass Anschauungsformen als Funktionen unserer Sinne und des Gehirns stammesgeschichtlich entstanden seien, und so sich auf Grund einer Jahrmillionen alten Auseinandersetzung mit, und Anpassung an reale Gegebenheiten bildeten. Für das Individuum sind sie vorausgesetzt, für die Art sind sie Ergebnis. Der Geist fiel nicht vom Himmel, titelte Hoimar v. Ditfurth, als er die Evolution unseres Bewusstseins beschrieb . Die neuzeitliche Biologie, in Beachtung der Merk- und Wirkwelten, hat durch Experimentieren mit Atrappen erkannt, dass dem Instinkt in engerem Sinne eine Reizsuche vorausgeht, dass Übersprungshandlungen dazwischentreten können, und erst im Endausdruck der eigentliche Instinkt ausläuft, und die spezifischen Impulse verbraucht werden
. Die neuzeitliche Biologie, in Beachtung der Merk- und Wirkwelten, hat durch Experimentieren mit Atrappen erkannt, dass dem Instinkt in engerem Sinne eine Reizsuche vorausgeht, dass Übersprungshandlungen dazwischentreten können, und erst im Endausdruck der eigentliche Instinkt ausläuft, und die spezifischen Impulse verbraucht werden . Diejenige Leistung, die das Lebewesen dem Auslöser der Instinkthandlung zuführt, wird als Appetenz bezeichnet. So stark und unveränderlich der Endinstinkt ist, so plastisch und zielstrebig ist das Suchen nach der adäquat auslösenden Aussensituation der Endhandlung
. Diejenige Leistung, die das Lebewesen dem Auslöser der Instinkthandlung zuführt, wird als Appetenz bezeichnet. So stark und unveränderlich der Endinstinkt ist, so plastisch und zielstrebig ist das Suchen nach der adäquat auslösenden Aussensituation der Endhandlung . Nach K. Lorenz
. Nach K. Lorenz ist das Appetenzverhalten zielstrebig, wobei das Ziel nicht ein Objekt oder eine bestimmte Situation ist, sondern nur die Auslösung der Instinkthandlung.
ist das Appetenzverhalten zielstrebig, wobei das Ziel nicht ein Objekt oder eine bestimmte Situation ist, sondern nur die Auslösung der Instinkthandlung.
Tinbergen meint, dass die Psychologen, die bei ihren Verhaltensexperimenten Ratten durch ein Labyrinth laufen liessen, nur selten begriffen hätten, dass die Tiere nicht des Futters oder des Nachwuchses wegen liefen, sondern nur, um zum Ablauf der Fressbewegungen oder des Pflegeverhaltens zu kommen. Es kommt zu Übersprunghandlungen, wenn zwei stark aktivierte Triebe miteinander im Wettstreit liegen oder wenn bei sehr starkem Triebe die Aussensituation nicht hinreicht, um die Endhandlung auszuführen. Auch in der Zweifelssituation zwischen Angriffs- und Fluchtstimmung, kommt es zu Übersprungshandlungen. Instinkte seien voneinander abhängig und hemmten einander. Das sind zwei notwendige Prinzipien, um chaotische Abläufe auszuschliessen. Ob das Gesamtverhalten innerhalb eines Funktionskreises mit seinen mannigfaltigen Teilhandlungen, oder ob auch einzelne Abschnitte derselben Instinkthandlung heissen sollen, kann zu Spezifizierungszwecken diskutiert werden, ohne an der Erkenntnis der Funktionsabläufe und ihrer Organisation grundsätzlich etwas zu ändern.
meint, dass die Psychologen, die bei ihren Verhaltensexperimenten Ratten durch ein Labyrinth laufen liessen, nur selten begriffen hätten, dass die Tiere nicht des Futters oder des Nachwuchses wegen liefen, sondern nur, um zum Ablauf der Fressbewegungen oder des Pflegeverhaltens zu kommen. Es kommt zu Übersprunghandlungen, wenn zwei stark aktivierte Triebe miteinander im Wettstreit liegen oder wenn bei sehr starkem Triebe die Aussensituation nicht hinreicht, um die Endhandlung auszuführen. Auch in der Zweifelssituation zwischen Angriffs- und Fluchtstimmung, kommt es zu Übersprungshandlungen. Instinkte seien voneinander abhängig und hemmten einander. Das sind zwei notwendige Prinzipien, um chaotische Abläufe auszuschliessen. Ob das Gesamtverhalten innerhalb eines Funktionskreises mit seinen mannigfaltigen Teilhandlungen, oder ob auch einzelne Abschnitte derselben Instinkthandlung heissen sollen, kann zu Spezifizierungszwecken diskutiert werden, ohne an der Erkenntnis der Funktionsabläufe und ihrer Organisation grundsätzlich etwas zu ändern.
Beim Menschen sind instinktive Bewegungen und instinktgeprägtes Verhalten am eindeutigsten beim Säugling zu beobachten. Die soziale Einbettung der Einzelwesen ist zwar Voraussetzung der menschlichen Existenz, macht aber die Endhandlungen in der Vielzahl der Anforderungen und der Verschiedenartigkeit der Reizauslöser unsicher. Der Mensch ist ein instinktunsicheres Lebewesen, und einige dieser Mechanismen laufen hinter der Maske der Konventionen larviert ab, was ein Phänomen der Kulturangleichung, der Substition und Umgruppierung ist.
Die Frage nach dem, was den Menschen vor anderen hochentwickelten Säugern auszeichnet, wird gewöhnlich vorschnell damit beantwortet, dass er ja eine Seele habe, Vernunft besitze und wisse, was gut und böse sei. Das sind religiöse Antworten, ohne begründete Argumente und ohne Definitionen der gebrauchten Begriffe. Der biblische Qohèlet (Prediger) sagte jedoch schon: "Der Mensch hat vor dem Tier keinen Vorzug", und begründet das so: "Der Menschenkinder wegen, sie zu prüfen, hat Gott es so gefügt, damit sie sehen, dass sie nicht mehr sind als das Tier. Denn das Geschick der Menschenkinder ist gleich dem Geschick des Tieres; ein Geschick haben sie beide. Wie dieses stirbt, so sterben auch jene, und einen Odem haben sie alle." Offensichtlich aber gibt es Unterschiede der Natürlichkeit zwischen dem Menschen und anderen höheren Säugern. Fühlen, folgern, Erfahrungen nutzen, Anpassungsfähigkeit, Angst, Vergnügen, Spiel und Werkzeugnutzung, Schmuckfreude, Neugier und Vorsicht, all' dieses gibt es auch im aussermenschlichen Tierreich, ebenso wie Intelligenz und Überlebenskunst, wie Verblödung und Ungeschick, wie Lautbildung, Lärm, Melodie und Kakophonie; aber die Fähigkeit, abstrakte Begriffe zu schaffen und in Systemen zu ordnen, die durch Lehre und Unterweisung übertragbar und erhaltbar sind, scheint den aussermenschlichen zerebralen Veranlagungen zu fehlen. Diese Begabung ist offensichtlich menschlich. Damit unterscheidet sich die menschliche Natürlichkeit von derjenigen anderer Kreaturen. Der Traum von einem Zurück zur Natur wird gewöhnlich geträumt wie ein Fernweh, ohne das Ziel dieses "Zurück" zu kennen. Das aber wäre, wie Adolf Portmann in Ascona es in seinem Vortrag "Mythisches in der Naturforschung" formulierte, sein Leben in der Kultur
(Prediger) sagte jedoch schon: "Der Mensch hat vor dem Tier keinen Vorzug", und begründet das so: "Der Menschenkinder wegen, sie zu prüfen, hat Gott es so gefügt, damit sie sehen, dass sie nicht mehr sind als das Tier. Denn das Geschick der Menschenkinder ist gleich dem Geschick des Tieres; ein Geschick haben sie beide. Wie dieses stirbt, so sterben auch jene, und einen Odem haben sie alle." Offensichtlich aber gibt es Unterschiede der Natürlichkeit zwischen dem Menschen und anderen höheren Säugern. Fühlen, folgern, Erfahrungen nutzen, Anpassungsfähigkeit, Angst, Vergnügen, Spiel und Werkzeugnutzung, Schmuckfreude, Neugier und Vorsicht, all' dieses gibt es auch im aussermenschlichen Tierreich, ebenso wie Intelligenz und Überlebenskunst, wie Verblödung und Ungeschick, wie Lautbildung, Lärm, Melodie und Kakophonie; aber die Fähigkeit, abstrakte Begriffe zu schaffen und in Systemen zu ordnen, die durch Lehre und Unterweisung übertragbar und erhaltbar sind, scheint den aussermenschlichen zerebralen Veranlagungen zu fehlen. Diese Begabung ist offensichtlich menschlich. Damit unterscheidet sich die menschliche Natürlichkeit von derjenigen anderer Kreaturen. Der Traum von einem Zurück zur Natur wird gewöhnlich geträumt wie ein Fernweh, ohne das Ziel dieses "Zurück" zu kennen. Das aber wäre, wie Adolf Portmann in Ascona es in seinem Vortrag "Mythisches in der Naturforschung" formulierte, sein Leben in der Kultur .
.
Ausdrucksmittel der Kultur ist die Sprachfähigkeit, ist eben jene Veranlagung, abstrakte Begriffe bilden und in Systemen ordnen zu können. Der Biologe Portmann wörtlich: "Auch in der Grundlegung der menschlichen Welterfahrung gibt es strukturell durch erbliche Isomorphie gegebene Elemente, denen eine zentrale Rolle in der Bildung einer Menschenwelt zukommt. Diesen Elementen wohnt Form inne, sie haben Gestaltcharakter. Das ist das wenige Exakte, was von der biologischen Forschung vorerst zur Kenntnis jener Sphäre beigetragen werden kann, in der die komplexe Psychologie das Reich der Archetypen und einen Ursprung des mythischen Gestaltens annimmt." Ohne Zweifel wäre der Hinweis auf das dynamische Kommunikationsmittel Sprache, das die vereinzelten Menschen zu übergeordneten Einheiten des Menschseins verbindet, konkreter ausgefallen, als die Berührung des Bereichs der Archetypenlehre; aber das war ja nicht das seinerzeitige Tagesthema.
Sprachen sind nicht angeboren. Sie entstehen und verfallen, sind Kulturgut und es gibt deren so viele, wie Kulturvarianten denkbar sind. Angeboren ist jedoch die Befähigung zur Sprachbildung, und zwar überall, wo Sprachen entstehen und bestehen können. Sie dienen der Kommunikation, innerhalb grösserer Funktionseinheiten . Die Anlage zur Sprachschöpfung hat eine als solche erkennbare Struktur, eben die Grammatik, die der Lautbildung Ordnung verleiht und damit Sinn gibt. Ohne eine definierbare Anlage entsteht nicht, was wir als Kultur erkennen könnten. Solche Veranlagungen bilden auch das Gerüst für ihre Entwicklung und deren Ausdruck. Sie gehören somit zum Mutterboden der Psyche. Hypothesen, die diese Vorbedingung zu jedweder Psychogestalt ausschliessen, sind wie Seifenblasen, die wohl schillern mögen bevor sie platzen, aber nichts anderes darstellen als umhüllte Luft.
. Die Anlage zur Sprachschöpfung hat eine als solche erkennbare Struktur, eben die Grammatik, die der Lautbildung Ordnung verleiht und damit Sinn gibt. Ohne eine definierbare Anlage entsteht nicht, was wir als Kultur erkennen könnten. Solche Veranlagungen bilden auch das Gerüst für ihre Entwicklung und deren Ausdruck. Sie gehören somit zum Mutterboden der Psyche. Hypothesen, die diese Vorbedingung zu jedweder Psychogestalt ausschliessen, sind wie Seifenblasen, die wohl schillern mögen bevor sie platzen, aber nichts anderes darstellen als umhüllte Luft.
Dafür, dass Sprachen von der Grundstruktur einer spezifisch menschlichen Psychonatur zeugen, lassen sich konkrete Belege sammeln. Es ist nicht nur die Anatomie des Rachenraumes, die sprechen erst ermöglicht, sondern auch ein zerebrales System, dem eine solche Morphologie von Nutzen ist. Wir verbinden gewöhnlich ethnische Kennzeichen mit bestimmten Sprachen, obwohl offenbar ist, dass Menschen jedwelcher Ethnie jede Sprache lernen und gebrauchen können. Nicht der Wortschatz macht die Sprache aus, sondern die Ordnung, die einzelne Wörter sinnvoll untereinander in Beziehung setzt. Die Frage: "Woher kommt eine bestimmte Sprache in ein ebenso bestimmtes Gebiet?", ist nicht mit der blossen Vermutung von Einwanderungen zu beantworten. Das hat Cornelia Isler-Kerényi (anhand der Ausstellungen über die Etrusker in Venedig und Bologna
(anhand der Ausstellungen über die Etrusker in Venedig und Bologna ) erfrischend und überzeugend dargestellt. Sie weist nach, dass die Entstehung urbaner Zentren mit der Hierarchisierung der Gemeinschaften einhergeht. Hierarchien sind immer Inkreis-Auskreis-Gliederungen. Die Archeologin antwortet auf die Frage, woher denn die Etrusker gekommen sein mögen mit der Weiterung, woher denn die Italiener oder Schweizer gekommen seien, und erklärt dann plausibel, dass es Etrusker oder jede andere Ethnie von dem Momente an gegeben habe, als sie sich als solche fühlten, sich also als eine eigene Identität wahrnahmen und darstellten. Es sind historische Prozesse, die zur Gestalt von Nationen führen, und davon nicht unbedingt nur die Invasionen und Unterwerfungen, sondern eher noch die Ansprüche und deren Befriedigung, die sich Menschen erlauben können. Es wäre falsch, diese Erkenntnis nur auf den sogenannten Luxus zu beziehen. So ergeben sich auch offensichtliche Einflüsse aus anderen Regionen, weil zum Beispiel entwickelte autochthone Bedingungen es ermöglichen, exotische Gerätschaften und Kunst zur eigenen Freude und Nutzen, wie auch zur Selbstdarstellung zu gebrauchen. Sprachen sind Mittel der Verständigung, der Wechselwirkung, des Austauschs, der Kulturdominanz und des Machtbeweises. Sie unterliegen dem Naturgesetz von Entwicklung und Verfall und stellen dieselben durch ihren Zustand dar. Selbstbewusstsein drückt sich lebendig im Sprachgebrauch und in der Sprachdisziplin aus, kann edel wie auch morbid sein, und diese Qualitäten sind am Niveau der Sprachpflege erkennbar.
) erfrischend und überzeugend dargestellt. Sie weist nach, dass die Entstehung urbaner Zentren mit der Hierarchisierung der Gemeinschaften einhergeht. Hierarchien sind immer Inkreis-Auskreis-Gliederungen. Die Archeologin antwortet auf die Frage, woher denn die Etrusker gekommen sein mögen mit der Weiterung, woher denn die Italiener oder Schweizer gekommen seien, und erklärt dann plausibel, dass es Etrusker oder jede andere Ethnie von dem Momente an gegeben habe, als sie sich als solche fühlten, sich also als eine eigene Identität wahrnahmen und darstellten. Es sind historische Prozesse, die zur Gestalt von Nationen führen, und davon nicht unbedingt nur die Invasionen und Unterwerfungen, sondern eher noch die Ansprüche und deren Befriedigung, die sich Menschen erlauben können. Es wäre falsch, diese Erkenntnis nur auf den sogenannten Luxus zu beziehen. So ergeben sich auch offensichtliche Einflüsse aus anderen Regionen, weil zum Beispiel entwickelte autochthone Bedingungen es ermöglichen, exotische Gerätschaften und Kunst zur eigenen Freude und Nutzen, wie auch zur Selbstdarstellung zu gebrauchen. Sprachen sind Mittel der Verständigung, der Wechselwirkung, des Austauschs, der Kulturdominanz und des Machtbeweises. Sie unterliegen dem Naturgesetz von Entwicklung und Verfall und stellen dieselben durch ihren Zustand dar. Selbstbewusstsein drückt sich lebendig im Sprachgebrauch und in der Sprachdisziplin aus, kann edel wie auch morbid sein, und diese Qualitäten sind am Niveau der Sprachpflege erkennbar.
So trägt Frau Isler-Kerényi auch eine Reflexion zur Sprachgeschichte bei und bemerkt, dass in der indoeuropäischen Sprachenflut der Bronzezeit die archaischen Lemnier und Etrusker sich ausnehmen wie die Spitzen altmediterraner Eisberge. Allein dies wäre schon Grund genug, eingehender zu erforschen, welche Bedeutung die Sprachentwicklung in der langen Geschichte unseres Kontinents hat. Archaische, auch rudimentäre Beschriftungen, wie die etruskischen, sind kostbare Quellen, die trotz ihres ehrwürdigen Alters, eine insgesamt noch junge europäische Kultur bezeugen, deren Wechselfälle wir doch gern durchschauen möchten, um ihre inhärenten Funktionsgesetze zu begreifen, um eine reelle Sozialpsychologie entwickeln zu können.
TOCBabylonische Verwirrung
Die babylonische Verwirrung beginnt mit der Sprachschlamperei der Begriffsverfremdung. Für einige Reklamekünstler mag das der Inbegriff höchster Sprachkunst sein, die anfänglich, wegen der Perplexität der Angesprochenen, Erfolg hat; doch wenn diese Verfremdungen dann zum Umgangsslang werden, dann geht das zulasten einer verständlichen Kommunikation. "Ich entschuldige mich", ist so ein sprachschlampiges Unding. Wenn eine Politfigur vom Podium herab beispielsweise "sich" entschuldigt, legt sie Zeugnis ihres Baunausentums ab, weil sie nicht um Entschuldigung bittet. Sie gibt vor, selbst zu besorgen, was sie selbst nicht besorgen kann, denn dieses Bitten enthält das Schuldbekenntnis und den notwendigen Bussgang zur Entschuldigung, die nur Leidbetroffene gewähren können. Eine Person die, in angemasster Stellvertretung, sich selbst für angebliche Vergehen anderer entschuldigt, betreibt ein Übermass an Selbstbespiegelung mit solchem intriganten Diffamierungsspiel. Eine Politfigur höchsten Ranges die "sich selbst" entschuldigt, nimmt uns gar die Möglichkeit, ihr ihren Ausrutscher zu verzeihen.
Alles Forschen nimmt mit Fragen seinen Anfang, und jede Frage enthält bereits die Spur ihrer Antwort, auf die sie ausgerichtet ist. Wer Antworten gibt, ohne befragt worden zu sein und ohne gefragt zu haben, versteht die eigene Logorrhoe nicht. Das braucht er auch nicht, denn er schmeichelt sich selbst mit seinem blossen Lautgeben, macht Stimmung und gibt Stimmung wider. Sprachschlampereien sind solche logorrhoeischen Selbstbefriedigungen coram pubblico. Beim Tingeltangel des Varietés gehört das zur Massenlustbarkeit. In der Politik wird das zur Gefahr des Ausbruchs einer Massenpsychose, die leicht zu einem Blutbad führen kann.
Sprache kann also auch ohne Sinninhalt Wirkung haben, enthält Emotionen und drückt Emotion aus. Sprachzerfall sollte Aufmerksamkeit wecken, denn er ist ein untrügliches Alarmsignal für den eintretenden Kulturzerfall. Das ist bereits durch biblische Weisheit überliefert. Die Genesis berichtet, wie Menschen einer Sprache gemeinsam Grosses leisten, und wie mit ungebildetem Sprachgebrauch auch das Grosse einer Kultur zerfällt. "Es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und sie haben sich vorgenommen das (den Turmbau) zu tun; sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben. Wohlauf, so lasset uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass keiner des andern Sprache verstehe, sprach der Herr. Also zerstreute er sie von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten ihre Stadt zu bauen" . So steht es im 1. Buch Moses. Es ist die Rede von einer einheitlichen Vielfalt wie einer vielfältigen Einheit, welche die Voraussetzung zur hochkulturellen Leistung ist.
. So steht es im 1. Buch Moses. Es ist die Rede von einer einheitlichen Vielfalt wie einer vielfältigen Einheit, welche die Voraussetzung zur hochkulturellen Leistung ist.
Das Grundgerüst der Sinnfälligkeit von Lautmodulationen ist einerseits durch den Standort, von dem ein Signal ausgeht gegeben, und andrerseits vom umgebenden Bereich, als dem Ziel des Signals, also durch rufen und hören. Der Rufer (Sender) ist singular, die Umgebung hingegen mehrfach, also plural. Es gibt zudem den Sonderfall des singulären Senders zum singulären Empfänger, einen Plural, der Sender und Empfänger in Wechselwirkung als eine exklusive Einheit, gewissermassen als einen Intimplural, also als Paar erfasst. Er betrifft Personen und Sachen. Ein Paar Hosen, ein Paar Socken und dergleichen, sowie ein Liebespaar, ein Brautpaar, ein Ehepaar und ein Gespann, weisen einen spezifisch bedingten Plural aus. In der Naturvorlage haben wir es also mit einem dreifach gegliederten Numerus zu tun, dem Singular, dem Dualis und dem Plural.
Ein Paar Hosen sind etwas anderes, als das eine Paar unter den paar (wenigen) anderen. Im ungepflegten Sprachgebrauch sieht der Banause sich schon mit einer Hose bekleidet, das heisst mit nur einer Beinröhre, während doch die Kleidung aus zwei Beinröhren, also einem Paar Hosen bestehen sollte.
Gemeine Unbildung führt zur Begriffsverfremdung. Hat ein Treuhänder sein Bestes getan, um ein Vermögen zu erhalten und zu mehren, so hat er es sicher nicht bekommen, wenn er dies redlich für seinen Auftraggeber tat. Falls ein Kunstmäzen und Sammler seine Kostbarkeiten einer Stiftung anvertraut, auf dass das Kulturgut erhalten bleibe, so hat es niemand bekommen, um es zu verschleudern. Dennoch hat das Verb erhalten einen unrühmlichen Platz in der Umgangssprache, indem alle Welt erklärt zu erhalten, wenn lediglich bekommen gemeint ist. Erhalten ist gleich dem lateinischen MANU TENERE = mit Händen halten und bedeutet die Erhaltung des Zustandes einer Sache, und auch für den Fortgang einer Funktion sorgen, wie auch durch Leistung für den Qualitätserhalt des Eigenwertes sorgen. Also keine Rede von bekommen um es zu besitzen und gegebenenfalls zu verschlingen oder abzuführen. Erhaltung heisst Bewahrung, und schliesslich gibt es auch den Erhaltungstrieb, der den eigentlichen Sinn des Verbs erhalten veranschaulicht. Der Nebensinn des Verbs erhalten, als Wertübertragung (bekommen), ist an die Bewahrung des Wertes, den es zu erhalten gilt, gebunden. Was wir an Kultur mitbekommen haben, sollten wir erhalten und nicht verkommen lassen. (Im etymologischen Duden 1963 fehlt das Kapitel).
Präfixe verführen, besonders im Verbund mit Fremdwörtern, zu sprachlichem Unsinn. So scheint die unedle Abkunft des Adjektivs "unterprivilegiert" kein Anlass zu sein, seine Sinnfälligkeit zu prüfen. Es ist fester Bestandteil der Umgangssprache, um nicht benachteiligt oder vernachlässigt sagen zu müssen, wo es angebracht wäre. Ursprünglich weckten wohl die Vorteile Aufmerksamkeit und Begehren bei jenen, die keine hatten, und so an ihrer Benachteiligung litten. Wenn Sprache zur oralen Ausscheidung verkommt, sind einige eingeschobene oder weggelassene Vokale und Konsonanten blosses Füllgut. Einsilbige Vorsilben wachsen sich zu zweisilbigen Ungeheuern aus, wenn sie damit mundgerechter werden. Das "un" (nicht) von unprivilegiert wird zum "unter", quasi als Offenbarung unterentwickelter Sprachkenntnis. Wer besinnt sich, munter plaudernd schon darauf, dass das lateinische PRIVILEGIUM ein Sonderrecht, ein Vorrecht ist, und demgemäss ein Unterprivileg noch immer ein Vorrecht und Sonderrecht (wenn auch minderen Ausmasses) bliebe. Klar und deutlich wäre die Aussage, wenn Benachteiligungen auch so benannt würden. Wer nicht über Vorrechte verfügt, kann vergleichsweise übel benachteiligt sein.
Eine Beiläufigkeit, wie der inflationäre Missbrauch der Vorsilbe "ab", verziert nicht nur "sinken", sondern auch "decken", so dass der Abdecker nicht mehr weiss, was seines Waltens ist. Soll er nun dem Kadaver die Decke (das Fell) abziehen oder ihn bedecken? Jede Person weiss, dass sie frieren wird, wenn sie sich abdeckt. Auf dem frisch montierten Elektroheizgerät steht warnend: "nicht abdecken!" Wird es jedoch bedeckt gelassen, entsteht höchste Brandgefahr; und dennoch deckt männiglich ab, wenn bedecken, zudecken, eindecken oder schlichtweg decken gemeint ist. Dass sich jemand bedeckt, und nicht etwa abgedeckt hält, lässt sich am ehesten noch in einem seriösen Wirtschaftsbericht lesen, beispielsweise in der NZZ . Die Abgedeckten sind nämlich schon deshalb nackt und bloss, weil ihnen der Sinn für die Verbindlichkeit des Wortes fehlt.
. Die Abgedeckten sind nämlich schon deshalb nackt und bloss, weil ihnen der Sinn für die Verbindlichkeit des Wortes fehlt.
Reich oder arm, das ist stets die Frage. Bereichern ist möglich, verarmen auch; aber abreichern und abgereichert sein, würde mindestens von maroder Sprachkultur zeugen.
Abgereichert ist der undeutschsprachige Wechselbalg, dessen Erzeuger zum Akt entweder von luetischer Verblödung oder von bösartiger Dialektik getrieben waren. Ihr Adjektiv abgereichert soll vermindert, herabgesetzt oder verarmt ersetzen. Es ging zwar um den mit strahlungsarmem Uran gehärteten Kern eines panzerbrechenden Geschosses, aber abgereichert ist offenbar klassenbewusster! Ein Kleinbauer wird nun wohl nicht mehr an Einkommen verarmen, sondern als abgereicherter Kulak entlarvt werden, denn er besitzt ja noch die letzte Kuh, die ihm erhalten blieb.
Etymologisch hat das gemeingermanische Wort "ab" seine Entsprechungen in vielen indogermanischen Sprachen, wie im adh. aba, got. af, engl. of,
schwed. av. lat. ab, idg. und gr. apo. Es meint Abstand, weg von, jedenfalls das direkte Gegenteil von Körpernähe. Als Präfix bestimmt es auch das Adjektiv aphoristisch (gr. aph-orismòs = Abgrenzung, Bestimmung) in der Bedeutung von prägnant und geistreich, wovon bei seinem allgemeinsprachlichen Missbrauch rein gar nichts vorhanden ist.
Eine seltsame Vorliebe hat der allgemeine Sprachgebrauch für das Beinhalten. Jede Sprachwendung kann klare oder auch verdeckte Mitteilungen enthalten. Warum sie stattdessen diese bein-halten muss, sollte das etwa mit der Vorstellung von wonniglichen Verheissungen zusammenhängen?
Schlagworte, die verkürzt vermeintlich wichtige Informationen vermitteln, sind Verdrehungen. Die eigentliche Quelle dazu bilden die Stichworte die, quasi als Schlüssel, eine Reihe engrammierter Informationen erschliessen; aber die verkürzte Form wird missbraucht, um verfrühte oder verdrehte Folgerungen mit ihren Schlagworten einzuleiten. Es ist ein Werkzeug der Demagogie, womit auch politische Indoktrinierung betrieben wird, wie mit der Entfremdung der Begriffe von ihrem eigentlichen Inhalt. So entstehen verwirrende Regelungen, wie die amtlich eingeführte Verwechslung von Genus und Sexus im offiziellen Sprachgebrauch, gipfelnd im blödsinnigen grossen "I" inmitten eines geschriebenen Wortes.
Die Neue Zürcher Zeitung bemerkte einst: "Das deutsche Wort "Rechtschreibung" scheint zu bedeuten, dass man in unserer Sprache den grausigsten Unsinn schreiben kann – wenn nur die Buchstaben stimmen."
bemerkte einst: "Das deutsche Wort "Rechtschreibung" scheint zu bedeuten, dass man in unserer Sprache den grausigsten Unsinn schreiben kann – wenn nur die Buchstaben stimmen."
Deutsch ist mitten in Europa angesiedelt in enger Berührung mit vielen, unterschiedlichen Sprachen. Sie ist eine der wortreichsten, weil sie schon immer Wörter aus ihrer Nachbarschaft aufgenommen hat. Das ist kein Problem, insofern damit die Nachbarkontakte erleichtert werden, und dies geschieht bei angemessen diszipliniertem Gebrauch. Schwierig wird es allerdings bei Sinnverdrehungen von Fremdwörtern und verfälschten Begriffen.
Mit neuen Reglementationen werden ideologische Inkreise geschaffen. Aus einer solchen "neuen" Identität der "Gutgesinnten" werden all jene in den Auskreis verdammt, die der political correctness nicht Folge leisten. Es wird die Gesinnungkonformität diktiert, die am Sprachgebrauch gemessen und kontrolliert werden kann. Die Umgangssprache ist damit politisch infiziert.
Dazu vermittelt Paul Ehinger mit seiner Schrift "Herrschaft durch Sprache" ein beeindruckendes Quellenregister, das unsere hier vertretenen Thesen umfänglich sichert.
mit seiner Schrift "Herrschaft durch Sprache" ein beeindruckendes Quellenregister, das unsere hier vertretenen Thesen umfänglich sichert.
Die offizielle Schweiz, mit ihren regional durchaus vielfältigen, jedoch in der Befolgung der political correctness weitgehend gleichgeschaltet konformen Presse wie der elektronischen Medien, hat es im letzten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts, suggestiv einhämmernd fertiggebracht, in gekonnter Manier der marxistischen Dialektik, Begriffe wie "einschliessen" und "anschliessen" in "öffnen" zu verfälschen.
Wörter bilden Gespinste, mit denen, angemessen zugeschneidert, Vorgänge bemäntelt werden. Annektion und Anschluss kannten wir schon, aber Anöffnung dürfte neuwertig sein. Der Schweizerische Souverän, das Volk, wusste am 4. März 2001 indessen noch die Gegensätzlichkeit von öffnen oder (an)schliessen zu unterscheiden . Am 3. März 2002 hatte sich die Begriffsmetamorphose öffnen für schliessen, freilich für eine andere Vorlage, durchgesetzt. Die Initiative für den Einschluss in die Weltorganisation UNO wurde mit 54,6 % Ja, gegen 45,4 % Nein, mit dem Ständemehr von 12 zu 11 Kantonen angenommen
. Am 3. März 2002 hatte sich die Begriffsmetamorphose öffnen für schliessen, freilich für eine andere Vorlage, durchgesetzt. Die Initiative für den Einschluss in die Weltorganisation UNO wurde mit 54,6 % Ja, gegen 45,4 % Nein, mit dem Ständemehr von 12 zu 11 Kantonen angenommen .
.
Die Diskussion wird hier, stellvertretend für alle Sprachen (zumindest den indoeuropäischen), auf deutsch geführt. Das psychosoziale Funktionsprinzip ist Matrix (Mutterboden) jeder Sprache als psychodynamische Erscheinung. Die individuell empfundene soziale Identität, dieses Teilhaben am internen Kreis von seinesgleichen, ist nicht durch die selbe Haut- Haar- und Augenfarbe, ja nicht einmal durch die gemeinsame Sprache bestimmt, sondern vielmehr durch die Art und Weise des Umgangs damit, wie auch durch die Wahl von Vorlieben und die Gemeinsamkeiten der Wertpflege. So wird eine Sprache erst dann zu einer Gemeinsamkeit, wenn sie in gleichwertiger Sorgfalt geübt wird. Es ist einfacher, sich mit einer fremdsprachigen Person zu verständigen, als mit Benützern eines ähnlichen Vokabulariums, die nicht die Grundregeln zu dessen Gebrauch einhalten, sei es, dass sie dessen nicht fähig sind oder dass sie den schlampigen Umgang damit für reizvoll halten. Die Verständigung wird schon mühsam, wenn die Umstandsbestimmungen missachtet werden. Ob Zeit, Ort oder Art und Weise, das sollte aus der rechten Wahl des entsprechenden fragenden Fürwortes hervorgehen. Die Kasusformen der Deklination ergeben einen zweifelsfreien Sinn nur bei sachgerechter Anwendung; doch solche Feinheiten sind dem Unbedarften fremd. Der Zeitwortschatz, das heisst die Kenntnis vieler, spezifischer Verben, die eine treffende Auswahl erlaubt, und die Konjugation, bestimmen das Niveau der Sprachpflege auf der Skala vom Simpel, bis hinauf zum Sprachästheten. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gesprächspartner Blutsverwandte oder Zufallsbekannte sind. Der engere soziale Inkreis umfasst die Kulturgemeinschaft der sittlich gleichermassen Anspruchsvollen. Es ist die sinnbestimmte Ethik, die über die Identität des sozialen Wohlbefindens entscheidet.
Diese Hinweise sind Beispiele, die für die gesamte Grammatik und Syntax stehen, als dem Gesetz, das der Sprache sinnfällig innewohnt. Vokabeln allein verraten nicht mehr als trällern und lallen. Sie werden erst durch eine grammatische Ordnung brauchbar.
Die Orthographie ist eine untergeordnete Kategorie und spielt im oralen Sprachgebrauch eine sekundierende Rolle. Sie ist ein Nachvollzug der Sprechweise und hat diesen Dienst so getreu wie nur möglich zu leisten, indem sie vor allem sprechbar sein muss. Preisfrage: Wie wird eine Majuskel (z.B. I statt i) inmitten eines geschriebenen Wortes sprechbar?
Ein eigenes Thema bilden die Geheimcodices, also die exklusiv für "Eingeweihte" reservierten Vokabularien, der in Karrierestufen angeordneten Grade religiöser Sekten und politisierender Zirkel. Solche Organisationen zeichnen sich durch ihre elitäre Geschlossenheit aus. Sie funktionieren diszipliniert nach dem Inkreis- Auskreisprinzip. Die sprachliche Einweihung ist dann mit verliehenen Titeln und Insignen verbunden und gebraucht codierte Mitteilungen, verstärkt durch "geheimnisvolle" Symbole und Rituale. Das Funktionsprinzip ist immer gleich, wie es die mililtärische Organisation am sichtbarsten offenbart. Bekannt durch diesbezügliche Geheimnistuerei sind beispielsweise die Freimaurerlogen, die Scientology-Kirche, die "Geheimlehre" der Anthroposophen wie der "Christian Science", und die "Brüder des Rosenkreuzes", wie auch Wahnsinnsformen, die durch spektakuläre Rituale der Endzeitpanik (Gruppensuizid) posthum von sich reden machen, wie das Drama der Sonnentemplersekte 1994/95 .
.
Die faszinierende Tatsache, dass alle Sprachen untereinander übersetzbar sind besagt, dass es gemeinsame Gesetzmässigkeiten dieser Sprachen gibt. Ferner werden spezifische Verwandtschaften innerhalb einzelner Sprachfamilien deutlich. Uns Europäer verbindet die Verwandtschaft der indoeuropäischen Sprachfamilien, zu denen auch aussereuropäische Sprachen, wie beispielsweise Urdu, Hindi und Persisch zählen, ja, unter Philologen gilt Indien als die geographische Wiege der arischen = indogermanischen Sprachen. In die europäische Völkerfamilie gehören auch einige Turksprachen, sowie semitische Abkömmlinge, auf deren letztere eine bedeutende Kulturakzentuierung des Abendlandes beruht. Besonderes Gewicht haben die mosaischen Sittengesetze, die das Fundament der europäischen Ethik noch heute bilden, trotz der Aufweichung einzelner Gebote, die unter anderem durch chemisch-technische Entwicklungen gefördert worden ist. Hierzu zählt die Unterhöhlung der Moral der ehelichen Treue und des vorehelichen Sexualverhaltens mittels der Möglichkeit der Schwangerschaftsverhütung.
Die Sprache ist nicht das einzige Verständigungsmittel zwischen Individuen und grösseren Identitätseinheiten und deren Weiterungen. Gewöhnlich ist Sprache von Mimik und Gestik begleitet und akzentuiert. Widersprechen sich diese verschiedenen Ausdrucksmittel innerhalb einer Mitteilung, dann entsteht ein besonderer Reiz, mit der Unsicherheit einer gültigen Deutung. Dieser Reiz kann, je nach der ursächlichen Gemütslage involvierter Naturen, zu Erheiterung, Perplexität, Irritation, Ärger, Wut wie auch Raptus führen. Das Provozierende der Verfremdung im Mitteilungsmittel wird bewusst bei Bühnenanekdoten, Stimmungsmache und zu demagogischen Zwecken genutzt.
Sprache drückt dasjenige aus, was über der Physik der Dinge steht. Sprache erklärt Unsichtbares, Unhörbares, Unschmeckbares, Untastbares aber dennoch Fühlbares und Empfindbares, Beängstigendes, Erfreuendes, ist trauern und jauchzen, Sprache ist also der Vermittler von Bedürfnissen und Gefühlen, von Impulsen und der Stimmungen, des Edlen wie des Niederträchtigen. All' diese Eigenheiten sind die Elemente, auf die sich Verbalisation, Lautmalerei, Aufschrei wie auch Melodie beziehen. Wenn Einheit aus Vielheit besteht, dann gilt der Satz auch in seiner Umkehrung so, dass Sprachen auf einen gemeinsamen Nenner zurückgeführt werden können, und dass der gemeinsame Nenner sich in Vielheit zergliedern lässt. Die Sprache als Phänomen hat Gestalt aus Laut und Struktur, und ebendiese Sprachstruktur macht übermittelte Signale erst zu verständlichen Botschaften. Sie bezieht sich auf das in anderer Weise nicht Aufzeigbare und vermeldet auch den persönlichen Eigenwert.
Die Matrix des Eigenwertes ist die Identität in der Intimität. Derartige Empfindungen sind durch Schamgefühle geschützt. Man schämt sich seiner selbst und trügt sich in ein konformes Korsett des Wohlbetragens innerhalb der Grenzen seiner sozialen Bindungen. Und gerade dies weist auf die Struktur des Eigenwertgefühls, welches vom Netz der Sozialbindungen getragen ist. Eine schöne, wenn auch ironische Illustration zum Thema, gibt das Musical von A.J. Lerner "My Fair Lady" , das auf G.B. Shaw's Pygmalion
, das auf G.B. Shaw's Pygmalion fusst, in einer sehr gelungenen, deutschsprachigen Version. Mit beschwingter Leichtigkeit bringt es eine Kulturanalyse des Sprachgebrauchs vor ein Publikum, das Zerstreuung sucht und, selbst ohne es zu wollen oder zu ahnen, unterschwellige Unterrichtung findet. Die leichte Muse ist oft nicht so leicht, wie sie genommen wird.
fusst, in einer sehr gelungenen, deutschsprachigen Version. Mit beschwingter Leichtigkeit bringt es eine Kulturanalyse des Sprachgebrauchs vor ein Publikum, das Zerstreuung sucht und, selbst ohne es zu wollen oder zu ahnen, unterschwellige Unterrichtung findet. Die leichte Muse ist oft nicht so leicht, wie sie genommen wird.
Jedes singuläre Ich ist im Sozial-Ich eingebettet, wie ein Dotter im Ei. Die Struktur dieses Wechselspiels im sozialen Beziehungsnetz, ist im Aufbau der Personalpronomina auch sprachlich gegeben. Ich wird fassbar in seiner Beziehung zum Du und stellt so die Zelle dar, welche zwar die Singularität zeichnet, aber dieselbe gleichzeitig in den Plural, in das Wir überführt. Das Wir ist jedoch bereits dehnbar, je nach den Geltungsbereichen jeglicher, auch sektorieller Gemeinsamkeit. Das Wir steht dem Ihr gegenüber, das aus der direkten Polarisierung alle anderen ausgrenzt. Diese inneren Grenzen der Bindungskreise sind durch latente bis akute Erfahrungen gezeichnet, weil sie mit den Intimgefühlen identisch sind.
So kommt es, dass ein Wirgefühl als verstärktes Ichgefühl auftritt, was durch jede Massenbewegung sichtbar wird. Massenpsychosen sind Extremerscheinungen dieser Struktur der Identität. Wir erfahren uns an den Grenzen unserer vermeintlichen Einzigartigkeit, und jede Grenze ist auch eine Verteidigungslinie. Es ist eine normale Funktion, andere immer dann als auswärtig bzw. als nicht zugehörig zu sehen, wenn es um einen Standpunkt geht, der gleichsam als Territorium des sozialen Inkreises und seiner Funktionen empfunden wird. Die Struktur der Identität lässt sich also leicht graphisch in konzentrischen Kreisen veranschaulichen. Wir gehen davon aus, dass es sich um eine syntaktische Universalie handelt. Systematische Untersuchungen dazu stehen jedoch noch aus.
veranschaulichen. Wir gehen davon aus, dass es sich um eine syntaktische Universalie handelt. Systematische Untersuchungen dazu stehen jedoch noch aus.
Es war von "innerer Bedeutung", wenn eine Durchlaucht den Majestätsplural (Inkreis) im direkten Kontakt mit Untergeordneten anwandte, indem sie (die Durchlaucht) solche mit der dritten Person singular (Auskreis) bedachte.
Den Gegensatz dazu bildet der Bescheidenheitsplural, wenn die Kontaktperson in den Inkreis des Sprachführenden als gleichwertig einbezogen wird. Auch die Höflichkeitsform dritte Person plural bezeichnet den Abstand zwischen Inkreis und Auskreis, durch den es keine direkte (eventuell feindliche) Berührung gibt, der aber dem Gegenüber den Plural, des als bedeutungsvoll Gewichteten, zuerkennt. Ortsspezifisch anders ist die traditionelle Höflichkeitssituation im Idiom des oberen Aaregebietes des Aargaus, Solothurns und des Bernbiets. Hier gilt die zweite Person plural in der Anrede, als der Person des nahen Auskreises, mit der eine "Begegnung", gewissermassen als ein Akt der Sozialisierung, stattfindet. Grenzen sind Verteidigungslinien, die zur Ausdehung reizen, falls Artfremde in den eigenen Identitätskreis, aus welchen Gründen auch immer, nicht einbezogen werden können. Die zentripetalen Kräfte des Selbstwertanspruchs verlangen das Bekenntnis der Zugehörigkeit. Wer ein solches nicht erbringt, wird ausgegrenzt. Inkreis und Auskreis der Kollektivdynamik können so ständig sichtbar gehalten werden. Ein sozialer Inkreis scheint auch erst dann dauerhaft zu sein, wenn er durch Ausgrenzungen Einzelner seine Gültigkeit im eigenen Geltungsbereich beweisen kann. Ausgrenzungen verstärken zudem die inneren Bindungen jedes Sozialkreises. Die zahmste und gängigste Methode der Einvernahme anderer, ist die Missionierung durch Überzeugungsarbeit, die bei einem Misserfolg jedoch leicht in offene Agressionen umschlägt, das heisst zwangsläufig progrediert, denn es handelt sich um die naturgesetzliche Platzbehauptung als einer Funktion der Lebenstüchtigkeit. Die ja zu erwartende Durchbrechung der Vernunftkontrolle seitens der latent aktionsbereiten Triebkräfte (Es versus Ich) des Sozial-Es, erstaunt nicht so sehr wie die Illusion, dass dieses Instinktpotential aus demselben Leben verschwinden könnte, das es darstellt. Es ist sinnlos zu meinen, der Mensch sei selbstlos, anstatt damit zu rechnen, dass der Selbsterhaltungstrieb auf mannigfache Weise sein Recht einfordert, und besonders dann eruptiv auszubrechen pflegt, wenn er für lange Zeit negiert wurde. Das Selbst hat auch eine kollektive Dimension in Ausdehnungskreisen, die mit den Identifikationsbereichen deckungsgleich sind. Familieninteressen, Berufs- und Standesansprüche, Herkunfts- und Territorialrechte, ererbte und erworbene Vorrechte, Sippenstolz und Kulturanmassung, ethnische Ueberheblichkeit und kirchturmpolitische Vorteile, Sprachgemeinschaft und Nationalstolz, können solche scharf abgegrenzte Identifikationsbereiche sein. Sie haben immer eine zentripetale Verankerung bei zentrifugaler Aktivität.
hat auch eine kollektive Dimension in Ausdehnungskreisen, die mit den Identifikationsbereichen deckungsgleich sind. Familieninteressen, Berufs- und Standesansprüche, Herkunfts- und Territorialrechte, ererbte und erworbene Vorrechte, Sippenstolz und Kulturanmassung, ethnische Ueberheblichkeit und kirchturmpolitische Vorteile, Sprachgemeinschaft und Nationalstolz, können solche scharf abgegrenzte Identifikationsbereiche sein. Sie haben immer eine zentripetale Verankerung bei zentrifugaler Aktivität.
Die naturgegebenen Merkmale dieser Dynamik sind durch das auf ein Du ausgerichtete Ich gegeben, welche zusammen eine Familie gründen und gemeinsam auch in ihren Sippen verwurzelt sind. Die Sippen gehören zu einem Stamm, und der Stamm zu einem Volk. Die Völker verstehen sich als Nationen, wozu sich unterschiedliche Kulturen zusammenfinden können, sofern sie ein für alle Beteiligten gleichermassen gültiges Bindungsmotiv haben.
Diese Kreisanordung sehen wir auch in der funktionsgerechten Architektur, zum Beispiel beim Sitzungssaal des Weltsicherheitsrates der UNO, wo es zu einem inneren und einem äusseren noch einen äussersten Kreis der Mitglieder und den Auskreis für Beobachter gibt. Die Anordnung entspricht der Funktion. Es sind alle gleich, aber je mehr beim Zentrum, umso gleicher sind sie, am gleichesten sind sich die ständigen Mitglieder des Rates. Niemanden scheint dieses grammatische Unding ungleicher Gleichheit zu stören, weil es ohne Steigerung und Gefälle keine Ordnung gibt, um die es ja geht, und nicht etwa um Gleichheit. Das einigende Motiv für alle ist die
UNO-Charta (so lange man an sie glaubt). In der hohen Zeit des grössten Vertrauens in diese Organisation, kann sie sich die unsinnigsten Anordungen und Erklärungen leisten. Sie lassen sich durchsetzen wie Wasser für Wein bei der Hochzeit zu Kana . Selbst Verbote für unerlaubte Meinungen werden weltweit verbindlich, bei gleichzeitiger Behauptung des Rechts auf freie Meinungsäusserung. Menschenrechte werden erklärt und genommen, wie Launen der Natur. Wer es wagt, etwas anderes zu denken, muss den Bannstrahl der Organisation fürchten, solange sie mächtig genug ist, eine Meinung verbindlich vorschreiben zu können. Macht hat aber die Tendenz, selbsttätig zu werden, sich durchzusetzen, selbst wenn Mitglieder des inneren Entscheidungskreises in den Auskreis (Ausstand) treten. Wenn ein Teil der Organisation nicht mitprügeln mag, wird trotzdem geprügelt durch den, der den Prügel in der Hand hat. Dann schadet nicht einmal eine Umkehrung der Symbolik der Funktion, wenn zum Beispiel ein Phallus als drohender Prügel, statt eines Prügels als Phallus gezeigt wird. Wie anders wäre sonst die Penisexhibition
. Selbst Verbote für unerlaubte Meinungen werden weltweit verbindlich, bei gleichzeitiger Behauptung des Rechts auf freie Meinungsäusserung. Menschenrechte werden erklärt und genommen, wie Launen der Natur. Wer es wagt, etwas anderes zu denken, muss den Bannstrahl der Organisation fürchten, solange sie mächtig genug ist, eine Meinung verbindlich vorschreiben zu können. Macht hat aber die Tendenz, selbsttätig zu werden, sich durchzusetzen, selbst wenn Mitglieder des inneren Entscheidungskreises in den Auskreis (Ausstand) treten. Wenn ein Teil der Organisation nicht mitprügeln mag, wird trotzdem geprügelt durch den, der den Prügel in der Hand hat. Dann schadet nicht einmal eine Umkehrung der Symbolik der Funktion, wenn zum Beispiel ein Phallus als drohender Prügel, statt eines Prügels als Phallus gezeigt wird. Wie anders wäre sonst die Penisexhibition im Weissen Haus und ihr politischer Erfolg in den USA mit der Strafexpedition im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Serbien in Einklang zu bringen? Das ist eine Anekdote, zu der das heute so übliche Psychologisieren verführt, um eine weltgeschichtliche Episode zu persiflieren.
im Weissen Haus und ihr politischer Erfolg in den USA mit der Strafexpedition im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Serbien in Einklang zu bringen? Das ist eine Anekdote, zu der das heute so übliche Psychologisieren verführt, um eine weltgeschichtliche Episode zu persiflieren.
Wenn Beweggründe, Ansprüche und Empfindungen diskutiert werden, kommt niemand am Begriff Freiheit vorbei. Wohl kaum ein Lieblingsbegriff ist in der jüngsten Geschichte so strapaziert worden wie dieser. Es scheint, dass sein Hauptwert darin bestehe, mit keiner zwingenden Definition festgeschrieben zu sein. Freiheit sei ein unabdingbares Menschenrecht! So heisst es. Einem Redner, der diesen Satz zur einzigen Aussage seines Sermons macht, sind die Sympathien seiner Zuhörer sicher, denn sie glauben, er spräche ihnen aus dem Herzen. Das könnte allenfalls richtig sein; nur spricht er niemandem aus dem Verstand, denn der wird für Empfindungen nicht befragt. Mit dem Verstand können wir indessen der Etymologie des Begriffes nachgehen. Da stellt sich dann heraus, dass der Jetztzeit der Sinn für den Sozialbezug der Sprache abhanden gekommen zu sein scheint. Die Sprachvergewaltigung macht bereits Sinnverdrehungen umgangsprachlich geläufig. Die Verwechslung von Genus und Sexus ist zum Kult gediehen, und hat, zum Beispiel in der Schweiz mit der Errichtung des Bundesamtes für Frauenfragen, das für die Sexualisierung der Sprachästhetik sorgt, sein amtliches Siegel bekommen.
Doch zurück zu "frei". Gewöhnlich wird das lateinische Adjektiv "liber" mit "frei, ungebunden" übersetzt. Es ist verwandt mit dem griechischen "), was eigentlich "zum Volke gehörig" bedeutet. Es handelt sich um "Leute" gleichen Standes, die keinen Dienstanweisungen unterworfen sind. Der Begriff "Eleutheronomie" steht für die Gesetzgebung des freien Willens, also für die sittliche Ordnung. "Eleutheromanie" ist dahingegen der Freiheitsschwindel, dem man allzuleicht aufsitzt.
Obwohl wir uns im indoeuropäischen Sprachenbereich bewegen, sei doch ein Seitenblick auf semitische Sprachen erlaubt, weil das Hebräische, über die Sittenlehre des Christentums, für die europäische Kulturentwicklung besondere Bedeutung hat. Die hebräische Sprache hat für das, was hier und jetzt Freiheit genannt wird, kein Wort. Hingegen kennt sie die "Freilassung", die im alten Testament etwa zwanzigmal zum Thema wird. Dieser hebräische Freiheitsbegriff entspricht in Konturen dem griechischen eleutheros, und schliesst ein, dass auch der Freigelassene dem Gesetz untersteht . Er wird nicht in die Vogelfreiheit für den freien Abschuss hinausgeworfen, sondern "assimiliert", das heisst "angeglichen", gleichbedeutend mit "emanzipiert", aus der Herrschaftshand losgegeben, also gleichberechtigt. (Auflösung des lat. "manicipium", von "manus" und "capere" = die "Handnahme"; das war das Eigentumsrecht an Sachen und Personen und auch Bezeichnung für den familienrechtlichen Status).
. Er wird nicht in die Vogelfreiheit für den freien Abschuss hinausgeworfen, sondern "assimiliert", das heisst "angeglichen", gleichbedeutend mit "emanzipiert", aus der Herrschaftshand losgegeben, also gleichberechtigt. (Auflösung des lat. "manicipium", von "manus" und "capere" = die "Handnahme"; das war das Eigentumsrecht an Sachen und Personen und auch Bezeichnung für den familienrechtlichen Status).
Unser Eigenschaftswort "frei" gehört, mit verwandten Wörtern anderer indogermanischen Sprachen, zur Wurzel "prâi", was "schützen", "schonen", "gern haben" und "lieben" bedeutet. Altindisch "priyà" bedeutet "lieb", "erwünscht", wie altslawisch "prijati" = "günstig sein", und "beistehen". Zu dieser Wurzel gehören auch gotisch: "frijòn" = "lieben", "freidjan" = "schonen", und althochdeutsch: "fridu" = "Schutz", "Friede". Aus der indogermanischen Wurzel entwickelte sich das germanische "frei", als Begriff der Rechtsordnung in der Bedeutung: "zu den Lieben gehörig" und daher "geschützt". Das mittelhochdeutsche "friâte" gibt es noch heute als Freite, was eine Brautwerbung ist – (auf Freite gehen). Frei betrifft somit die soziale Bindung und Stellung der eigenen Stammesgenossen, die Freunde, denn diese allein sind vollberechtigt in der Gemeinschaft, im Gegensatz zu den fremdgebürtigen Unfreien, den Unterworfenen und Kriegsgefangenen. Seine Geltung war also dem soziologischen Inkreis vorbehalten. Der ursprünglich rechtlich soziale Begriff wandelte sich zum Gedanken einer sozialen Loslösung. Die allgemeine Anwendung des Adjektivs im Sinne von pflichtfrei und unabhängig, ist eine philosophische Weiterung. Eine Definition aber gibt sie nicht. Mittelhochdeutsch "vrî", althochdeutsch "frî", gotisch "freis", englisch "free", altisländisch "frjâls", sind die germanischen Geschwister des gegenwärtigen deutschen Eigenschaftswortes "frei" /
/ .
.
Die ozeanische Dimension der Freiheit ist die Sehnsucht ins Transzendentale. Freiheit wird als ein Gefühlsrecht begriffen, das jedem Phänomen angetragen werden kann, dessen Aktualisierung erstrebt wird. Damit ist gesagt, dass Freiheit sich hauptsächlich auf Dinge zu beziehen scheint, über die man im aktuellen Moment nicht verfügen zu können glaubt.
Wollte ein Freiheitsredner zum Verstande sprechen, so müsste er seinen Verstand bemühen, das heisst seinen Witz am Versuche wetzen, seiner Rede einen konkreten Inhalt zu geben. Gewöhnlich erschöpft sich das Konkrete solcher Reden in Aufrufen zu Taten, zu Handlungen aus zornigem Gerechtigkeitsgefühl, zu Aufstand und Gewalt. Das ist dann die Freiheit das tun zu dürfen, was sich aus Vernunftgründen nicht empfiehlt. Falls sich danach Gewissensbisse einstellen sollten, wäre das nur die Bestätigung eines FreudschenFunktionsmodells, und zwar des der drei Instanzen einer Person: Dem Unbewussten (das Es), welches alle Triebwünsche enthält, dem es bisweilen gelingt, die Kontrolle des Bewusstseins (das Ego) ungeprüft zu passieren, was eine unvernünftige Handlung ergibt, die zu strafen dann aus dem Überbewussten (dem Überich) mit Skrupeln und Selbstvorwürfen, ein schlechtes Gewissen und das Schamgefühl aktiviert werden .
.
Das sind innerpersönliche Vorgänge, deren Freiheiten und Unfreiheiten als subjektive, intime Angelegenheit gesehen werden könnten, wenn nicht offensichtlich soziale Komponenten am rein Persönlichen beteiligt wären. Für diese innere Gesetzgebung gebrauchte Immanuel Kantden Begriff Eleutheronomie.
Man "fühlt" sich frei. Es ist also eine Empfindung, die im sozialen Verbund verankert ist. Dafür gibt es das gemeingermanische Wort "heim" (gotisch "haims", engl. "home", schwed. "hem"), mit der Bedeutung: "Haus, Wohnung, Heimat", verwandt dem griechischen "kômè" = Dorf, und dem russischen "semjà" = Familie, ursprünglich "Ort, wo man sich niederlässt, das Lager", bedeutet demgemäss: dort, wo man unter seinesgleichen ist, sich also "frei" fühlt. Das ist, nach einer Begriffsadaption des Psychiaters Michael Balint , ein "oknophiler" Status und kennzeichnet den individuellen Temperamentstyp gemäss seiner vorherrschenden Gemütslage, die allerdings durch den "philobaten" Status ergänzt wird. Die proportionalen Anteile beider bestimmen die Position auf der Skala der Balintschen Typenlehre.
, ein "oknophiler" Status und kennzeichnet den individuellen Temperamentstyp gemäss seiner vorherrschenden Gemütslage, die allerdings durch den "philobaten" Status ergänzt wird. Die proportionalen Anteile beider bestimmen die Position auf der Skala der Balintschen Typenlehre.
Wie frei der freie menschliche Geist wirklich ist, bleibt eine Kardinalsfrage, auf die es nur relativ gültige Antworten geben kann, wenn das Feld, in welchem Freiheit gemeint ist, abgesteckt wird.
Wer heutzutage "frei" sagt, drückt das Recht aus, von jeder Verpflichtung, von jeder Verhaltensregel, von Sitte und Ordnung frei zu sein. Dies sei ein Individualrecht, das beansprucht werden dürfe. Der Gedanke, dass Freiheit ein Ergebnis des Zusammenstehens sein könnte, eine Frucht der Sicherheit innerhalb eines sozialen Inkreises, ist im neudeutschen Sprachgebrauch nicht mehr gegeben. Während meiner frühen Kindheit wurde noch die Hymne gesungen: "Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt", von der die fünfte Strophe kündet: "Wo sich Männer finden, die für Ehr und Recht mutig sich verbinden, weilt ein frei Geschlecht!" Freiheit, als Bekenntnis zur sozialen Bindung war, zumindest in der Heimat des europäischen Mischgebietes verschiedener Ethnien zwischen Oder und Memel noch wirklich. Der Memelländer Max von Schenkendorf hatte während der Freiheitskriege gegen Napoleon diesen Text geschrieben. Als die soziale Wirklichkeit mit dem Sprachgebrauch noch lebendig war, wurde Wert darauf gelegt, zu wissen was man sagte, und dem zu trauen, was man hörte.
hatte während der Freiheitskriege gegen Napoleon diesen Text geschrieben. Als die soziale Wirklichkeit mit dem Sprachgebrauch noch lebendig war, wurde Wert darauf gelegt, zu wissen was man sagte, und dem zu trauen, was man hörte.
Dass Freiheit heutzutage eher die sittliche Entfesselung meint, als die ortsgebundene Gesittung, beruht wohl auf dem natürlichen Raubinstinkt (Philobatie), der in Widerstreit mit dem Wunsch nach Geborgenheit (Oknophilie) liegt. Auch der Blick zurück in die Geschichte, zum Beispiel auf die Völkerwanderungen, zeigt, dass nomadisierende Heimatlose stets durch die Ausplünderung der Sesshaften lebten. Heutigentags rühmen sich intellektuelle Nomaden ihrer Unabhängigkeit von Heimatwerten. Sie bekennen durch ihre Haltung, von der Scholle zu profitieren, ohne sesshaft zu sein, weil die fruchtbaren Felder, von denen ihre Nahrung kommt, in einem Irgendwo liegen, das niemand kennt. Der Globus ist das Mass ihrer Freiheit, nicht der ihnen im Wesentlichen fremde Tisch, an dem sie speisen. In der Sache ist dieses Fremdgehengleich geblieben, wie das der Wandervölker, wenn auch in der Art und Weise unterschiedliche Manieren gelten. Heimatlose, streunende Banden, plündern die Sesshaften aus. Das ist ein ewiger Beweggrund zu Kriegen in aller Welt, besonders zu den Bürgerkriegen, denn auf nichts ist der Mensch mehr versessen als auf ein Hab und Gut, das ihm nicht gehört. Dienstbereitschaft, einen Besitz pflegend zu erhalten, ist eine Bauern- und Bürgertugend, welche Sesshaftigkeit voraussetzt. Ortsansässige Handwerker und Landwirte unterliegen dem Misstrauen derer, die von ihren Diensten leben. Die bolschewistische Revolution hatte auch deshalb besonders die landbesitzenden Kulaken im Visier, als sie ihren Ausrottungsrausch austobte. Nomaden, verschiebbare Massen, sind leichter zu führende Instrumente der Macht, als heimatverwurzelte Dickköpfe. Industrie, anonyme Produktion, unsichere Arbeitsplätze, hektische Migration, sind im Gegenzug Gründe zu einer Sehnsucht zurück in ein Gestern, das es nicht mehr gibt. Eine solche Freiheit ist zur Sage geworden, die Sozialbezogenheit des Begriffes Freiheit ist erloschen.
Verlässlichkeit und Vertrauen gehören zu den Komponenten der Treue die, je länger je weniger, ein allgemeines Bedürfnis zu sein scheint, und die damit dem Adjektiv "frei" jetzt unterlegten Sinn widerspricht. So schwindet auch das Interesse an Werten wie Ehrlichkeit und Beständigkeit und damit auch an der Essenz des "Freiseins" im Bunde mit seinesgleichen. Der traditionelle Inkreis der Identität der Heimatreuen ist im Begriffe sich aufzulösen, und damit auch die zugehörige In-Aus-Kreis-Gliederung. Unabhängigkeit und Sesshaftigkeit scheinen keinen Eigenwert mehr zu haben und das, wofür alle Generationen der siebenhundert Jahre Eidgenossenschaft sich aufopfernd einsetzten, und in vielen, den jeweiligen Zeitläufen angemessenen Formen durchsetzten, landet auf dem Schrotthaufen, wenn es nicht mehr beansprucht wird. Wenn es nicht die intime Verwurzelung in der Gemeinschaft der Gleichwertigen gibt, ist "frei" auch keine Eigenschaft eines Landes mehr.
"Seinen Platz behaupten!" und andere verdrängen, ist das elementarste Bestreben jedes Lebens, vom niedersten pflanzlichen bis zum höchsten tierischen Organismus. Jede spielerische und sportliche Betätigung, wie selbst jede edle menschliche Regung, ist ohne Verdrängung, Platzbehauptung und Verteidigung nicht existent. Nennen wir das den "gesunden Wettbewerb", so ist dies ein Synonym, das zudem als Inbegriff der Freiheit gilt. In alldem gibt es jedoch ethische Schwellen, die als Gradmesser menschlicher Kultur anzulegen sind. Wenn die Vertreibung ganzer Völkerschaften aus ihren angestammten Siedlungsgebieten praktiziert wird, erschrecken wir vor der Brutalität ihrer Gewalt, sofern wir nicht als Täter oder Opfer direkt beteiligt sind. Dann sind Triumph einerseits und Verzweiflung andrerseits die zugehörigen Gefühle.
Um sich eine Idee von der Geschichte der Vertreibungen machen zu können, die aus den dunklen Tiefen mythischer Zeiten über den biblischen Exodus bis in die letzte Neuzeit hineinreicht, genügt selbst eine rudimentäre Bibelkenntnis. Das Volk Israel wurde und hat vertrieben, wie andere Völker auch; doch das ist uns von der auserwählten Nation so nachdrücklich wie einseitig übermittelt worden, und dieser Schicksalsfaden wird nach jedem Bruch wieder aufgenommen und weitergesponnen. Besonders tatbezogen schilderte der jüdisch-römische Historiker Flavius Josephus die Geschichte des Jüdischen Krieges für einen Zeitraum von 241 Jahren (168 vor, bis 73 nach Chr.) . Es scheinen vor allem die erlittenen Kränkungen einer Nation zu sein, die ihr Geschichtsbewusstsein prägen, um spätere Genugtuung einzufordern, falls sie überlebt.
. Es scheinen vor allem die erlittenen Kränkungen einer Nation zu sein, die ihr Geschichtsbewusstsein prägen, um spätere Genugtuung einzufordern, falls sie überlebt.
Alle Völker sind in ihrer Geschichte zu Höhenflügen und Niederlagen auserwählt, auch die Serben. Auch sie sind in einer Vergangenheit verankert, in deren Mitte eine Erniedrigung steht, die noch heute heftig emotionalisiert. Auf dem Amselfeld Kosovo polje wurden sie am 28. Juni 1389 vom Türken Murad I. besiegt, daselbst wo Murad II. am 19.10.1498 die Ungaren schlug. Das Gebiet wurde muslimisch. Die Serben beziehen sich bei der Darstellung ihrer nationalen Identität und Würde darauf, und nicht auf ihre volle Unabhängigkeit durch Bismarcks Schiedsspruch von 1878 /
/ .
.
Das ist natürlich keine Rechtfertigung für Greueltaten, zumal die Kosovari dort ihre aktuelle, in derselben Geschichte begründete Existenzberechtigung haben, sondern lediglich die Feststellung der geschichtlichen Realität.
Alle schlimmen Taten wurzeln in Emotionen. Selbst die Berichterstattung ist parteiisch, denn jeder Berichterstatter nimmt gemäss seiner eigenen Gefühlswallungen Stellung. Kann die eine Seite zum Täter, die andere zum Opfer gestempelt werden, so erleichtert dies die sprachliche Fassung des Geschehens, ohne dass damit der Realität Genüge getan wäre. Dass beide Seiten als Gegenpole derselben Historie zusammengehören, ist bereits eine Komplikation, die Journalisten irritiert, denn sie ist nicht ohne Fähigkeit und Aufwand mitteilbar.
Bei genügend grossem zeitlichem wie örtlichem Abstand, stellt sich das Drama als ein Genregemälde dar, wie Barbusse es formulierte: Zwei Armeen, die sich bekämpfen, sind eine Armee, die Selbstmord an sich übt! , wobei zu ergänzen bliebe, dass der Überlebende der Sieger ist, der mit dem Blute des Besiegten die Geschichte schreibt. "Episoden der Geschichte" nannte das ein Franzose
, wobei zu ergänzen bliebe, dass der Überlebende der Sieger ist, der mit dem Blute des Besiegten die Geschichte schreibt. "Episoden der Geschichte" nannte das ein Franzose , der für diese Anmerkung gerichtlich belangt wurde. Wer aktualisierte Stigmata beschwört, muss damit rechnen, als Parteigänger des Bösen verurteilt zu werden; denn solange Wunden immerwieder aufgerissen werden und bluten, gibt es das unparteiische Geschichtsverständnis nicht.
, der für diese Anmerkung gerichtlich belangt wurde. Wer aktualisierte Stigmata beschwört, muss damit rechnen, als Parteigänger des Bösen verurteilt zu werden; denn solange Wunden immerwieder aufgerissen werden und bluten, gibt es das unparteiische Geschichtsverständnis nicht.
So werden aus der Geschichte der Vertreibungen in heutiger Berichterstattung die europäischen Siegesjahre 1945 bis 1950 krampfhaft unterdrückt, während die fürchterlichen Jahre davor besonders wachgehalten werden. Das ist erstaunlich, denn in der Rechtsprechung der betreffenden osteuropäischen Staaten sind die ersten fünf Nachkriegsjahre sehr eindrücklich dokumentiert durch die Gesetze, die Polen erst am 8. Januar 1951 aufhob . Die Dokumentation ist allgemein zugänglich. Die tschechischen Benesch-Dekrete, durch die allein 2,83 Millionen autochthoner Sudeten aus ihrem historischen Stammesgebiet, und die ungarische Minderheit aus der Tschechoslowakei vertrieben wurden, sind hingegen noch heute in Kraft. Der jetzige tschechische Ministerpräsident Milos Zeman (2001) empfahl auch einem anderen, rassistisch definierten Staat des vorderen Orients, die gleiche Lösung ähnlicher Probleme, und der Parlamentspräsident Vaclav Klaus forderte gar, Prag solle sich die Unantastbarkeit der Benesch-Dekrete vor dem EU-Beitritt von Brüssel explizit garantieren lassen. Das wurde Ende Februar 2002 zum Thema, als der ungarische Ministerpräsident Victor Orban, in Brüssel nach seiner Meinung befragt, geantwortet hatte, dass jene Dekrete der Rechtsordnung der Europäischen Union doch wohl widersprächen!
. Die Dokumentation ist allgemein zugänglich. Die tschechischen Benesch-Dekrete, durch die allein 2,83 Millionen autochthoner Sudeten aus ihrem historischen Stammesgebiet, und die ungarische Minderheit aus der Tschechoslowakei vertrieben wurden, sind hingegen noch heute in Kraft. Der jetzige tschechische Ministerpräsident Milos Zeman (2001) empfahl auch einem anderen, rassistisch definierten Staat des vorderen Orients, die gleiche Lösung ähnlicher Probleme, und der Parlamentspräsident Vaclav Klaus forderte gar, Prag solle sich die Unantastbarkeit der Benesch-Dekrete vor dem EU-Beitritt von Brüssel explizit garantieren lassen. Das wurde Ende Februar 2002 zum Thema, als der ungarische Ministerpräsident Victor Orban, in Brüssel nach seiner Meinung befragt, geantwortet hatte, dass jene Dekrete der Rechtsordnung der Europäischen Union doch wohl widersprächen! Auf eine politisch dermassen wurmstichige Bank sollte sich niemand zu niemandem setzen, um nicht in den Dreck mitgerissen zu werden, wenn sie zusammenfällt.
Auf eine politisch dermassen wurmstichige Bank sollte sich niemand zu niemandem setzen, um nicht in den Dreck mitgerissen zu werden, wenn sie zusammenfällt.
Seinerzeit wurden 16,6 Millionen Menschen allein aus Polen vertrieben, und ihre Heimstätten durch Umsiedler aus dem Sowjetgrossreich nachgefüllt. Vor Ort bekennt sich nun die kulturbestrebte Elite zum Preussentum auf polnisch und zwischen Memel und Pregel neu gar auf russisch . Die Kulturgüter, vom Deutschen Orden über Immanuel Kant bis zur Infrastrukturtechnik von vor den beiden Weltkriegen, wurden zur eigenen Historie der autochthonen, neuen Generationen, während fernab, vom Kulturrabaukenchor, der Hassgesang auf Preussen in deutsch geübt wird. Prussisch ging dort, nach der Christianisierung im Hochmittelalter, unter polnisch, kassubisch, litauisch und deutsch verloren. Dieses Einwanderungsland war nie ein Rassemonolith, sondern für Jahrhunderte ein funktionales Regelwerk auf Gegenseitigkeit einander belebender Identitätskreise, einer in sich heterogenen Einheit, ein polnisches Lehen namens Preussen, in Personalunion mit dem brandenburgischen Kurfürstentum des Deutschen Reiches.
. Die Kulturgüter, vom Deutschen Orden über Immanuel Kant bis zur Infrastrukturtechnik von vor den beiden Weltkriegen, wurden zur eigenen Historie der autochthonen, neuen Generationen, während fernab, vom Kulturrabaukenchor, der Hassgesang auf Preussen in deutsch geübt wird. Prussisch ging dort, nach der Christianisierung im Hochmittelalter, unter polnisch, kassubisch, litauisch und deutsch verloren. Dieses Einwanderungsland war nie ein Rassemonolith, sondern für Jahrhunderte ein funktionales Regelwerk auf Gegenseitigkeit einander belebender Identitätskreise, einer in sich heterogenen Einheit, ein polnisches Lehen namens Preussen, in Personalunion mit dem brandenburgischen Kurfürstentum des Deutschen Reiches.
Wer sich mit geschichtlich begründeter Sozialpsychologie befasst, sollte "Eine kleine Geschichte Preussens", dargestellt von Eberhard Straub , studieren. Sie ist eine geographisch lokalisierte Analyse historischer Vorgänge, deren darin enthaltene Identitätspsychologie grundsätzlich auch anderorts gilt.
, studieren. Sie ist eine geographisch lokalisierte Analyse historischer Vorgänge, deren darin enthaltene Identitätspsychologie grundsätzlich auch anderorts gilt.
Die identitätsgegebene Melancholie geborener Preussen scheint, nach dem Diktat des Alliierten Kontrollrats durch das Gesetz Nr. 46 vom 25. Februar 1947 dieselbe, welche schon den preussischen König Wilhelm I. am Vorabend der Deutschen Reichsgründung vom 17. Januar 1871, in Tränen ausbrechend, klagen liess: "Morgen ist der unglücklichste Tag meines Lebens. Da tragen wir das preussische Königtum zu Grabe...", (wie Diwald im Prolog zur Porträtssammlung berühmter Söhne dieses Landes zitiert ).
).
Der Alliierte Kontrollrat hatte Schuldige, "Kollektivstraftäter", böse Buben, namentlich bekannte Missetäter strafen wollen. Er gab vor, mit Preussen die genetische Bosheit gefunden zu haben. Das ist eine verquere Sicht über die Geschichte, ein Zeugnis zweckdienlicher Phantasie, die durch Sachkenntnis nicht gehemmt ist. Es geht Politikern gewöhnlich auch nicht um historische Seriösität, sondern um symbolträchtige Aufhänger. Dem Hass eine Beute schenken, um in ihm zu schwelgen, ist eine geläufige politische Selbstbefriedigung. So erhoben die Alliierten 1947 einerseits den deutschen Nationalsozialismus, den sie militärisch besiegt hatten, zum politischen Dauerbrenner und verhängten andrerseits ihre DAMNATIO MEMORIAE über einen Staat, den es längst nicht mehr gab, diesem damit unbeabsichtigt zur historischen Grösse als Legende beispielhafter Tugenden klassischen Formats verhelfend, die den Nachfolgekonstruktionen weitgehend fehlen. Preussen war im Reiche untergegangen (nicht umgekehrt!) und de facto bestand es seit dem Preussenschlag durch die Regierung von Papen vom 20. Juli 1932 wie durch das Gesetz zum Neuaufbau des Reiches vom 30. Januar 1934 nicht mehr. Seine Tugenden hatten sich seit 1871 im Deutschtum allmählich verloren. Der Historiker Straub stellt also sachlich begründet fest, dass es eine Geschichte Preussens im nationalsozialistischen Reiche nicht gab, denn der Nationalsozialismus sei rein deutsche Geschichte. Hier sein Schlusswort: "Da der klassische Staat mittlerweile in das Reich der historischen Erzählungen gehört, verwirrt auch Preussen nicht mehr. Es ist Geschichte, nichts weiter!"
Emotionale Ausbrüche, sei es von ideologischem, von religiösem, oder gar grundlosem Eifer, richten Unheil an. So entbrannten auch die kriegerischen Ereignisse der späten neunziger Jahre in Exjugoslawien entlang den "inneren Grenzen" von religiösen Bekenntnissen, wobei die orthodoxe serbische Nationalkirche als Fokus der ethnischen Identität eines völkischen Sendungswahns auszumachen ist, der bei anderen, verwandten osteuropäischen Nationalkirchen Unterstützung fand.
Die Inkreis-Auskreis-Dynamik ist mit diesen akuten Ereignissen leicht erkennbar, und es braucht schon einigen Aufwand von Vernebelungskünsten, um sie unkenntlich zu machen; doch dieser Aufwand wird betrieben.
Aktuelle Berichterstattung ist immer subjektiv. Um objektiv sein zu können, braucht es Nüchternheit und Gefühlsferne.
So werden aus Tagesbedingungen aufbrechende Dramen stets als geschichtlich einmalig empfunden und publizistisch erhöht. So auch die Katastrophe vom 11. September 2001, als zwei grosse, vollgetankte Linienflugzeuge, zielgenau gesteuert, in die beiden Türme des World Trade Center in New York rasten. Ein weiteres Linienflugzeug traf ebenso das Pentagon in Washington, eine vierte vom Kurs gezwungene Linienmaschine stürzte in eine Geländesenke ab, weil die aktive Kamikazegruppe von den zivilen Fluggästen daran gehindert wurde, ihr spektakuläres Ziel zu erreichen. Das war ein koordinierter Coup vier kleiner Aktionsgruppen fanatisierter Hochschuldstudenten, die offenbar vom Selbstaufopferungswahn im Dienste ihrer religiösen Moralanmassung befallen, ihr Heil im grandiosen Mordspektakel suchten. Politisch wurde hinfort von einer neuen Dimension des internationalen Terrors des ersten Krieges des zweiten Jahrtausends gesprochen. Handelt es sich dabei um die Globalisierung der Effektivität kleiner, autarker Zellen, mit dem Potential gelegentlicher Abstimmung (Koordination) untereinander auf der Basis eines gemeinsamen Glaubensbekenntnisses, eines gemeinsamen politischen Willens oder auch einer weltumspannenden Ideologie? Die Politologen der USA taten sich schwer mit der Analyse, obwohl ihr Land doch Erfahrung mit kleinen, autark operierenden Terrorgruppen hat, denn der Ku-Klux-Klan ist ja noch immer verdeckt tätig, und gelegentlich tritt er in die Öffentlichkeit.
Die im Oktober desselben Jahres erfolgten Anschläge mit Anthraxsporen (Milzbranderreger) über den Postversand auf bekannte Persönlichkeiten, sind ein weiteres Beispiel der Effizienz kleiner, anonymer Tätergruppen. Sie gedeihen offensichtlich auch im sozialen Klima wirtschaftlicher Überhitzung, denn die Anthraxtäterschaft muss ein überdurchschnittliches Bildungsprofil und Zugang zu hochentwickelten Techniken und Labors haben. Diese Anschläge zielten auf die Zentren der global expandierenden Wirtschaftsideologie. Die der Weltherrschaft verdächtigte Weltwirtschaft ist ein weltkriegerisches Motiv einer allgemeinen, diffusen Gegenwehr. Dass dabei kämpferische Kleingruppen einander finden und grössere Aktionseinheiten bilden, ist eine zwangsläufige Folge. Solch gärender Emotionssuppe entsteigen charismatische Führergestalten, denen es gegeben ist, das zu verkörpern, was jedes Einzelglied der Masse für sich selbst idealisiert.
Das sind Monospuren des Empfindens und Denkens in Schlagworten, den leicht fasslichen Begriffen, deren phonetische Gestalt von martialischer Melodie und pulsierendem Rhythmus ist.
Es gibt in der Antiglobalisierungsbewegung verschiedene Ansätze mit solchen Galionsfiguren, die als Verkörperung der Kollektivseele der Massen in Erscheinung treten. Osama bin Laden ist einer dieser Apostel einer angeblich gerechteren Welt. Er hat die kämpfende, autarke Kleingruppe nicht erfunden, denn das Konzept liegt in der Natur der Sache, weil es die Basis der Dynamik der Massenbewegung, des Massenrausches, des Massenwahns, die Ausblühung des Fanatismus ist, dem immer eine hypnotoide Grundeinstimmung zugrunde liegt. Die Gesellschaft funktioniert prinzipiell als Sozialisation in Kleingruppen, die in einem Meinungsgleichklang mit verwandten Gruppierungen gedeihen. Das ist so natürlich, dass es nur dann auffällt, wenn sich eine grössere Gewaltwelle zusammenbraut. Die kleine Gruppe ist identisch mit dem subjektiven Selbstgefühl. Sie ist der zentripetale Kern jeder sozialen Struktur, und sie ist auch das psychologische sine qua non jedes Persönlichkeitsprofils. Im Grunde ist jeder Mensch ein potentieller Überzeugungstäter, der sich im Dienste einer (ob guten oder bösen, ist ein Problem der Perspektive) Sache zu schaffen macht. Jeder ist sittlich indoktriniert und deshalb überzeugt von der ausschliesslichen Gültigkeit seiner mitbekommenen Ethik, der alle anderen ethischen Richtlinien unterlegen seien. Nicht diese verbalen Inhalte sind naturgesetzlich gegeben, sondern das Konzept ist es, das Gerüst der Funktion, das mit kulturellen Varia gefüllt werden kann. Die Füllungen sind virtuell arrangierte Versatzstücke sinnlicher Wahrnehmungen, welche als überzeugende Glaubenbekenntnisse vertreten werden.
ist einer dieser Apostel einer angeblich gerechteren Welt. Er hat die kämpfende, autarke Kleingruppe nicht erfunden, denn das Konzept liegt in der Natur der Sache, weil es die Basis der Dynamik der Massenbewegung, des Massenrausches, des Massenwahns, die Ausblühung des Fanatismus ist, dem immer eine hypnotoide Grundeinstimmung zugrunde liegt. Die Gesellschaft funktioniert prinzipiell als Sozialisation in Kleingruppen, die in einem Meinungsgleichklang mit verwandten Gruppierungen gedeihen. Das ist so natürlich, dass es nur dann auffällt, wenn sich eine grössere Gewaltwelle zusammenbraut. Die kleine Gruppe ist identisch mit dem subjektiven Selbstgefühl. Sie ist der zentripetale Kern jeder sozialen Struktur, und sie ist auch das psychologische sine qua non jedes Persönlichkeitsprofils. Im Grunde ist jeder Mensch ein potentieller Überzeugungstäter, der sich im Dienste einer (ob guten oder bösen, ist ein Problem der Perspektive) Sache zu schaffen macht. Jeder ist sittlich indoktriniert und deshalb überzeugt von der ausschliesslichen Gültigkeit seiner mitbekommenen Ethik, der alle anderen ethischen Richtlinien unterlegen seien. Nicht diese verbalen Inhalte sind naturgesetzlich gegeben, sondern das Konzept ist es, das Gerüst der Funktion, das mit kulturellen Varia gefüllt werden kann. Die Füllungen sind virtuell arrangierte Versatzstücke sinnlicher Wahrnehmungen, welche als überzeugende Glaubenbekenntnisse vertreten werden.
Massenpsychosen geraten nicht nur zu angriffiger Zerstörungswut; sie können ebenso in die elegische Richtung führen, in Massentrübsal und Selbstkasteiung; immer aber richtet die Massengleichschaltung von Emotionen Unheil an.
Bei allen gefühlsgetragenen Impulsleistungen fällt zwar der Sinn für Folgen weg, doch sie haben konsequenterweise Signalwirkung und lösen somit Antworten auf der Dialogseite aus, eben auf derselben Gefühlsebene, auf der sie erfolgten, wobei diese ebenfalls Signalwirkung haben, die ihrerseits Antworten bewirken. Das ist der Einstieg in eine dialogale Kettenreaktion, deren Tragweite beim ersten Impuls dem daran Beteiligten unbekannt ist. Solche Progressionen haben das Potential für ein tragisches Ende, wenn keine Auflösung durch einen durchquerenden, andersartigen Impuls erfolgt.
Sogenannte "humane Aktionen", die eindeutig vom Mitgefühl getragen sind, und die nicht selten Züge von Massenhysterien annehmen können, sind dafür die peinlichen Beispiele, wenn sie durch ihre Progression später eine Rückbesinnung erzwingen.
Die vom ungehemmten Mitleid bewegte Hilfsbereitschaft, lässt den Hilfswilligen in einem selbstgeweinten Meer von Tränen der Menschlichkeit ertrinken, sofern er keinen Therapeuten findet, der ihm die Last seiner sich selbst auferlegten Verpflichtungen abnimmt. Im Falle einer hilfsbereiten Nation ist dieser Therapeut die nationale Wirtschaft, im Falle eines Samaritervereins oder einer Partei, sind es die Mittel der anderen, durch deren Umverteilung das Mitgefühl als makellose Tugend in der Selbstbespiegelung glänzt. Es gibt da offenbare Unterschiede, und zwar im Wirkmal der Progression. Einmalige Hilfsleistungen sind unproblematisch. Sie eignen sich gut zum Beweis der Produktivität von Solidaritätsaktionen. Problematisch sind indessen Aktionen, die in sich die Progression als Dauerverpflichtung tragen. Hierher gehören die Umsiedlungslawinen, die über einen gutwilligen Nachbarn hereinbrechen können. Problematisch wird jede Nothilfe, bei der das Potential der Not nicht abschätzbar ist.
Das Brot teilen sättigt mit gutem Gefühl. Es wird mehr, als man gegeben hat, und reicht, bis es nichts mehr zu teilen gibt. Geteilter Hunger wird aber nicht weniger und nicht leichter. Er wird grösser und verzehrt die Kraft der Grundexistenz. Und trotzdem ist die Impulsleistung in den Grenzen des Verfügbaren und Leistbaren existenzbewahrend. Sie hebt Gegensätze auf und garantiert, in bestimmten Grenzen, das Überleben der eigenen Art. Es handelt sich um einen Inkreismechanismus, der den Inkreis funktionstüchtig erhält, der sich aber ins Uferlose des Auskreises verlieren kann, wenn er die Grenzen überwuchert und dann die Eigenexistenz gefährdet. Es kommt eben darauf an, wo die Grenze zwischen Inkreis und Auskreis gezogen wird.
Im allgemeinen halten wir uns, bei der Beurteilung einzelner Geschehnisse der ewigen Aktualitätenschau, an die handfesten Äusserungen, welche sinnlich ohne Umweg fassbar sind (Gestaltwahrnehmung nach K. Lorenz). Den eigentlichen Vorgang nehmen wir als mechanischen Ablauf nur dann wahr, wenn wir offensichtlichen Stereotypien begegnen. Dann genügt es uns, dies als Stereotypie, als immer gleiche Wiederholung, zu erkennen. Die forschende Neugier geht selten auf dieses Angebot zur Ergründung eben jener Vorgänge ein. Bezüglich der Äusserungen liegen sehr viele Hypothesen vor, des Rätsels Lösung zu finden, wobei die eigentliche, naturgesetzliche Mechanik, die eben jene Äusserungen hervorbringt, Kerninhalt der Forschung sein müsste.
Selbstwertgefühle wurzeln in den Sozialbeziehungen, welche die Stellenwerte im Beziehungsgeflecht festlegen. Dazu gehören Normen von Verhaltensmodi, die, in sich selbst unvariabel, latent zur Verfügung stehen.
Selbsterfahrung ist oft von so bedrohlicher Härte, dass sie mit Illusionen geschönt wird. Im Extremfall schützt ein von Konrad Lorenz beschriebener Übersprungreflex vor dem Selbstwertkollaps.
beschriebener Übersprungreflex vor dem Selbstwertkollaps.
Sigmund Freud hat eine Reihe solcher Funktionen als Egodefensmechanismen beschrieben.
hat eine Reihe solcher Funktionen als Egodefensmechanismen beschrieben.
Alfred Adler hatte sich dem Studium der Bedeutung der Kompensation von Karenzen und Mängeln des Organismus gewidmet, und diese ist eben ein solcher Egodefensmechanismus aus der FreudschenListe. Bei Adler erscheint das soziale Umfeld als Bezugssystem für die Wertung dessen, was Mängel und Karenzen sind.
hatte sich dem Studium der Bedeutung der Kompensation von Karenzen und Mängeln des Organismus gewidmet, und diese ist eben ein solcher Egodefensmechanismus aus der FreudschenListe. Bei Adler erscheint das soziale Umfeld als Bezugssystem für die Wertung dessen, was Mängel und Karenzen sind.
Carl Gustav Jung steigt mit der Beschreibung des kollektiven Unbewussten in das Thema ein, allerdings mit einem eher mystifizierenden Deutungsansatz, der sich dann doch mehr oder minder an die Psychologie des Sichtbaren, eben der manifesten Aussenseite hält.
steigt mit der Beschreibung des kollektiven Unbewussten in das Thema ein, allerdings mit einem eher mystifizierenden Deutungsansatz, der sich dann doch mehr oder minder an die Psychologie des Sichtbaren, eben der manifesten Aussenseite hält.
Unser hier vorgestelltes Konzept ist vor allem ein Versuch, dienaturgesetzliche Grundlage der kollektiv-psychischen Abläufe zu erfassen. Es ist deshalb eine Arbeit an der Dynamik, an der Mechanik des psychischen Geschehens, soweit es kollektiv bestimmt ist.
Es gibt sinnliche Wahrnehmungen die wie Drogen auf Gemütslagen wirken. Sie steuern unter anderem die Aktivierung der Egodefensmechanismen. Besonders das Delegieren von Verbindlichkeiten, die eigentlich die Selbstverantwortung des Individuums betreffen, und deren Natur Mühe macht, weil ihre Lösung Energie und Fähigkeiten erfordert, die zu haben der Einzelne sich nicht sicher ist, steht oft am Anfang einer kollektiven Mobilisation.
Der ganze Wertekatalog menschlicher Vorstellungen, Wünsche und Träume wird in eine charismatische Person hineingesehen (projiziert), die dann als Führer, Guru, Held, Erlöser erscheint, aber vor allem als Übervater verantwortlich ist, und so den Versager entlastet, der zu sein man sich insgeheim (unbewusst) fürchtet. Was für Individuen gilt, gilt auch für die grösseren Einheiten der Identität. Für einen Zeitraum, der durch die schliessliche Erschöpfung der Kraftquelle begrenzt ist, bewirkt jede Kraftprobe eine verstärkte Verdichtung des erprobten Beziehungskreises. Es wird das Phänomen Opferbereitschaft sichtbar, die ein denkender Mensch nicht hätte, ein fühlender aber ja, nach dem Motto: "Einer für alle!" in der vagen Hoffnung darauf, dass auch "Alle für einen!" einstehen mögen.
So ist es schon sonderbar, dass die grössten Machtkumulationen der neuesten Weltgeschichte Kriege erklärtermassen gegen jeweilen nur eine Person führten. Freilich ging es um seine "bösen" Taten, die einer allein aber nie hätte vollbringen können. Der Glaube, dass mit dem Verschwinden eines Namens auch ein vermeintlicher Defekt im System des Zusammenlebens ausgemerzt wäre, wiederholt sich also, obwohl sich immer, wenn die Hoffnung der Völker diesem Glauben vertraute, er sich als töricht erwies. Wir geben dem Ungeist, der uns auf Abwege bringt, einen Namen, damit wir ihn ächten können. In weniger "aufgeklärten" Zeiten nannte man ihn einfach Teufel, und der wurde exorziert. Jetzt heisst er Führer, und wird ausgebombt. Falls er jedoch zu stark und von zu weitläufiger Macht sein sollte, dann suchen wir mit ihm ins Einvernehmen zu kommen. Damit wird das Regiment einzelner Tyrannen dermassen gefestigt, dass sie schliesslich altersehrwürdig als "geliebte Führer des Volkes", unter Kondolenz ihrer Gegner, Rivalen, Neider, Moralprediger und Bündnisganoven ableben dürfen.
Was Gewissensbisse sind, weiss jeder der sie hat. Die allgemeine Ansicht, dass Politik gewissenlos sei, vermutet, dass ihr das soziale Gewissen fehle, weil sie sich eher als eine Arena für Selbstdarsteller eignet, als dass sie dem Wohle der Gemeinschaft diene. Die Volksmeinung scheint davon auszugehen, dass Politik ein Spielobjekt für egozentrische Profiteure sei, und nur insofern auch eine auf das öffentliche Leben zielende Tätigkeit und Bestrebung. Politik als Staatswissenschaft und Gesellschaftslehre ist dem Volke nur eine lexikalische Grösse.
Praktisch läuft diese Meinung auf einen Gegensatz vom Gewissen zur Politik hinaus. Es heisst, Gewissen sei das persönliche Bewusstsein vom sittlich Guten. Sittlich und gut sind ethische Bezugswerte, also keine angeborenen Wirkmale, sondern auf Regeln des Zusammenlebens bezogene Verhaltensmodi. Es sind Spielregeln, welche in verschiedenen Kulturen unterschiedlich sind, und auch mit der Kulturentwicklung variieren können. Die Mosaischen Gebote und die darauf bauenden christlichen Verhaltensregeln
und die darauf bauenden christlichen Verhaltensregeln , sind solche sittlichen Bezugsgrössen des Gewissens. Gewissen hat der Mensch, indem er fühlt, ob er die Gesetze des sozialen Zusammenlebens befolgt oder verletzt. Es ist offenbar immer Sache des Einzelnen, neigt aber dazu,sich im Gruppenverband aufzulösen, und zwar im Lösungsmittel Sicherheit, dargestellt im Rückhalt, den die Gruppe bietet, da ja die Gruppe die Sitte bestimmt
, sind solche sittlichen Bezugsgrössen des Gewissens. Gewissen hat der Mensch, indem er fühlt, ob er die Gesetze des sozialen Zusammenlebens befolgt oder verletzt. Es ist offenbar immer Sache des Einzelnen, neigt aber dazu,sich im Gruppenverband aufzulösen, und zwar im Lösungsmittel Sicherheit, dargestellt im Rückhalt, den die Gruppe bietet, da ja die Gruppe die Sitte bestimmt . Wenn die ökonomische wie ethische Kompetenz dem Kollektiv übertragen wird, entstehen hierarchische Strukturen der sozialen Verantwortung. So ist es kein Zufall, dass alle demokratisch gewählten Diktatoren unserer Epoche sich zum Sozialismus bekannten, denn dieser trägt den Keim zur Tyrannei in sich, wenn autokratischer Dirigismus dem kindlichen Fürsorgebedürfnis einfacher Gemüter zu willfahren verspricht. Entmündigung ist eben der Preis, den Befürsorgte entrichten, und Fürsorge gibt demjenigen Macht, der sie verheisst.
. Wenn die ökonomische wie ethische Kompetenz dem Kollektiv übertragen wird, entstehen hierarchische Strukturen der sozialen Verantwortung. So ist es kein Zufall, dass alle demokratisch gewählten Diktatoren unserer Epoche sich zum Sozialismus bekannten, denn dieser trägt den Keim zur Tyrannei in sich, wenn autokratischer Dirigismus dem kindlichen Fürsorgebedürfnis einfacher Gemüter zu willfahren verspricht. Entmündigung ist eben der Preis, den Befürsorgte entrichten, und Fürsorge gibt demjenigen Macht, der sie verheisst.
Fehlverhalten ist dann gegeben, wenn die sittlichen Regeln des sozialen Inkreises verletzt werden. So bildet der soziale Inkreis zum Auskreis eine kritische Linie, wo Missverständnisse lauern, wenn zum Beispiel eine Nation einer ganz bestimmten Ethik und Tradition, von einem grösseren Bereich anderer Bezugswerte umschlossen ist.
Die umschliessende Gesellschaft verlangt von der umschlossenen das Bekenntnis zur gemeinsamen Idendtität, verbalisiert in Idealen, und neigt zur gewaltsamen Durchsetzung ihres Meinungsdiktats. "Gewissensfreiheit", wie sie das staatliche oder das internationale Recht der Weltorganisation "gewährleistet", erlaubt also nur die Möglichkeit, dem grösseren Machtpotential ohne Vorbehalte zuzustimmen.
Dies ist eine in sich widersprüchliche Situation, denn sie verneint den Wert geschlossener Identitäten. Widersprüchlichkeit ist in allen lebendigen Dingen. Das Leben selbst äussert sich in Widersprüchen. Es ist immer raumgreifend (philobat) bei zentripetaler (oknophiler) Verankerung. Seine Expansion dient dem Bestand des Subjektiven. Die Soziodynamik sichert die Erhaltung der Egozentrik aber nur, wenn die dazu nötige Interdipendenz (die gegenseitige Abhängigkeit, das Wechselspiel) gewahrt bleibt. Ohne Inanspruchnahme, ohne Herausforderung, entsteht kein Selbstbewusstsein, ohne Land kein Fluss, ohne Ufer kein See.
Allen missionarischen Bestrebungen ist der expansive Gleichmachungsdrang vorausgesetzt, obwohl die eingbildete Überlegenheit, die daran gebunden ist, auf die Ausmerzung des Beweisstückes, eben auf die Qualitätsunterlegenheit derer zielt, die es zu missionieren gilt. Aus dem ideellen Axiom der Rechtsgleichheit gleicher Wesen, wird eine physiologische Gleichheit aller abgeleitet und gefordert, was die Ungleichen ihrer Eigennatur berauben würde, wenn es möglich wäre, eine derart unnatürliche Wirklichkeit zu schaffen. Schon der Gedanke selbst ist utopisch, und ihn verwirklichen zu wollen vollends irreal, weil die Realität seine Abwegigkeit beweist.
Aber gerade utopische Sehnsüchte werden missionarisch verbreitet. Missionarische Bestrebungen sind Kennzeichen der Expansion des Eigenhorizontes. Sie gibt es auf jedem Niveau, sei es mit einem intellektuellen, einem religiösen oder einem atavistischen Horizont. Zu letzterem gehört der unsterbliche Wunderglaube. Ist er nicht gerade akut, so wacht er bisweilen aus seiner Latenz auf und wird überraschend lebendig, auch auf einem Bildungsniveau, wo man ihn am wenigsten vermuten würde. Dieser atavistische Wunderglaube gehört zu den Aktiven der Religionen. Das Phänomen stellt sich als ein immerwährender, unterschwelliger Konflikt mit der realen Gegenwart dar, in welchem sich das Individuum befindet, ohne die Natur dieses inneren Zwiespalts zu begreifen. Die Subjektivität kann sich nicht selbst objektivieren, weil sie das Organ der Selbsttätigkeit und der Vorgang selbst ist. Auf die Gefahr einer möglichen Missdeutung hin, sei die Analogie gewagt, den Einzelnen mit einem Tentakel zu vergleichen. Die Individuen bilden gewissermassen die Tentakel des sozialen Körpers (dem sozialen Inkreis) ihrer Zugehörigkeit, indem sie die Träger der Sinne sind, die dem Ganzen dienen. Hören, schmecken, riechen, tasten und ahnen sind körpergebunden. Sie werden zur Sinngebung des Seins aber erst durch den Austausch (Ekphorie) der Eindrücke (Engramme) aus ihren Funktionen. Der soziale Inkreis ist das konkrete Zentrum ihres Tuns, und in diesem Zusammenwirken, das eigentlich unbewusst verläuft, liegt der wirkliche Sinn . Es kann ins Bewusstsein treten wenn, beispielsweise, eine kollektive Gleichstimmung die Einzelbewusstheit aufschreckt oder verschreckt. In einem solchen Falle nimmt sie ihre Gliedhaftigkeit wahr. Sie leidet an diesem "im Allgemeinen verhaftet Sein" und erstrebt dann die singuläre Autonomie. Diese könnte sie durch eine Eingliederung in einen anderen sozialen Inkreis als Übergang auch empfinden, aber ihr Misslingen wird zur Vereinsamung und Depression. Die Expansion sozialaktiver Vorgaben kann in dieser Situation zum persönlichen Sendungsbewusstsein trasferieren, und macht dann aus dem Zweifler einen Missionar. Die Depression ist damit beseitigt. Prophetie, Intuition und Spontandiagnostik werden zur hellsichtigen Begabung (auch auf Zeit). Sie werden als paranormale Befähigungen angesehen, sind aber reale Phänomene, die sich rational durch die Natur der stereotypen Glieder von Verlaufsketten erklären lassen; andernfalls wären es keine realen Phänomene. Der Uexküllsche Funktionskreis bietet eine Grundlage zu deren Analyse. Stereotype Verlaufsreihen gliedern das tägliche Leben genau so wie das politische, beziehungsweise das gesellschaftliche Geschehen. Das lehrt auch die Geschichte. Vokabeln wechseln wie Namen, aber die Dynamik und das Muster dem sie gehorcht, sind immer dieselben. Das gilt bis hinein in die Anekdoten, die solche Glieder von Verlaufsketten festhalten.
So erzählte man sich 1948 in davon betroffenen Kreisen die Geschichte von Vater und Sohn, die aus Deutschland gekommen, in Palästina eingewandert waren und sich nun in einem Schützengraben fanden, aus dem auch nur den Kopf zu heben das endgültig letzte Abenteuer werden konnte, weil dies sofort eine wilde Schiesserei von der Gegenseite her auslöste. Nach einigen vergeblichen Versuchen die Position zu wechseln, fragte der Sohn schliesslich den Vater: "Abba, die Engländer, wenn sie uns schon müssen ein Land schenken, was ihnen nicht gehört, warum nicht die Schweiz?"
So weit, so schlecht. 50 Jahre später wurde die Schweiz, als einziges Land der Erde, vom jüdischen Weltkongress mit dem pressenden Gewicht seines Protektors, der einzigen oekonomischen wie militärischen Weltmacht USA, haftbar dafür gemacht, dass nicht alle Flüchtlinge vor der arisch- nationalsozialistischen Diktatur gerettet werden konnten. Das ist grotesk, zumal diese Folgegeschichte der Anekdote prophetische Qualität verleiht.
Um Geschichten, die das Leben schreibt, lesen zu können, braucht es die Kenntnis des entsprechenden Alphabets, und das Denken in Vorgängen erschliesst einen Zugang zur Tragikkomik des Seins.
Doch das sind Möglichkeiten die keinem aufgezwungen werden können, denn für derart Komik fehlt manchem das Organ. Mit Glossen ist also behutsam umzugehen, um niemandes Geltung herabzusetzen, denn Schlauheit wird bösartig wenn sie sich gekränkt fühlt, und wittert sie dann eine Denunziationsmöglichkeit, fädelt sie die kostspieligsten Rechtshändel ein.
TOCTOCSubstition und Umgruppierung
Es ist auch theoretisch leicht nachvollziehbar, wie die kollektive Gleichschaltung abläuft. Eindeutig muss der innersten Kernidentität die grösste Bedeutung zugestanden werden, denn dies ist ja die fühlende und handelnde Person selbst, und in ihrer Ausrichtung auf das Du bildet sie den innersten Intimkreis des Wir. Das Bindungsmotiv ist vor allem biologischer Natur, indem die Einzelexistenz zur Erhaltung der Gattung beitragen muss. Dazu dienen eine Reihe hormongesteuerter Empfindungen, von Gefühlen und Gemütszuständen, die auch Qualitäten einschliessen, welche nicht nur dem Zwecke der Paarung dienen, wie z.B. Sympathie und Antipathie, Aggressionsbereitschaft und Angst, Angstlust und Regression und anderes mehr. Solche Empfindungen sind auch in den weiter gefassten Sozialbindungen aktiv. Die Identifikation mit einem für das Selbstgefühl inhaltvollen Bindungsmotiv, geht über den engen Kreis der Nachwuchspflege hinaus, indem es Rang und Namen, Sicherheit und Selbstbestätigung ermöglicht. Die Bedeutung des gemeinsamen Motivs ist klar, also auch der Versuch, es auf seine Gültigkeit zu erproben, etwa mit der Kenntnis des Idioms, des Jargons, der Slangs und der Tagesparole (Passwort, Losung) an der Freund oder Feind (Inkreis oder Auskreis) erkennbar sind.
und anderes mehr. Solche Empfindungen sind auch in den weiter gefassten Sozialbindungen aktiv. Die Identifikation mit einem für das Selbstgefühl inhaltvollen Bindungsmotiv, geht über den engen Kreis der Nachwuchspflege hinaus, indem es Rang und Namen, Sicherheit und Selbstbestätigung ermöglicht. Die Bedeutung des gemeinsamen Motivs ist klar, also auch der Versuch, es auf seine Gültigkeit zu erproben, etwa mit der Kenntnis des Idioms, des Jargons, der Slangs und der Tagesparole (Passwort, Losung) an der Freund oder Feind (Inkreis oder Auskreis) erkennbar sind.
"Und der Wächter mit dem Speer, fragt nach der Parole,
und beim Haar entscheidet er, ob du koscher oder Pole!"
Ziel ist die Uniformität der Weltanschauung, und dies auch im Bekenntnis zu einer spezifischen Moral, wie beispielsweise zur Demokratie.
Die Bereiche der Gültigkeit solcher Bekenntnisse können dermassen ausgedehnt sein, dass sie nurmehr als ferne Abstrakta formal wirken. Hautnah werden sie nicht empfunden, aber als gültige Bezugswirkmale angenommen. Die sozialen Identitätskreise umschliessen die Bezirke ihrer Gültigkeit und schirmen damit den Inkreis vom Auskreis ab. Es gibt somit Interna, die nicht veräussert werden dürfen, um die Identität der betreffenden Personen nicht zu verletzen. Gewissermassen wird Intimwäsche nicht am öffentlichen Brunnen gewaschen! Mit Blossstellungen, bzw. Indiskretionen, werden die Grenzen der Identitätsbereiche durchbrochen.
Vom umgebenden Bereich der Anderen geht mit lauernder Insistenz eine Neugier aus, den Intimbereich geschlossener Identitäten zu knacken. Aufgegebene Vorbereiche zu den Wir-Bezirken entblössen das Selbstwertgefühl vom Verteidigungsglacis und legen die Ich-Du Intimität bloss. Der soziale zentripetale Druck auf das Ich-Du-Wir, gedeiht schliesslich zur Schamlosigkeit der zwischenmenschlichen Beziehungen. "Es lösen sich alle Bande frommer Scheu, das Gute räumt den Platz dem Bösen, und alle Laster walten frei!" so schilderte Friedrich Schiller den Zerfall einer Beziehungskultur.
den Zerfall einer Beziehungskultur.
Das Drängen auf öffentliche Bekenntnisse führt zur Substition und Umgruppierung. Der Blossgestellte sieht sich genötigt, seine Zugehörigkeit zur neuen Ethik zu bekunden, vorerst verbal und schliesslich im Tatbeweis. Mit diesem Mechanismus werden anstössige Regungen unkenntlich gemacht. Zum Beispiel wird die Aggression gegen jemanden ausgelebt, gegen den das Gefühl ursprünglich gar nicht gerichtet war, weil das ursprüngliche Objekt der Aggression nicht bekämpft werden kann. Auch werden Situationen provoziert, in denen man von andern angegriffen wird und sich nun seinerseits zur Wehr setzen kann, weil die ursprünglich aggressive Verhaltenstendenz unmöglich in die Tat umzusetzen gewesen wäre. Es kommt zu grausamen Taten, die ein Einzelner, ohne spezifische Verpflichtung gegenüber dem Kreis seiner Eingemeindung, nie begehen würde. Die Schlächtertrupps in Bosnien und dem Kosovo während des Nationalitätenkrieges der neunziger Jahre, legten in diesem Sinne Zeugnis ihrer Identitätsprobleme ab.
Mit der Uniformierung in grösserem Umfang und der territorialen Ausdehnung, wachsen auch das Machtpotential und die Ressourcen. Gleichzeitig verringert sich die Überschaubarkeit des Identitätsbereichs. Der Ansatz zur Bildung von Unter- und Kontrastgruppen wird also vielgliedrig. Denken wir an die Strukturwandlungen der Landkarte, deren Zeitzeugen wir waren und sind, dann fehlt es wahrlich nicht an Anschauungsmaterial. Der Zerfall der Sowjetunion erfolgte, abgesehen vom Tschetschenienkrieg, verhältnismässig unblutig, aber dennoch hart, voller Demütigungen und Kränkungen des Grösseanspruchs. Im Beispiel Jugoslawien setzte der Auflösungsprozess brutal ein, weil die an sich schon privilegierte Ethnie ihren Vorherrschaftsanspruch absolut verwirklichen wollte. Die Wiederbelebung der alten ethnisch-religiösen Identitätskreise forderte denn auch einen hohen Blutzoll .
.
Aus diesen Beispielen lässt sich schliessen, dass es vorbeugend klüger ist, sich in engeren Identitätskreisen zu bescheiden, und der Versuchung des Stolzes über die territoriale Grösse nicht zu erliegen, als einen solchen geschichtsträchtigen Ausflug in eine irreale Dimension später mit Blut abgelten zu müssen. Eingliederungen in einen übergeordneten Inkreis können in sehr verschiedener Weise statthaben. Zusammenarbeit findet am besten in gegenseitiger Respektierung zwischen verschiedenen Identitäten statt. Problematisch ist indessen die Auflösung kleinerer Identitätskreise durch die Gleichschaltung in einem grösseren Machtbereich. Die Alpenländer Schweiz und Österreich können uns als vergleichbare Positionen in Europa dienen. Es wäre weit hergeholt und falsch Österreichs "Heim ins Reich" von 1938 mit der Mitgliedschaft in einer in Entwicklung begriffenen Europäischen Union des neuen Jahrtausends gleich zu setzen, obwohl die politische Selbstbestimmung auch damit stark beschnitten wird. Positiv ausgedrückt ist das ein Anschluss zum Zwecke der Aufhebung nationaler Eingrenzung. Immerhin ist das Westeuropa Karls des Grossen
mit der Mitgliedschaft in einer in Entwicklung begriffenen Europäischen Union des neuen Jahrtausends gleich zu setzen, obwohl die politische Selbstbestimmung auch damit stark beschnitten wird. Positiv ausgedrückt ist das ein Anschluss zum Zwecke der Aufhebung nationaler Eingrenzung. Immerhin ist das Westeuropa Karls des Grossen ein früher Vorläufer einer vielsprachigen Reichseinheit, und das Neue Europa deshalb keine abstrakte, geschichtslose Illusion. An der Geschichte des Deutschen Reiches hatte Österreich seinen prägenden Anteil trotz den Auseinandersetzungen im neunzehnten Jahrhundert um die klein- oder grossdeutsche Lösung, die dann 1871 zur effektiven Scheidung zwischen dem preussisch dominierten Norden und dem habsburgischen Imperium führte.
ein früher Vorläufer einer vielsprachigen Reichseinheit, und das Neue Europa deshalb keine abstrakte, geschichtslose Illusion. An der Geschichte des Deutschen Reiches hatte Österreich seinen prägenden Anteil trotz den Auseinandersetzungen im neunzehnten Jahrhundert um die klein- oder grossdeutsche Lösung, die dann 1871 zur effektiven Scheidung zwischen dem preussisch dominierten Norden und dem habsburgischen Imperium führte.
Zum alten Reichsgebiet gehörte auch die Schweiz. Sie hatte sich 1499 im Frieden von Basel tatsächlich vom Deutschen Reich gelöst, aber erst das 1648 unterzeichnete Instrumentum Pacis, brachte auch die nominelle Herauslösung aus dem Deutschen Reiche. Vom Bundesbrief 1291, der den Willen zur Unabhängigkeit besiegelt, bis zur auch formalen Selbstständigkeit waren also 357 Jahre vergangen. Viele Kriege säumten diesen langen Weg, womit nicht gesagt ist, dass solche ausschliesslich der erstrebten Selbständigkeit wegen geführt wurden. Es waren auch einige dabei, die dem Machtbeweis dienten, und andere, in fremden Diensten dem Zwecke galten, das Kriegshandwerk als Verdienstquelle einzusetzen. Der Weg in die Abhängigkeit ist kurz. Gewöhnlich wird das Opfer eines Krieges dazu gezwungen. Schmerzhaft lang ist dahingegen der Weg der Loslösung aus einer Zwangsgemeinschaft, und dies nicht nur auf dem Balkan. Leichtfertig aufs Spiel setzen, was so kostbar ist, dass es auch Opfer rechtfertigt, wäre verantwortungslos und ohne Realitätssinn. Die anschlusseuphorische schweizerische Bundesratspolitik um die Jahrtausendwende hat den Makel einer Sehnsucht "Zurück ins Reich", welches freilich zu Europa gehört wie die Schweiz, auch wenn sie nicht annektiert ist. Die Politiker berufen sich eitel auf schreibende Eliten des "rationalen Defaitismus" der Nation, wie zum Beispiel Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Adolf Muschg , und weitere Berühmtheiten, die eigentlich nur bekundeten, dass sie (vielleicht) nachgedacht hatten, aber das gewiss ohne den Wert einer, wenn auch nur relativen, politischen Unabhängigkeit ihres Heimatlandes besonders hoch einzuschätzen. Jean Rudolf von Salis
, und weitere Berühmtheiten, die eigentlich nur bekundeten, dass sie (vielleicht) nachgedacht hatten, aber das gewiss ohne den Wert einer, wenn auch nur relativen, politischen Unabhängigkeit ihres Heimatlandes besonders hoch einzuschätzen. Jean Rudolf von Salis hätten wir nicht in die selbe Reihe stellen mögen, in der Annahme, dass seinen Lebensbekenntnissen die Kaltschnäuzigkeit der Wegwerfattitude alles Schweizerischen fehle, der wir sonst begegnen. In seiner Gesinnungsbeichte aber, spreizt er sich selbst auf einem Platz zwischen denen, die sich durch ihre Geringschätzung der Schweizerischen Selbständigkeit hervortun
hätten wir nicht in die selbe Reihe stellen mögen, in der Annahme, dass seinen Lebensbekenntnissen die Kaltschnäuzigkeit der Wegwerfattitude alles Schweizerischen fehle, der wir sonst begegnen. In seiner Gesinnungsbeichte aber, spreizt er sich selbst auf einem Platz zwischen denen, die sich durch ihre Geringschätzung der Schweizerischen Selbständigkeit hervortun . Für ihn war auch der Hitler-Stalin-Kampf keine Auseinandersetzung zwischen Rivalen gleichen Charakters, sondern eine Angelegenheit der Gesinnungstreue der Kommunisten, die darin den westalliierten Demokratien etwas voraus hatten
. Für ihn war auch der Hitler-Stalin-Kampf keine Auseinandersetzung zwischen Rivalen gleichen Charakters, sondern eine Angelegenheit der Gesinnungstreue der Kommunisten, die darin den westalliierten Demokratien etwas voraus hatten . Dass Belzebub nicht mit dem Teufel ausgetrieben werden kann, da sie ja identisch sind, sagte er nicht.
. Dass Belzebub nicht mit dem Teufel ausgetrieben werden kann, da sie ja identisch sind, sagte er nicht.
Die politische Wertverlagerung (Substition und Umgruppierung) ist ein gewöhnlicher Prozess des Uexküllschen Funktionskreises, indem die Attraktion vom Merkmal des Objekts ausgeht, und sich im Wirkmal auf das Objekt richtet. Es ist immer was man nicht hat, das Begehrlichkeit weckt, und was zur Genüge sättigte (quasi ein gastrischer Vorgang), das es auszuscheiden gilt. Das ist ein Phänomen besonderer Art. Als kostbar wird vor allem das scheinbar Erstrebenswerte eingeschätzt, aber nicht der Besitz eines (kostbaren) Gutes. Ein solcher gilt eher als Vermögen, das seinen Wert damit erweist, dass es veräussert, verschleudert, konsumiert werden kann. Man entledigt sich einer Last, wenn man sich von der Verantwortung für ein mühelos überkommenes Gut befreit.
Hüten wir uns vor Träumen von einem Grossreich Europa und seiner Macht, zu der wir dann beisteuern müssten.
Macht ist eine teuflische, romantische Grösse, verführerisch und kumuliert durch Zuschreibungen, verbraucht Energie zum Selbstzweck und funktioniert wie Kettenbriefe: Die Schulden tragen die Letztadressaten, deren Hoffnung auf Gewinn niemals mehr einlösbar ist.
In der Politik ist die unrealistische Erwartungshaltung von Ideologien Mutter der Katastrophen. Ideologien werden aber entwickelt, um als verbale Gleichschaltungsmotivationen zu Wirkmalen des Zusammenhalts zu werden. Sie ersetzen den natürlichen Zusammenhalt in Intimkreisen von Identitätsbereichen, und sind als Kulturprodukte Zeichen der formalen Instabilität menschlicher Instinktbindungen.
Soziale Schichtung ist ein Reizwort für Konformitätsbemühte, und immer ein wirksames Argument für nicht privilegierte, verhältnismässig zum Standard unterbezahlte Werktätige, mit dem das Recht eingefordert wird, gleich der anderen geachtet und bezahlt zu werden.
Um die Gleichstellung durch gleiche Voraussetzungen zu erreichen, entstehen Schulsysteme. Es sind die Konformierungsprogramme die damit gleichmachend wirken, und Schulbildung ist auch gleichzeitig eine Form der Indoktrinierung und Einschwörung auf ein gemeinsames Niveau.
Dies gilt besonders für alle Fakultäten der Geisteswissenschaften, wo der Freiraum am wenigsten durch exakte Daten und konkrete Fakten eingeschränkt ist. Gleichzeitig geniessen diese, in ihren Freiräumen der Meinungsmache auswuchernden Kulturexhibitionisten, das höchste Ansehen als Eliten, während den Jüngern der technischen und exakten Wissenschaften in der Bildungspyramide ein Nischendasein des Ansehens zugewiesen ist.
Volksgunst hält sich am Einfachen, und einfach scheinen eher frei fluktuierende Ideen mit ihrer hohen Fehlerquote die niemand misst, als Fachgebiete mit nachprüfbarem Lernstoff für hohen technischen Intelligenzstand, der bei einfachen Gemütern wenig verfügbar ist.
Die Kulturpyramide der sozialen Schichtung gehört zu den anschaulichsten Beispielen für die Bindungsdichte in den Bereichen der kollektiven Identität gemäss den Ausdehnungen ihrer Grenzen.
Der Mensch ist ein sozial bestimmtes Wesen. Ein organischer Aufbau seines Gemeinwesens ist durch die Gliederung seiner Empfindung vorgezeichnet, und nicht etwa durch Verwaltungsbezirke, die unter Umständen gar als Vergewaltigungssysteme empfunden werden. Realistisch sind dahingegen die Identifikationsbereiche, in welche das Individuum eingebunden ist; genauer gesagt: durch deren Wirkmal der Einbettung sich das Individuum als mit sich selbst identisch erfährt.
Ein schönes Beispiel eines solchen organischen Aufbaus bot bisher der Bundesstaat der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Die Gesamtheit der Eidgenossen wurde als der Souverän angesprochen, wobei sich jeder Miteidgenosse als Einzelner beachtet fühlte. Sein engstes Gemeinwesen war die Familie, die in der Burgergemeinde, bzw. im Patriziat, verwurzelt war. Der Heimatschein bestätigte die Zugehörigkeit zu seinem Bürgerort. Dieser genoss eine Autonomie, die der Bürger auch erleben und mitgestalten konnte. Diese Wir-Bezirke standen im Inkreis- Auskreisverhältnis dem Ihr-Bereich des als Staat definierten Heimatkantons gegenüber. Diese Heimatkantone bildeten erweiterte Wir-Bereiche, die sich im Verbund der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Inkreis-Auskreis-Verhältnis des Wir-Ihr gegenüberstanden, aber als nochmals erweiterter Wir-Bereich mit den anderen, besonders den Nachbarstaaten, konfrontiert waren. Das Verbindende an diesen Berührungslinien von innen nach aussen ist die "Begegnung", eine sehr wichtige, stimulierende Aktivität, die so lange das Selbstwertgefühl stärkt, wie sie nicht durch "Einvernahme", bzw. durch "Besitzergreifung" pervertiert wird. Diese Gliederung von unten nach oben, fand Wilhelm Röpke als menschengemässes Prinzip in der feinstrukturierten Schweiz realisiert, die durch einen Beitritt zu einem zentralistischen Europa Selbstmord begehen würde .
.
Bis zur Einführung der obligatorischen, zentralen Sozialversicherungen im Jahre 1948, bildete die Gemeindeautonomie auch die Grundlage für die Not-, Armen- und Altersrücksicherung. Die Heimatgemeinden garantierten im Bedarfsfalle ihre anderwärts lebenden Bürger zurückzunehmen oder, auf der Basis interkommunaler Verträge, vor Ort für sie aufzukommen. Bei Erwerb der Bürgerrechte hatte deshalb auch ein Bewerber eine Kaution (Einkaufsleistung) zu erbringen. Der soziale, sogenannte Fortschritt, war also die erste in die Bürgeridentität und die Gemeindeautonomie geschlagene Bresche.
Kennzeichnend für den Kulturwandel des zwanzigsten Jahrhunderts ist die in Gang gesetzte Zerschlagung der Familie als gesellschaftlich tragende Grundstruktur, mittels der Sozialgesetzgebung, die neue Vorsorgeabhängigkeiten schafft. Das Volk wird als Masse von Einzelpersonen behandelt, indem die körperschaftliche Gliederung in Zwischenstufen im Zentralismus verschwindet. Das staatliche Splitting der Altersvorsorge, die konkubinatsfördernde Einkommensbesteuerung von Paaren, die beabsichtigte Ablösung der Gemeindekompetenz bei Einbürgerungen und dergleichen mehr, bezeugen insgesamt, dass Röpkes Idealschweiz hingerichtet wird. Bislang war man Schweizer, weil man Bürger einer Schweizer Kommune (Gemeinde, Ortschaft) war, und damit auch eines Gliedstaates (Kantons), und erst dann ein Eidgenosse. Davon soll, nach dem Willen aller Anschlussenthusiasten, nichts mehr übrigbleiben.
Leider gewinnt der Zentralismus progressiv an Raum. Der Traum von uferloser Freiheit in zentral gelenkten, geographischen Grossräumen, ist eine Neoromantik, die im Gegensatz zur Wirklichkeit steht, wo die Freiheiten in zentralisistischen Grossräumen verloren gehen. Die Träumer haben noch nicht erfahren, dass Zentralbürokratismus Entmündigung der beteiligten soziologischen Inkreise bedeutet, und zur Entfremdung, zur Abkapselung, zu Misstrauen und Unmut mit impulsiven Selbstverteidigungsversuchen führt.
Die Schweiz befindet sich in einer kritische Phase. Die Anschlusseuphorie vieler Parteipolitaktivisten und schreibender "Eliten" ist ein Zeichen der Entfremdung aus ihrem emotionalen Wurzelgrund. Sie identifizieren sich nicht mehr mit ihrem Innenbereich. Sie geben intime Identität auf, um in das ozeanische Wirgefühl des "Grösseanpruchs" einzugehen. Ihr Leitwort "Regionalisierung" ist eine Verfremdung und meint eine Strategie zur Schaffung neuer Identitätsbereiche in einer Nation Europa. Das bedeutet die Auflösung alter Einheiten (Inkreise). "Eidgenossenschaft" böte damit fürderhin weder ein einigendes Symbol noch Motiv für ihre vier Ethnien.
Der Jurist Max Frenkel hat das Problem auf den Punkt gebracht. In seinem Beitrag: "Die Fahrt in die schöne, nicht mehr so neue Welt der Gebietsreform", stellt er fest:
hat das Problem auf den Punkt gebracht. In seinem Beitrag: "Die Fahrt in die schöne, nicht mehr so neue Welt der Gebietsreform", stellt er fest:
"Dienstleistungen können gekauft werden. Für Infrastrukturen wie etwa Spitäler, Hochschulen, Theater und so weiter kann sich ein kleiner Kanton einem grössern, eine kleinere Gemeinde einer grossen anschliessen. Nur Heimat kann nicht eingekauft werden, jedenfalls nicht kurzfristig (langfristig können wohl auch "Kunstgebilde" wie etwa Nordrhein-Westfalen zu Heimat
werden). Gebietsreformen nach technischen Zielen auszurichten – weil nur sie mit dem planerischen Rechenschieber erfasst werden können – ist ein gefährliches Spiel, weil es in einer Zeit, da der Mensch die Welt in besonderem Masse als verunsichernd erlebt, zur Destabilisierung mehr als zur Stabilisierung beiträgt. Die empirische Erfahrung mit Territorialreformen in Staaten, die solche in grösserem Umfang durchgeführt haben, ist gerade in dieser Beziehung ernüchternd: wenig erreicht und Wichtiges kaputtgemacht".
Es ist forschenden Sozialpsychologen nicht entgangen, dass Vorgänge, falls sie geordnet ablaufen, eben eine dieser Ordnung gemässe Struktur haben müssen. An sich gehört das Thema in den Problemkreis Gestalt und Gestaltswahrnehmung. Da die strukturierten Vorgänge Energieumsetzungen sind, können sie nicht als Gestalten gesehen, sondern eben nur als Abläufe einer bestimmten Ordnung, meist als Stereotypien wahrgenommen werden. Das ist der Grund, weshalb jede graphische Darstellung solcher Vorgänge abstrakt erscheint. Ihre Vergegenständlichung ist eben eine Übersetzung in den Bereich eines spezifischen, hier des optischen Sinnes.
In den Sozialbeziehungen ist das Rollenspiel entscheidend und hat als solches eben seine naturgegeben zweckgerichtete Ordnung. Das ist unter anderen auch von Mills und Henry
und Henry untersucht worden, die sich mit ihren Studien auf Georg Simmel
untersucht worden, die sich mit ihren Studien auf Georg Simmel beziehen. Affekt, Interaktion und Delinquenz, in dieser Reihe erwähnt, weisen bereits auf die Struktur einer Funktion, die auch gesellschaftspolitisch grosse Bedeutung und Tragweite hat.
beziehen. Affekt, Interaktion und Delinquenz, in dieser Reihe erwähnt, weisen bereits auf die Struktur einer Funktion, die auch gesellschaftspolitisch grosse Bedeutung und Tragweite hat.
Die Tatsache, dass die Beschaffenheit des Erlebens bis auf in der Umgebung lebende Bestandteile festgelegt ist, erfahren wir durch eine Innenwelt, die erblich zum Ganzen eines Organismus gehört. Nicht die allmähliche Erfahrung, sondern vorgegebene "Gewissheiten" bestimmen das Erleben und bilden aus der indifferenten Umgebung jene spezifische Struktur, die J.v. Uexküll "Umwelt" nannte.
"Umwelt" nannte.
Wir müssen annehmen, dass unser Nervensystem viele vorgebildete Strukturen enthält. Den Nachweis der erblichen Strukturelemente im Erkennen des menschlichen Gesichts, haben die Untersuchungen von E. Kaila wie auch von R. Spitzund K.M. Wolf
wie auch von R. Spitzund K.M. Wolf erbracht. Dass das menschliche Gesicht ein komplexes, wichtiges Faktum in der Psyche des Neugeborenen ist, scheint mir unbestreitbar. Bestimmte Gestaltmerkmale sind nachweislich vorgegeben. Sie haben positive Wertigkeit, also Bedeutung, und sind damit Auslöser für Reaktionen, die auf deren Erscheinen warten. Solche positiven Reaktionen drücken Lustgefühle aus, und sind in ihrer Bedeutung lebenswichtig.
erbracht. Dass das menschliche Gesicht ein komplexes, wichtiges Faktum in der Psyche des Neugeborenen ist, scheint mir unbestreitbar. Bestimmte Gestaltmerkmale sind nachweislich vorgegeben. Sie haben positive Wertigkeit, also Bedeutung, und sind damit Auslöser für Reaktionen, die auf deren Erscheinen warten. Solche positiven Reaktionen drücken Lustgefühle aus, und sind in ihrer Bedeutung lebenswichtig.
Die Instinktforschung bestätigte Immanuel Kants These, dass Anschauungsformen vorgegeben seien, präzisierte aber, dass sie als Funktionen stammesgeschichtlichen Ursprungs sind. Hierbei haben einige stammesgeschichtlich entstandene artspezifische Erwartungshaltungen die Bedeutung von immediat einsetzenden und ablaufenden Reflexen. Ein solches Beispiel ist mit der Faszination und Fangreaktion
These, dass Anschauungsformen vorgegeben seien, präzisierte aber, dass sie als Funktionen stammesgeschichtlichen Ursprungs sind. Hierbei haben einige stammesgeschichtlich entstandene artspezifische Erwartungshaltungen die Bedeutung von immediat einsetzenden und ablaufenden Reflexen. Ein solches Beispiel ist mit der Faszination und Fangreaktion gegeben.
gegeben.
Zu beobachten ist der Mechanismus beim Rivalenkampf, der unabhängig vom evolutionären Niveau bei allen Lebewesen stattfindet. Wir kennen die regierende Schlüsselbedeutung dieses treibenden Motors von den Fangspielen her, die durchaus nicht nur von den Kindern geübt werden. Die Spiele haben einen existentiellen Sinn und können unerfüllte und unerfüllbare Erwartungen ersetzen. Sie treten als Kompensationshandlungen ausgebliebener Wunscherfüllung auf und funktionieren so auch als Übersprung.
Der Greifreflex ist ein Wirkmal der durch Merkmale ausgelöst wird, die im biologischen Konzept des Seins angelegt sind. Selbst recht banale Ereignisse können als Muster dienen. Beispielsweise erweckt das Entschwinden eines Objekts Aufmerksamkeit. Der Vorgang hat Signalwirkung und löst den Reflex aus, das Entschwindende oder Rarwerdende zu halten, zu fangen, zu ergreifen.
Was rar wird, wirkt durch dieses Werden werterhöhend. Überfluss hingegen wirkt sättigend bis abstossend, öd und widerlich. Im Paarungsverhalten sind das Schlüsselsituationen. Der flüchtende Jüngling reizt, ihn zu fangen, der abgewiesene Freier ist darauf versessen, die Treulose zu behalten.
Entzug erhöht den Reizwert. Das wird mental auch zum zentralen Problem der Suchten und anderen Hörigkeiten.
Gewöhnlich brauchen wir zur Vorstellung eines Tatbestandes oder Gegenstandes Begriffe, die Gegenständliches meinen, während wir erleben, wie Geschehnisse ablaufen. Wir denken vornehmlich, indem wir Bestände zueinander beziehen, obwohl wir auch in Vorgangssequenzen denken könnten, wie wir sie erleben. Wir denken gewissermassen in Zahlen, während uns die Funktionen mathematischer Ordnung, abstrakte Wissenschaft scheinen, obschon wir wissen, dass die Vorgänge tiefere Einsicht erschliessen, und die Festpunkte in Ziffern und Zahlen lediglich nützliche Kontrollposten sind. Wir denken also in Begriffen , nehmen die Begriffe als das Wesentliche, und benützen das Denken, um den Begriffen durch Positionierung und Umfang Bedeutung zu verleihen. Wir lassen den Vorgang zum Diener des Produktes werden, ohne dessen inne zu werden, dass die Produkte als Festpunkte in den Vorgangssystemen dienen.So installieren und werten wir auch Obrigkeiten, und schlüsseln die dynamischen Systeme nicht auf, deren Produkte die Obrigkeiten sind. Wir glauben an die Verführer der Massen und sehen nicht, dass die Führer aus der Masse kommen, also Produkte kollektiver Vorgänge sind. Dies ist bedeutsam und zwar nicht nur in politischen Denkkategorien, sondern auch für die Sozialpsychologie wie für die dynamischen Aspekte der Psychiatrie, denn darin ist die Phänomenologie der Intimität und Identität enthalten, mit der schliesslich die Subjektivität definiert ist, die der Objektivität, also dem objektiven, sinnlichen Wahrnehmen, gegenübersteht. In dieser Weise ist das Subjekt zur Objektivität (das heisst dem sinnlichen Wahrnehmen einer Beziehungswelt) befähigt. Ich bin mir nicht selbst das objektiv Wahrgenommene, sondern bin das Subjekt, das objektiv wahrnehmen kann.
, nehmen die Begriffe als das Wesentliche, und benützen das Denken, um den Begriffen durch Positionierung und Umfang Bedeutung zu verleihen. Wir lassen den Vorgang zum Diener des Produktes werden, ohne dessen inne zu werden, dass die Produkte als Festpunkte in den Vorgangssystemen dienen.So installieren und werten wir auch Obrigkeiten, und schlüsseln die dynamischen Systeme nicht auf, deren Produkte die Obrigkeiten sind. Wir glauben an die Verführer der Massen und sehen nicht, dass die Führer aus der Masse kommen, also Produkte kollektiver Vorgänge sind. Dies ist bedeutsam und zwar nicht nur in politischen Denkkategorien, sondern auch für die Sozialpsychologie wie für die dynamischen Aspekte der Psychiatrie, denn darin ist die Phänomenologie der Intimität und Identität enthalten, mit der schliesslich die Subjektivität definiert ist, die der Objektivität, also dem objektiven, sinnlichen Wahrnehmen, gegenübersteht. In dieser Weise ist das Subjekt zur Objektivität (das heisst dem sinnlichen Wahrnehmen einer Beziehungswelt) befähigt. Ich bin mir nicht selbst das objektiv Wahrgenommene, sondern bin das Subjekt, das objektiv wahrnehmen kann.
Dazu gehört eine natürliche Gegenständiglichkeit, eine Körperlichkeit, die Vorgänge zur Selbsterfahrung und dem Selbsterhalt sinnvoll macht. Die Sinngebung der lebendigen Gegenständlichkeit ergibt sich aus den innewohnenden Vorgängen. Die biologische Grundlage zu dieser Interpretation hat Jakob Johann von Uexküll aufgedeckt.
aufgedeckt.
Organismus und Umwelt bedingen sich wechselseitig. Das Subjekt ist nicht autark, es ist gewissermassen eine Einschaltung in sein Umfeld. Was es merkt, wird zu seiner Merkwelt, was es wirkt, zu seiner Wirkwelt; beides bildet eine geschlossene, subjektive Einheit. Die subjektiven Besonderheiten sind in der Auswahl von Reizen gegeben, welche die Rezeptoren passieren lassen, und von der Anordnung der Muskeln bestimmt, die den Effektoren angemessene Betätigungsmöglichkeiten verleihen, wobei vor allem die Zahl der Merkzellen, welche mittels der Zahl und Anordnung der Wirkzellen, die mit ihren Wirkzeichen die gleichen Objekte mit Wirkmalen versehen, den Vorgang bestimmt. Das Objekt ist dabei lediglich einerseits Träger der Merkmale und andrerseits Träger der Wirkmale. Die bestimmende Dynamik stellt sich somit als Funktionskreis dar. Nach Karl Jaspers entstehen die wirklichen Leistungen in einer fortgesetzten, kreisartigen Verbundenheit von Organismus und Umwelt, Umwelt und Organismus, aber immer bestimmt auch der Organismus was von der Umwelt auf ihn einwirkt und immer die Umwelt, was vom Organismus erregt wird.
entstehen die wirklichen Leistungen in einer fortgesetzten, kreisartigen Verbundenheit von Organismus und Umwelt, Umwelt und Organismus, aber immer bestimmt auch der Organismus was von der Umwelt auf ihn einwirkt und immer die Umwelt, was vom Organismus erregt wird.
Funktionskreis des Erlebens gemäss J.J. von Uexküll:
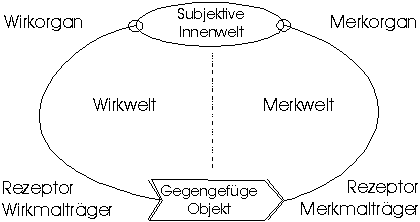
Der Mensch objektiviert seine Lust durch Personifikationen oder an Symbolen. Seine Emotionen sind ein Phänomen der Dynamik, registrierbar durch ihre ständige Wandlung. Die Kausalkette der Transformation einer Gemütsregung stellt sich wie folgt dar:
Die Ausgangslage ist durch Appetenz gegeben, das heisst durch das Verlangen, ein elementares Bedürfnis zu befriedigen. Vom Verlauf bis zur Verwirklichung kennen wir zwei Aspekte, einmal die objektive Wahrnehmung (Merkmal), und zum andern die Empfindung (Wirkmal). Von jeder Dynamik kennen wir den Beginn oder den Eintritt in die Funktion, die Umsetzung in die Befriedigung, und die Rückkehr in die Latenz.
Die Phasen sind durch Spannungsschwankungen der subcorticalen elektrischen Potentiale neurometrisch messbar
 . Indifferenz und Vorappetenz liegen im -Bereich von 8-13 Hz (Hertz); die Aktivierung der Appetenz zur Faszination zum Glücksempfinden sind im -Bereich von 13-40 Hz, während Indifferenz und Psychopassivität im -Bereich von 4-8 Hz liegen können. (Der -Bereich unter 4 Hz ist bereits Komazone bis Verlöschen).
. Indifferenz und Vorappetenz liegen im -Bereich von 8-13 Hz (Hertz); die Aktivierung der Appetenz zur Faszination zum Glücksempfinden sind im -Bereich von 13-40 Hz, während Indifferenz und Psychopassivität im -Bereich von 4-8 Hz liegen können. (Der -Bereich unter 4 Hz ist bereits Komazone bis Verlöschen).
Psychopassive – psychoaktive Verlaufsform :
:
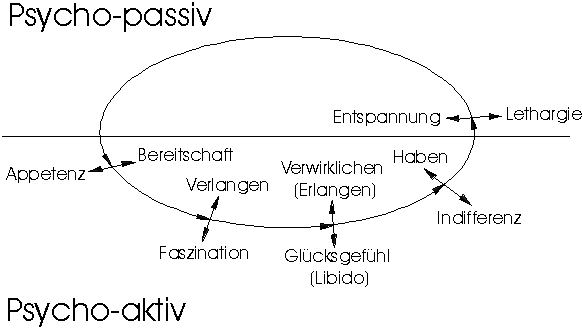
 auch vom Kind, das aus seinem pränatalen mütterlichen Uterus, in seinen Sozialuterus hineingeboren wird. Portmann beruft sich dabei auf den Zerebralisationsindex, demzufolge der Mensch, im Vergleich zu allen anderen höheren Säugern, eine Tragzeit von 21 Monaten durchlaufen müsste, um die nötige Ausformung seines zerebralen Systems bis zur Geburtsreife zu erfahren.
auch vom Kind, das aus seinem pränatalen mütterlichen Uterus, in seinen Sozialuterus hineingeboren wird. Portmann beruft sich dabei auf den Zerebralisationsindex, demzufolge der Mensch, im Vergleich zu allen anderen höheren Säugern, eine Tragzeit von 21 Monaten durchlaufen müsste, um die nötige Ausformung seines zerebralen Systems bis zur Geburtsreife zu erfahren.Die uterale Sozialbeziehung ist als Wechselwirkung von Offerte und Anspruch zu sehen. Eine solche Funktion wird in sich selbst tripolar, indem das Es Ansprüche stellt und Leistungen offeriert. Es stellt den Anspruch auf positiven Affekt und offeriert solchen, bei gleichzeitiger Abfuhr negativen Affekts und Erwartung eines solchen. Die Positionen können nach Massgabe veränderter Situationen wechseln.
Dieses Spielschema bestimmt, wo die Peripherie des Inkreises verläuft. Ziel und Erwartung von negativen Affekten liegt im berührenden Auskreis, während Offerte und Anspruch von positiven Affekten im engsten Binnenkreis angelegt ist. Damit sind Divergenzobjektivationen durch das Du möglich. Es kann unter gewissen Umständen zum soziologischen Auskreis gehören.
Inkreis – Auskreis – Funktion :
:
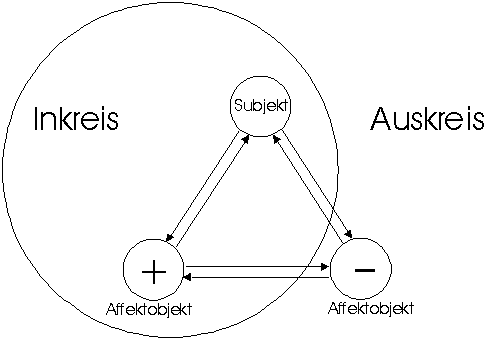
Die Inkreis-Auskreis-Funktion ist durch die Triade der Interaktionsdynamik illustriert. Diese ist der Wirkmechanismus im Beziehungsfeld der Identitäts-Intimitätsbereiche. Die bindenen Motive, das heisst die meist in Symbolen gebundenen Gemütsausrichtungen, grenzen den soziologischen Inkreis von den Auskreisen ab, und sind potentielle Konfliktlinien, wenn an diesen Berührungslinien keine Begegnungen erfolgen. Begegnung heisst auch Austausch von faszinierenden Beweggründen, denen etwas Fremdheit anhaftet. Sie hat damit den Wert, anderes als das gewöhnliche, banale, monotone Gleichmass des immer schon Gewesenen zu bieten. Es kommt gerade dieser Grenze zwischen Innen und Aussen der belebende, motivierende, und Neugier befriedigende Sinn der Existenz zu, und vor allem die glückhafte Zufriedenheit nach jeder erfolgreichen Entdeckung.
Wird die Möglichkeit der Begegnung durch erzwungene Konformität eingeschränkt oder gar verunmöglicht, entstehen an diesen Berührungslinien Feindschaft statt Neugier und Aggression anstelle fruchtbarer Belebung.
Bereiche der Bindungsdichte kollektiver Identität :
:
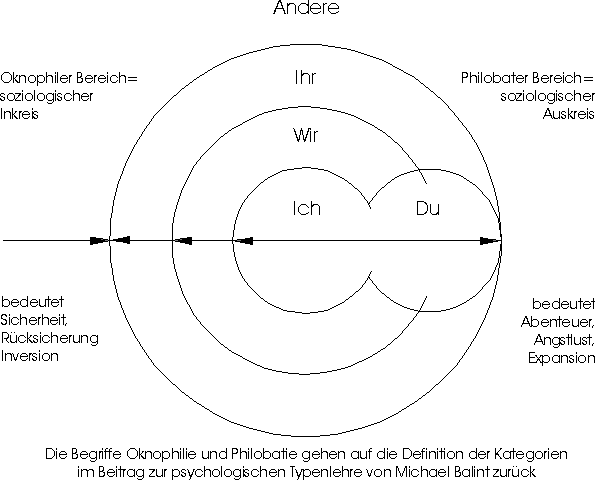
Der Ich-Du-Übergang in das Wir des gemeinen Plurals ist kennzeichnend für die soziale Interdipendenz. Einerseits besteht die zentripetale Verankerung im Einzeldasein, andrerseits ist die Beweglichkeit der sozialen Interessen zentrifugal. Dabei beeindruckt die Paarbildung als ein natürlicher Akt des Fortbestandes über die Einzelexistenz hinaus, sei es nun in Freundschaft oder Ehe. Das drückt sich sprachlich aus. Einige der indogermanischen Sprachen, darunter besonders das Griechische, kannten einen Paar-orientierten Plural neben dem allgemeinen. Die germanische Grundsprache, der das Gotische sehr nahe kommt, führte in der ersten und zweiten Person des Personalpronomens neben Singular und Plural, als dritten Numerus den Dualis. Gotisches Beispiel: weis = wir; wit = wir beide;
iszwis = euch; igqis = euch beide(n). Desgleichen war auch im Isländischen der Dualis bei den Pronomina vom gewöhnlichen Plural unterschieden. Beispiel: vér = wir; vit = wir beide . Relikte des Dualis gab es auch im Altenglischen und später noch, bis in die Neuzeit hinein, im Bayerischen und im Südost- bzw. Südwestjiddischen.
. Relikte des Dualis gab es auch im Altenglischen und später noch, bis in die Neuzeit hinein, im Bayerischen und im Südost- bzw. Südwestjiddischen.
Es kann angenommen werden, dass der Dualis aus dem Sprachgebrauch verschwand, als sich eine bedeutende Veränderung des ethischen Umfeldes ergab. Solche Entwicklungen einer Umgangssprache gehen so vor sich, wie sich soziale Umorientierungen ergeben. Die grossräumigen Wanderbewegungen, beispielsweise der Goten, zergliedert in autonome Einzelstämme, die von Skandinavien, ins untere Weichselgebiet und dann über die Ukraine, die Krim, den Balkan, Griechenland, Italien, Nordafrika, wie Südfrankreich und Spanien zogen und ihre Reiche gründeten, sich mehr oder weniger mit den dort sesshaft gewesenen Völkern mischten oder sie einfach beherrschten, sind nicht nur geographisch beeindruckend. Für die germanische Sprachgeschichte ist das Gotische eine wichtige Quelle, denn seine Dialekte blieben konservativ als Sprachen von noblen Minderheiten in wechselnden Umfeldern während Generationen erhalten, auf der Krim bis ins 16. Jahrhundert hinein. Eine der bedeutendsten ethischen Neuausrichtungen der germanischen Stammesfamilien, entwickelte sich mit der stetig um sich greifenden Christianisierung. Wulfila (Ulfilas 311-383 u. Zt) übersetzte bereits die Bibel in eine gotische Schrift, die aus Buchstaben des griechischen und des lateinischen Alphabets, ergänzt mit Runenzeichen, gebildet war. Wulfilas Bibel wurde auch von den Ostgoten in Italien wie den Westgoten in Spanien und den Wandalen in Nordafrika übernommen. Es war eine Zeit wechselnder ethnischer Vorherrschaften, von Eroberungen und Versklavungen der Besiegten. Alte gesellschaftliche Strukturen wurden jeweilen durch die neuen Herrscher zerschlagen und die Sitten neu bestimmt. Das allmähliche Verschwinden des Dualplurals aus den germanischen Idiomen folgte, (aber nicht zwingend), der Christianisierung. Diese erstreckte sich im Süden vom 4. bis in das 8. Jahrhundert, und im Norden (Baltikum) bis in das 11. Jahrhundert hinein. Es veränderten sich die sozialen Identitätsgrenzen. Die engste, auf Zweisamkeit gerichtete, büsste an Wichtigkeit ein, indem sie in einen anderen Kontext gestellt wurde. Sie ging im allgemeinen Wir des gemeinsamen (Glaubens-)Bekenntnisses auf. Der freundschaftliche Intimbereich wurde im Bekenntnisplural integriert, seine engere, egozentrierte Eingrenzung gelockert. Das ist so denkbar, und diese These würde erlauben, eines der vielen (anders kaum deutbaren) Rätsel von punktuellen Sprachentwicklungen zu lösen, wenn die Frage nach dem Grund überhaupt gestellt würde. Vielleicht aber handelt es sich auch nur um eine allgemeine Un-bildung, um eine Faulheit bezüglich des gepflegten Sprachgebrauchs. Jedenfalls wurde die Bindungsdichte des sozialen Zusammenhalts aufgeschlossen, so dass das Du, aus seiner besonderen, subjektiv betonten Ich-Du-Bindung (Paarbindung) entlassen und, je nach Sachlage, zum allgemeinen Wir, zum Ihr, oder gar zu Ihnen, den anderen im äusseren sozialen Auskreis, zählen konnte.
wurde auch von den Ostgoten in Italien wie den Westgoten in Spanien und den Wandalen in Nordafrika übernommen. Es war eine Zeit wechselnder ethnischer Vorherrschaften, von Eroberungen und Versklavungen der Besiegten. Alte gesellschaftliche Strukturen wurden jeweilen durch die neuen Herrscher zerschlagen und die Sitten neu bestimmt. Das allmähliche Verschwinden des Dualplurals aus den germanischen Idiomen folgte, (aber nicht zwingend), der Christianisierung. Diese erstreckte sich im Süden vom 4. bis in das 8. Jahrhundert, und im Norden (Baltikum) bis in das 11. Jahrhundert hinein. Es veränderten sich die sozialen Identitätsgrenzen. Die engste, auf Zweisamkeit gerichtete, büsste an Wichtigkeit ein, indem sie in einen anderen Kontext gestellt wurde. Sie ging im allgemeinen Wir des gemeinsamen (Glaubens-)Bekenntnisses auf. Der freundschaftliche Intimbereich wurde im Bekenntnisplural integriert, seine engere, egozentrierte Eingrenzung gelockert. Das ist so denkbar, und diese These würde erlauben, eines der vielen (anders kaum deutbaren) Rätsel von punktuellen Sprachentwicklungen zu lösen, wenn die Frage nach dem Grund überhaupt gestellt würde. Vielleicht aber handelt es sich auch nur um eine allgemeine Un-bildung, um eine Faulheit bezüglich des gepflegten Sprachgebrauchs. Jedenfalls wurde die Bindungsdichte des sozialen Zusammenhalts aufgeschlossen, so dass das Du, aus seiner besonderen, subjektiv betonten Ich-Du-Bindung (Paarbindung) entlassen und, je nach Sachlage, zum allgemeinen Wir, zum Ihr, oder gar zu Ihnen, den anderen im äusseren sozialen Auskreis, zählen konnte.
Es wäre weltfremd, solche Zusammenhänge von der psychologischen Forschung auszunehmen. Die Geschichte der Sprachangleichungen sagt auch immer etwas über die soziale Befindlichkeit aus, weil Sprache das Instrument der zwischenmenschlichen Mitteilungen ist, das die Leute verbinden oder trennen kann. Sie offenbart Kultur und die Qualität des Selbstbewusstseins auf jeder Ebene der Sozialbeziehungen.
TOCWahrheit
Die Menschen können nicht sagen, wie sich eine Sache zugetragen, sondern nur, wie sie meinen, dass sie sich zugetragen hätte.
Georg Christoph Lichtenberg
Wer erinnert sich nicht eines Streitgespräches über einen Tatbestand (z.B. Verkehrsunfall), den verschiedene Leute aus verschiedenen Richtungen verfolgt hatten, aber sich dennoch nicht über den wirklichen Hergang einig werden konnten? Wessen ist in einem solchen Fall die Wahrheit? Eines Jeden! denn die Zeugenschaft ist bedingt durch verschiedene Faktoren wie Richtung, Perspektive, Beleuchtung, Abstand, Zeit, Stimmung, Dynamik, Voreingenommenheit, Menge und Positionen der einzelnen Beobachter. Dass sich daraus verschiedene, also bedingte Wahrheiten ergeben, sollte einleuchten. Bei aufmerksamer Überprüfung eigener Erinnerungen stellt sich heraus, dass selbst diese auf die Dauer Angleichungsprozessen unterliegen. Dieses Phänomen ist durch Experimente von Piagetund Inheldermit ihrer Arbeit über Gedächtnis und Intelligenz als Nebenergebnis hervorgegangen. Engramme sind auch nur so lange abrufbar, wie sie lebendig sind, und leben heisst auch, durch Angleichung an sich stetig ändernde Bedingungen am Leben bleiben.
als Nebenergebnis hervorgegangen. Engramme sind auch nur so lange abrufbar, wie sie lebendig sind, und leben heisst auch, durch Angleichung an sich stetig ändernde Bedingungen am Leben bleiben.
Es ist erstaunlich wie sehr die Erinnerungen verschiedener Personen, bezüglich eines gemeinsamen Erlebnisses, durch die Zeit sich voneinander entfernen können. Bei der Wiederbelebung alter Engramme erfolgt, bei günstigen Bedingungen, durch Austausch eine Riverifikation, eine Angleichung der Gesichtspunkte, indem die verschiedenen Entwicklungswege der Beteiligten berücksichtigt und relativiert werden. So finden dann, beispielsweise verstreut gewesene Familienmitglieder, wieder zueinander. Gibt es diese angleichenden Gespräche nicht, so konserviert sich ein Streitpotential mit dem Risiko des Zerfalls der Familie als einem überholten sozialen Inkreis. Die gemeinsame Wirtschaftsbasis wird zerstört. Diese Dimension von Erbstreitgkeiten dürfte allgemein bekannt sein. Das illustriert ein Geschwätz zwischen Freunden. Der eine versucht den anderen versöhnlich zu stimmen, indem er dessen Bruder als feinen Charakter lobt, worauf er zur Antwort bekommt: "Hast du schon einmal mit ihm geerbt?"
Die Wahrheit bleibt offen. Darauf beruht die Wirksamkeit der Demagogie. Beispiele lassen auch Unterschiede erkennen. Gruppengespräche sind in verschiedenen Formen modern geworden, von den alten Vereinen und Stammtischen, von Selbsthilfegemeinschaften, Gruppentherapien, bis hin zur Arena-Exposition. Die meisten solcher Gesprächsvereinigungen dienen der Indoktrinierung. Dazu gehören auch die Therapiegruppen. Balintgruppen offerieren die Klärung bei berufsinternen Problemfällen, etwa so, (um auch eine antike Form solcher Kollegien zu erwähnen) wie die Rabbinergespräche die in der Gemarades Talmud
offerieren die Klärung bei berufsinternen Problemfällen, etwa so, (um auch eine antike Form solcher Kollegien zu erwähnen) wie die Rabbinergespräche die in der Gemarades Talmud protokolliert sind; aber auch sie dienen im Endeffekt der Gleichstimmung von Interpretationen und Diagnosen. Die Streitereien der öffentlichen, durch das Fernsehen verbreiteten, arenamanischen Exhibitionen, gleichen dahingegen den von jeweilen einem Chefdegrimasseinszenierten Hahnenkämpfen, die zum Ziele haben, dass zum Gaudium des Publikums, einer auf der Strecke bleibt. Versuche mit Hilfe solcher Anlässe Meinungsverschiedenheiten auszuräumen gab es ebenfalls, aber solche sind, mangels Einschaltquoten, eingeschlafen. Es fehlte offensichtlich die Spannung, die durch die Polarisierung zwischen Sieger und Besiegte entsteht. So kam der schadenfreudige Voyeurismus zu kurz.
protokolliert sind; aber auch sie dienen im Endeffekt der Gleichstimmung von Interpretationen und Diagnosen. Die Streitereien der öffentlichen, durch das Fernsehen verbreiteten, arenamanischen Exhibitionen, gleichen dahingegen den von jeweilen einem Chefdegrimasseinszenierten Hahnenkämpfen, die zum Ziele haben, dass zum Gaudium des Publikums, einer auf der Strecke bleibt. Versuche mit Hilfe solcher Anlässe Meinungsverschiedenheiten auszuräumen gab es ebenfalls, aber solche sind, mangels Einschaltquoten, eingeschlafen. Es fehlte offensichtlich die Spannung, die durch die Polarisierung zwischen Sieger und Besiegte entsteht. So kam der schadenfreudige Voyeurismus zu kurz.
Wahrheit ist Eigentum der Parteien, und ausgerufene Wahrheiten sind generisch parteiisch. Wahrheit wird verkündet, ihre Diktion für verbindlich erklärt und der Glaube daran gesetzlich befohlen. Deutlicher ist kaum darstellbar, wie zerbrechlich und unsicher das Gebilde ist.
Wahrheit ist also die Kunst der Jargonfindung oder das Diktat des Meinungsdirigismus. Sie ist aber auch eine Sehnsucht der Gläubigen, die sich nach der Gewissheit des Wahrhaftigen sehnen, und sie ist auch ein Spielball der Demagogie. Als subjektives Faktum bleibt Wahrheit objektiv stets ein offenes Phänomen der Sprachregelung von Übereinkünften über die Gültigkeit von Gesichtspunkten. Die Maxime von der einen, nur einzig möglichen Wahrheit, ist ein Ausgangspunkt für den Mysterienglauben und auch für die Recht-Setzung und damit ein Problem der Rechtswissenschaft. Es geht um die Frage, wie die Realität des dauernd gleitend Angepassten der Wahrnehmung überlistet werden kann. Die Wandelbarkeit ist das grosse Problem der Festschreibung deren es bedarf, um Mass zu setzen.
Es heisst, Wahrheit sei die Übereinstimmung eines Satzes mit den Tatsachen. Das Problem der unterschiedlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten jeder einzelnen Tatsache, bleibt bei solcher Definition ausgespart. Sie eignet sich allenfalls dazu, eine Unterscheidung zur Richtigkeit zu treffen, worunter die formale Gültigkeit eines Satzes zu verstehen wäre. Was Wahrheit eigentlich sei, das ist in der Philosophiegeschichte ein latent vorhandenes, oft offenes Definitionsproblem. Allein das bedeutet bereits, dass es die eine, unumstössliche Wahrheit nicht gibt, nach welcher ja immer gesucht wird, und statt sie zu finden, nur Behauptungen gegen Behauptungen ins Feld geführt werden. Gemäss der antiken Adäquationstheorie sei Wahrheit ein Prädikat, das einer Aussage dann zukommt, wenn der behauptete Sachverhalt besteht. Damit bleibt offen, ob es verschiedene Behauptungen zu ein und demselben Sachverhalt geben kann, dem dieselben entsprechen, womit es zum gleichen Sachverhalt, gemäss veränderter Perspektiven, verschiedene Wahrheiten gäbe. Dieser ungewissen Wahrheit begegnet die Kohärenztheorie mit der Anforderung, dass sie ein notwendiges Glied eines systemisch zusammenhängenden Ganzen von Urteilen zu sein habe. Damit ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass es auch unwahre, in sich zusammenhängende Systeme geben kann, die dann als Ganzes eine, gewissermassen virtuelle Wahrheit bilden würden. Wird Wahrheit am Wert seiner Bewährung in der Wissenschaft und im Leben gemessen, was der Pragmatismus verlangt, so würde jede Wahrheit aufgehoben, sobald einzelne Bedingungen von Systemen ihre Wertigkeit änderten. Die objektivistische Wahrheitstheorie bindet die Wertung an die Angemessenheit einer Seinswahrnehmung, was in letzter Konsequenz natürlich auch Sinnestäuschungen in den Wahrheitsbeweis einbezöge.
Alle diese philosophischen Bemühungen Wahrheit zu fassen, sind also nicht so endgültig, dass sie jede weitere Diskussion um ihre Gültigkeit ausschlössen. So ist es vielleicht hilfreich, dem etymologischen Werdegang des Begriffes nachzugehen.
des Begriffes nachzugehen.
Das althochdeutsche Adjektiv war entspricht dem lateinischen verus.
Diese Wörter haben den Sinn von "vertrauenswert" und gehören zur indogermanischen Wurzel uer, was "Gunst und Freundlichkeit erweisen" bedeutet.
Dazu gehört auch griechisch = era pherein = "einen Gefallen tun", und auch die slawische Sippe des russischen vera = "Glaube", wie auch das mittelhochdeutsche wara = "Treue, Vertrag".
Der Begriff Wahrheit bezieht sich somit in seinem wesentlichen Kerninhalt auf das Sozialsystem, auf das Wesen des Miteinander, auf die Art des Umgangs und legt dar, dass Wahrheit so etwas wie eine in einem sozialen Inkreis gültige Vereinbarung ist, auf der die gleichgeschalteten Wahrnehmungen beruhen. Und damit wird die Sache besonders interessant: Wenn die Wahrnehmung unbestritten ist, kennzeichnet sie die Geschlossenheit des Inkreises, wird diese Geschlossenheit des Inkreises dahingegen gelöst, zerfällt auch der Wahrheitsgehalt.
Wahrheit polarisiert, wenn an verschiedenen Gesichtspunkten zu einem Faktum festgehalten wird. Die Angleichung der Streitpunkte aneinander setzt ein Klima des Vertrautseins voraus, das am ehesten in einem sozialen Inkreis gegeben ist, und auch durch eine Auseinandersetzung mit guter Bereitschaft dazu, geschaffen werden könnte. Weil Wahrheit polarisiert, entsteht auch Polemik, wo die Möglichkeiten zur Annäherung der gegensätzlichen Positionen gering sind. Das ist ein forensisches Problem. Die Suche nach der juristischen Wahrheit besteht darin, gegensätzliche Standpunkte prüfend zu berücksichtigen, inwiefern sie den rechtlich gesetzten Vorgaben entsprechen, die im Gesetzeswerk (auch Grundgesetz und Verfassung) paraphiert sind. Recht kann nicht summarisch abgehandelt und gesprochen werden, weil Wahrheit keine summarische Grösse ist, wenn auch der ZeugenEid verlangt, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu bekunden, obwohl es sich ja nur um die Wahrheit des einzelnen Zeugen handeln kann. Für den Ausruf: "Gott schütze uns vor den Rittern der absoluten Wahrheit!" gäbe es sicher einen mittelalterlichen Urheber, wenn er hätte schreiben können. SUMMUM IUS, SUMMUM INIURIA .
.
Ein Gesetzeswerk enthält eben Übereinkünfte von Verhaltensregeln, ethische Richtlinien, also Anstandsnormen, welche im sozialen Inkreis gelten und dessen Grenzen bestimmen. Es listet Vergehen gegen diese Regeln auf und gibt Richtlinien für das Ausmass und die Art der Sühne und Strafe im Sündenfall. Teile solcher Rechtsbrüche werden als Offizialdelikte auch ohne Anzeige verfolgt, wenn für die Öffentlichkeit (d.h. dem soziologischen Inkreis), eine besondere Gefährdung ihrer inneren Ordnung durch derartige Regelbrüche vermutet wird. Es ergibt sich dabei ein zugespitztes Meinungsdiktat, weil das Gesetz bestimmte Ansichten verbietet. Die meisten Demokratien garantieren zwar die Meinungsfreiheit, verfolgen aber, zum Beispiel mit dem zeitgemässen Rassismusartikel, auch harmloses, verbales Gelegenheitsgepolter, welches eine abweichende Meinung von der "political correctness" verrät, nach dem Offizialprinzip. Solche Gesetze sind PER SE paradox, sind in sich selbst widersprüchlich, und solche Reglementierungen werden dennoch als politisch ohne Fehl akzeptiert, obwohl sie ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit der Meinungsfreiheit festschreiben.
Wir sind bestrebt, ohne Polemik auszukommen. Die Wahrheit stellt uns jedoch zur Rede. Sie zwingt jeden, der sich ihr stellt, Farbe zu bekennen. Die Gretchenfrage: Wie hälst du es mit ihr? muss nicht erfunden werden. Sie ist einfach vorhanden. So können wir uns einer minimalen Polemik im Bereich der Gegenüberstellung von Wahrheit und Wirklichkeit nicht entziehen, denn das Thema besteht aus Widersprüchlichkeiten. Es handelt sich gewissermassen um Antipoden, die von ihrer Definition abhängig sind und nur mit robusten Kunstgriffen zu Synonymen hingebogen werden könnten.
Als Wirklichkeit bezeichnen wir die Realität, wie sie ist, und nennen nur das Wirkliche realistisch, ohne Deutungen und Ableitungen. Der Begriff geht auf das lateinische RESzurück, was Sache beziehungsweise Ding heisst. Wahrheit ist dahingegen allenfalls eine Ansicht, eine Überzeugung, die oft in einem schwammigen Gegensatz zur Wirklichkeit steht. Wahrheit ist eher Übereinkunft, eine gültige Sprachregelung, die dem modernen Begriff "political correctness" Vorschub leistet, eine vorzugsweise virtuelle Wirklichkeit betreffend. Ein davon abweichendes Sprachverständnis würde damit als fauxpas, als Aus-der-Reihe-Tanzen, und damit als sträfliche und strafbare Unsittlichkeit festgeschrieben.
Bei der Wahrheitsüberzeugung spielt die Subjektivität eine erhebliche Rolle, und dies nicht nur dem heutigen Wortgebrauche gemäss, sondern mehr noch ihrer etymologischen Wurzel entsprechend. Sie ist aus lateinisch SUB = unterhalb, von unten heran, und IACERE = werfen zusammengesetzt zu SUBICERE, bedeutet also darunterwerfen. Damit meint Subjektivität eigentlich, dass sie umfassenderen Entitäten (Seinsbeständen) unterstellt ist, und dass sie das persönliche Eigeninteresse im sozialen Bezugsrahmen ausdrückt. Subjektivität heisst demnach eingegliedert, heisst sachlichen und sozialen Gegebenheiten und Bestimmungen unterworfen zu sein.
Jeder Versuch über die Wahrheit wird der Subjektivität Aufmerksamkeit schenken müssen, besonders, wenn er mit Wahrheit objektive Tatbestände meint. Begrifflich befinden sich diese beiden in gegensätzlichen Positionen. Wahrheit ist also nicht sachlich, sondern eher das Bekenntnis zum Selbstbefund. Sie meint nicht ein Objekt der sinnlichen Wahrnehmung. Alles Gute, Wahre und Schöne sind ästhetische Grössen und somit Stimmungspositionen. Ihre absoluten Wertungen finden sie im Subjektiven. Offensichtlich gibt es eine kollektive Subjektivität, insofern die Identität in sozialen Beziehungsbereichen funktioniert. Die Subjektivität, das heisst die Selbstbezogenheit, ist eine Inkreisdynamik und in ihrem engsten Bereich individuell. Sie hat Eingrenzungstendenz auf jeder sozialen Beziehungsebene und steht auch zur Objektivität wie ein Innen zum Aussen, was typisch für jede soziale Gliederung ist. Die Sinne sind das Instrumentarium, mit dem das Subjekt wohl Objektives wahrnimmt, um es aber dann subjektiv (selbstbezüglich) zu verarbeiten. Damit geht die Gestalt des Objektiven in das einvernehmende Subjekt auf (Funktionskreis). Das ist banale, unbewusste Alltäglichkeit. Um diese aber bewusst zu machen, braucht es anschauliche Beispiele, welche wiederum als Analogien subjektiv relativiert werden. Damit schützt das Subjekt seinen Anspruch darauf, im Besitz der Realitätsbefähigung zu sein. Um diese Feststellung zu untermauern, bedienen wir uns der Anthologie von Jewgeni Netscheporuk, "Die russische Entdeckung der Schweiz" . Der angehängte Untertitel "Ein Land, in dem nur gute und ehrbare Leute leben", fällt skeptischen Lesern als ironische Wendung auf, während die ehrbaren und guten Leute sich eher in ihrer Unschuld bestätigt fänden, falls sie eine derartige Lektüre überhaupt lesen sollten. Netscheporuks Dokumentensammlung beginnt mit Fragmenten eines Berichts über "Die Reise zum Florentinischen Konzil", der um 1440 abgefasst worden ist, und das "Basler Konzil
. Der angehängte Untertitel "Ein Land, in dem nur gute und ehrbare Leute leben", fällt skeptischen Lesern als ironische Wendung auf, während die ehrbaren und guten Leute sich eher in ihrer Unschuld bestätigt fänden, falls sie eine derartige Lektüre überhaupt lesen sollten. Netscheporuks Dokumentensammlung beginnt mit Fragmenten eines Berichts über "Die Reise zum Florentinischen Konzil", der um 1440 abgefasst worden ist, und das "Basler Konzil des Alemannischen Landes" verdammt, während er die Schönheit der zu durchquerenden Bergwelt bewundernd preist. Durch die Jahrhunderte führen 35 weitere Darstellungen und Bekenntnisse von Gemütslagen, die mit den objektiven Wahrnehmungen verknüpft sind, sei es, dass letztere diese Gemütsverfassungen auslösen oder, dass sie darauf projiziert werden. Die Umsetzungen der objektiven, sinnlichen Wahrnehmung in Eindrücke und Befindlichkeiten, entspricht jeweilen dem sich wandelnden Zeitgeist. Die Wandlung reicht von der sachlichen Feststellung bildhafter wie stimmungsvoller Momentaufnahmen, über den romantischen Realismus, bis hin zum ideologischen Ingrimm. Mit Wladimir J. Lenins "Abschiedsbrief an die Schweizer Arbeiter" schliesst der erste Teil der Sammlung. Er feuert gewissermassen Gemütszustandspartikel rundum auf die böse Welt. Hier ein typischer Satz daraus: "Als unsere Partei im November 1914 die Losung aufstellte: "Verwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg", in den Krieg der Unterdrückten gegen die Unterdrücker, für den Sozialismus, da wurde diese Losung von den Sozialpatrioten feindselig, mit gehässigem Hohn und von den Sozialdemokraten des "Zentrums" mit ungläubig skeptischen, charakterlos abwartendem Schweigen aufgenommen". usw.
des Alemannischen Landes" verdammt, während er die Schönheit der zu durchquerenden Bergwelt bewundernd preist. Durch die Jahrhunderte führen 35 weitere Darstellungen und Bekenntnisse von Gemütslagen, die mit den objektiven Wahrnehmungen verknüpft sind, sei es, dass letztere diese Gemütsverfassungen auslösen oder, dass sie darauf projiziert werden. Die Umsetzungen der objektiven, sinnlichen Wahrnehmung in Eindrücke und Befindlichkeiten, entspricht jeweilen dem sich wandelnden Zeitgeist. Die Wandlung reicht von der sachlichen Feststellung bildhafter wie stimmungsvoller Momentaufnahmen, über den romantischen Realismus, bis hin zum ideologischen Ingrimm. Mit Wladimir J. Lenins "Abschiedsbrief an die Schweizer Arbeiter" schliesst der erste Teil der Sammlung. Er feuert gewissermassen Gemütszustandspartikel rundum auf die böse Welt. Hier ein typischer Satz daraus: "Als unsere Partei im November 1914 die Losung aufstellte: "Verwandlung des imperialistischen Krieges in den Bürgerkrieg", in den Krieg der Unterdrückten gegen die Unterdrücker, für den Sozialismus, da wurde diese Losung von den Sozialpatrioten feindselig, mit gehässigem Hohn und von den Sozialdemokraten des "Zentrums" mit ungläubig skeptischen, charakterlos abwartendem Schweigen aufgenommen". usw.
Das ist kein Zeugnis objektiver Wahrnehmung, sondern ein subjektives Zustandsbild. Lenin verwandelt hier Schweigen durch vier grimmige Adjektive in aggressives Schreien. Er sichert sich am Schluss des Briefes sozial mehrfach ab, mit einem Aufruf, mit einer Auftragsbestätigung und mit dem Bekenntnis zu einer kollektiven Inkreissubjektivität:
"Es lebe die beginnende proletarische Revolution in Europa!
Im Auftrag der abreisenden Genossen, der Mitglieder der (durch das Zentralkomitee vereinigten) Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die diesen Brief in einer Versammlung am 8. April (n. St.) 1917 billigten.
gez. N. Lenin".
So ist es einsehbar, dass der einzelne Mensch in einem Zweckverbund lebt, in welchem er ständig nach dem Konsens, der Zustimmung sucht, um sich darin ein Eigenprofil zu geben, das den Bedingungen des PARS INTER PARES nicht widerspricht. Das Subjekt hat also seine eigene Geschichte, die vom übergeordneten vitalen Verband abgesegnet werden muss, um nicht aus dem Rahmen in das Abseits zu fallen, wo ein Einsamer leicht zum Objekt aller negativen Affekte wird.
Hierin liegt ebenfalls der funktionale Grund zum Phänomen der zweckbestimmten Konfabulation, mit der sich ein Individuum umgibt, um der Existenznische gerecht zu werden, die ihm seine Sozietät zugewiesen oder gewährt hat. Es ist nicht so, dass solche Zweckkonfabulationen unwahre Geschichten wären, sondern sie sind den Erwartungen des Umfeldes angemessen, also wahr, und sogar realistisch in Bezug auf ihre Funktion; sie sind jedoch nicht tatsächlich im moralisch wertfreiem Sinne.
Moralisch ist ebenfalls eine Vokabel die ihre Definition verlangt, um nicht Fehlinterpretationen zu verfallen. Moral kommt von lateinisch MORES und bedeutet die Sittlichkeit, also Ethik (zu = èthos = Sitte, Brauch).
Daher die Notwendigkeit, sich angemessen zu geben und eine angemessene Vorgeschichte zu bieten, um sich der Gemeinschaft, der es genehm zu sein gilt, würdig zu zeigen. Daher wiederum die Suche nach Heimat, so eine solche am gegenwärtigen Existenzort nicht empfunden wird. Emigration, das heisst die Abwanderung, ist ein Lösungsversuch des Problems der (anders nicht zu bewerkstelligenden) Selbstbestätigung. In den neuen Inkreis werden Geschichten der Selbstkennzeichnung eingebracht, die charakteristisch für die Art der alten Probleme sind. Zweckkonfabulationen sind gewissermassen erdichtete Wahrheiten, die entweder Minderwertigkeiten kompensieren sollen oder Anmassungen auf einen Machtanspruch zu rechtfertigen haben. Alte Monarchien leiteten ihren Anspruch von der Gottgegebenheit ihres Adels ab und ehrsüchtige Protze berufen sich auf den geheimnisvollen, grossen, fremden Fürsten, der ihr angeblicher Ahne gewesen sein soll. Es gibt die nicht mehr so aktuelle Anekdote des Dackels, der aus dem Osten kam und der westlichen Dogge verkündete, dass er in seiner Heimat ein Bernardiner gewesen sei. In lapidarer Kürze antwortet auf diese Kompensationsfabel der Spruch: "Auf gewesen gibt der Jude nichts". So hat jeder eine Geschichte, die der Umwelt genau das offenbart, was sie verschleiern sollte. Die Transaktionsanalyse bietet ein Schema von drei Instanzen an, in das sich der Vorgang einordnen lässt. Sie stellt beflissenes kindliches Gefälligsein als Betreuungsbedürftigkeit und somit als Unselbständigkeit dar, das gegenteilige, autokratische Machtprotzen aber als Elternverhalten, das Anspruch darauf erhebt, Abhängige betreuen und beherrschen zu müssen. Darüber steht das unabhängige, selbstverantwortliche Erwachsenenwesen, das pragmatisch in sich selbst beruht. Es bleibt jeder Person überlassen zu bekennen, wie schwer es ihr fällt, diese letztere Lebensart der Selbstgenügsamkeit zu pflegen.
bietet ein Schema von drei Instanzen an, in das sich der Vorgang einordnen lässt. Sie stellt beflissenes kindliches Gefälligsein als Betreuungsbedürftigkeit und somit als Unselbständigkeit dar, das gegenteilige, autokratische Machtprotzen aber als Elternverhalten, das Anspruch darauf erhebt, Abhängige betreuen und beherrschen zu müssen. Darüber steht das unabhängige, selbstverantwortliche Erwachsenenwesen, das pragmatisch in sich selbst beruht. Es bleibt jeder Person überlassen zu bekennen, wie schwer es ihr fällt, diese letztere Lebensart der Selbstgenügsamkeit zu pflegen.
Es ist nur natürlich, dass der Mensch durch sein "Verlangen" aktiv wird, einem Verlangen nach Bedeutung, Besitz und Position im sozialen Beziehungsreigen. Dabei herrscht zwischen einem Subjekt und gleichartigem Objekt eine Wechselwirkung, wobei (beispielsweise in der Paarungsdynamik) ein Objekt der Begierde gewöhnlich zum begierigen Subjekt mutiert.
Wir teilen die Ansicht von Noam Chomsky , dass Psychologie, Linguistik und Philosphie nicht als getrennte Wissenschaften verstanden werden können.
, dass Psychologie, Linguistik und Philosphie nicht als getrennte Wissenschaften verstanden werden können.
Sozialpsychologie kommt nicht ohne Sprachforschung aus, denn diese kann Auskunft über die Entwicklung des Sozialbeziehungsspiels geben . Es geht dabei um die Erschliessung vergessener und somit verborgener Quellen der instinktiven Beweggründe unseres Handelns. Jede Sozietät hat ihre eigene Sprachkultur. Der Zerfall einer solchen zeugt von der Auflösung der spezifischen Sittlichkeit, die Inhalt und Sinn der Kultur war. Von Zeit zu Zeit fallen akute Sprachverschiebungen auf. Teils sind solche spontan, teils durch absolutistische Herrschaftskonditionen andiktiert, was wir heute, beispielsweise mit der Sexualisierung des Deutschen und der political correctness erleben. Für die spontanen Änderungen, euphonisch Entwicklungen genannt, dürften sehr wahrscheinlich doch der Grund darin bestehen, dass die Menschen, bevor sie die Feinheiten einer angestammten Sprache durchgehend beherrschen, sich mit Improvisationen behelfen, und Lautgebilde benützen, die ihnen in erregenden Momenten aus anderen Sprachen imponieren. Und dies passiert eher in Zeiten des Wohlergehens, als in solchen heftiger Auseinandersetzungen, während der die Selbstbehauptung gefordert ist. In solchen kämpferischen Phasen kann es sogar zur Wiederbelebung längere Zeit vernachlässigter Sprachen kommen. Ein Beispiel dafür liefert das Hebräische als Iwrith, das eine Reaktivierung erfuhr, die vielen eine Wiederauferstehung aus historischen Grüften scheint; aber tot war diese Sprache nie, sondern profan nur vernachlässigt, jedoch als Kultursprache einer Volks- und Glaubensgemeinschaft als deren Identitätsbeweis durch Jahrtausende erhalten geblieben.
. Es geht dabei um die Erschliessung vergessener und somit verborgener Quellen der instinktiven Beweggründe unseres Handelns. Jede Sozietät hat ihre eigene Sprachkultur. Der Zerfall einer solchen zeugt von der Auflösung der spezifischen Sittlichkeit, die Inhalt und Sinn der Kultur war. Von Zeit zu Zeit fallen akute Sprachverschiebungen auf. Teils sind solche spontan, teils durch absolutistische Herrschaftskonditionen andiktiert, was wir heute, beispielsweise mit der Sexualisierung des Deutschen und der political correctness erleben. Für die spontanen Änderungen, euphonisch Entwicklungen genannt, dürften sehr wahrscheinlich doch der Grund darin bestehen, dass die Menschen, bevor sie die Feinheiten einer angestammten Sprache durchgehend beherrschen, sich mit Improvisationen behelfen, und Lautgebilde benützen, die ihnen in erregenden Momenten aus anderen Sprachen imponieren. Und dies passiert eher in Zeiten des Wohlergehens, als in solchen heftiger Auseinandersetzungen, während der die Selbstbehauptung gefordert ist. In solchen kämpferischen Phasen kann es sogar zur Wiederbelebung längere Zeit vernachlässigter Sprachen kommen. Ein Beispiel dafür liefert das Hebräische als Iwrith, das eine Reaktivierung erfuhr, die vielen eine Wiederauferstehung aus historischen Grüften scheint; aber tot war diese Sprache nie, sondern profan nur vernachlässigt, jedoch als Kultursprache einer Volks- und Glaubensgemeinschaft als deren Identitätsbeweis durch Jahrtausende erhalten geblieben.
Spracherwerb und Sprachbegabung sind Gebiete einer eigenen Wissenschaftsdisziplin und nicht unser Thema; aber wir müssen uns auf Teile ihrer Erkenntnisse beziehen, um Klarheit in Sachfragen zu schaffen, die uns hier beschäftigen. Wir sind in unserem Interessenbereich von den Phasen der kindlichen Sprachfähigkeitsentwicklung angezogen, besonders von der nachsyntaktischen, die etwa im fünften Lebensjahr ansteht. Schon kurz vorher beginnen Eltern darauf aufmerksam zu werden, wie ihre Kinder fabulieren, das heisst Geschichten erzählen, die erfunden scheinen. Das sind Merkmale der semantischen Sprachentwicklung. Die Kinder verfügen schon über einen beachtlichen Wortschatz, aber es fallen eben syntagmatische und asemantische Assoziationen, wie auch ungrammatische Satzbildungen auf, welche auf die Unvollständigkeit der kindlichen Wortbedeutungen schliessen lassen. Es gibt dabei auch Zeugnisse von ausgeprägtem Erfindungsreichtum, von schöpferischer Wahrnehmungsverarbeitung, den sittenstrenge, unvorbereitete Eltern für Lügen halten.
Die wissenschaftliche Erforschung der Sprachfähigkeitsentwicklung belässt es bei der Feststellung des Verlaufs. Sie sieht in den einzelnen Stadien keinen Ansatz, um Vorläufer von Verhaltensmustern mit besonderer Zweckbestimmung zu vermuten. Doch unseres Dafürhaltens könnte es sich auch um eine erste, noch anwendungslose Äusserung eines Sozialisierungsmechanismus handeln, der erst später, mit der Adoleszens aktuell wird. Dann begegnen wir der so nennbaren Eingliederungskonfabulation. Die jungen Menschen treibt es, dem elterlichen MANICIPIUM zu entwachsen. Es setzt die Tendenz zum Wunsch einer Ausgliederung und Neugründung von generationengerechten Beziehungskreisen ein. Das ist das Alter der Anfälligkeit für Geheimkulte, Sektenverführung, der geschlechtergetrennten Bünde und der zwischengeschlechtlichen Neuorientierung . Das gehört zur Dynamik der psychosozialen Inkreisgliederung. Es handelt sich also um Funktionen der subjektiven und sozialen Interaktionen und nicht um Unwahrheiten im Sinne bewusster Wirklichkeitsverfälschungen, die als Lügen bezeichnet werden müssten.
. Das gehört zur Dynamik der psychosozialen Inkreisgliederung. Es handelt sich also um Funktionen der subjektiven und sozialen Interaktionen und nicht um Unwahrheiten im Sinne bewusster Wirklichkeitsverfälschungen, die als Lügen bezeichnet werden müssten.
Es gibt auch hier Grenz- und Mischfälle, bei denen der Mechanismus wohl in seiner Grundform abläuft, aber sein Ausdruck teils angleichend (unbewusst), teils spekulativ (bewusst) ist. Bekannt sind die verschiedenen Grade einer solchen Ausprägung als Hochstapelei. Wie der Begriff anschaulich sagt, handelt es sich um Übersteigerungen eines Grundvorgangs, die von ihrem Umfeld abhängen, das heisst, dass sie nur in einer dafür günstigen Atmosphäre wirksam sein können.
Wenn jemand zum Beispiel als Militärarzt, der er nicht ist, glaubhaft sein möchte, braucht es dafür das Militär als Voraussetzung und die Medizin als Tätigkeitsfeld. Die militärischen Rituale schützen vor ziviler Skepsis, und die Tätigkeit als Arzt sichert mit dem Ausnahmestatus vor der Unbotsmässigkeit des misstrauischen gemeinen Mannes. Erfolgreiche Militärarzthochstapelei hat es wiederholt gegeben.
Im zivilen Bereich ist das Spielfeld weniger durch feste Regeln eingegrenzt, also unsicherer. Hochstapelei ist von seinem Umfeld abhängig und somit ein Produkt seines Umfelds. Das belegt jeder bekannte Fall. Es gibt aber eine hohe Dunkelziffer, die genau im Balancefeld zwischen zweckkonfabulieren und hochstapeln liegt. Hierfür liefert die Politik fruchtbare Voraussetzungen. Auch hier gilt das Gesetz der Angemessenheit. Übertreibungen führen zum Sturz, oder erheben in die Spitzenposition eines (fast) allmächtigen Duce. Dann erschüttert dessen Sturz eine Epoche, falls er seine ducale Tätigkeit übertrieben hatte.
Meist fallen Hochstapeleien im Bereich von Vermögensdelikten auf. Auch hier gilt, dass sie nur in einem entsprechenden Umfeld gedeihen. Ein Schulbeispiel der Interdipendenz der Positionen aller Beteiligten, legte uns Peter Kamber mit seiner Beschreibung des schwedischen Hochstaplers Torkel Tage Thiel vor, als einem Gewächs, das ohne Sumpf keinen Nährboden gehabt hätte, ob es sich nun in Schweden oder im Schweizerischen Tessin niederliess. Sumpfgewächse kennen keinen Respekt vor Grenzen, sondern benützen sie, um die eigene Identität zu verwischen. Sie gedeihen ausserhalb der Regeln des Heimischen und dringen in Intimbereiche ein, um dort zu schmarotzen und zu zerstören, was sie selbst nicht empfinden können, denn ihre dissoziale Persönlichkeitsstörung ist eine psychische Krankheit. Dazu gehört das Phänomen, dass solche Soziopathen sich insistierend für Sozialreformer ausgeben, und darin gar einen missionarischen Impetus entwickeln können.
vor, als einem Gewächs, das ohne Sumpf keinen Nährboden gehabt hätte, ob es sich nun in Schweden oder im Schweizerischen Tessin niederliess. Sumpfgewächse kennen keinen Respekt vor Grenzen, sondern benützen sie, um die eigene Identität zu verwischen. Sie gedeihen ausserhalb der Regeln des Heimischen und dringen in Intimbereiche ein, um dort zu schmarotzen und zu zerstören, was sie selbst nicht empfinden können, denn ihre dissoziale Persönlichkeitsstörung ist eine psychische Krankheit. Dazu gehört das Phänomen, dass solche Soziopathen sich insistierend für Sozialreformer ausgeben, und darin gar einen missionarischen Impetus entwickeln können.
Peter Kamber bekennt indes als Biograph von Wladimir Rosenbaum und Aline Valangin, mit der Darstellung des Lebenslaufs dieser zwei Sympathieträger, die eigene Weltanschauung, die etwa als anarcho-sozialistisch verstanden werden kann. Juristische Wahrheitsfindung ist es nicht, sondern die Offenbarung einer Überzeugung in stellvertretend personifizierter Darstellungsweise.
Die subjektive Befindlichkeit ist ein von den Wechselwirkungen im soziologischen Inkreis abhängiger Status. Würde die psychologische Forschung sich dieser Tatsache verschliessen, fehlte ihr der Bezugsrahmen des existenziellen Ursprungs der Subjektivität. Psychologie ohne Beziehungsumfeld ist nicht einmal denkbar, obwohl segmentarische Einsichten in Teilgebiete durchaus möglich sind. Wir können uns ja auch an einem Moment Sonnenschein erfreuen, ohne gleich die gesamte Meterologie studieren zu müssen.
Sitten sind wandelbar und Brauchtum unterscheidet die Sozietäten voneinander. Es ist deshalb anzunehmen, dass soziale Einheiten, um in ihrer Umwelt bestehen zu können, zu ähnlichen Zweckkonfabulationen bezüglich ihrer Identität neigen, wie die Individuen im Inkreis ihres engeren sozialen Bezugssystems. Davon zeugen Sagen und Legenden der Völker, und neuerdings gar sogenannte kritische Prüfungen der Vergangenheit.
Märchenhafte Erzählungen und Sagen erfreuen und stimulieren uns, weil wir uns dessen inne werden, dass sie Stimmungen darstellen und übertragen. Das ist sozusagen ein vorbewusster Prozess. Märchen bedienen sich symbolischer Zustände, und nicht der Übermittlung von technischen Tatsachen. Wir werden dennoch nicht meinen, es handle sich um Unwahrheiten, sondern annehmen, dass es Wahrheiten des Gemüts sind, für die es auch andere Ausdrucksmittel, zum Beispiel die der Kunst in Bild und Ton gibt. Es handelt sich ebenso um verbale Bild- und Tonvermittlungen von Gefühlswahrheiten. Dennoch ereignet sich die Übertragung in einem Bereich der träumerischen Unwirklichkeit, und dahin gehört auch die Zweckkonfabulation, die der subjektiven Angleichung an die Sozialisierungsponderablen dient, die zum Inkreis zielt, dem die Person zugehören möchte. Das gilt sowohl für die subjektive Befindlichkeit von Individuen als auch für grössere Identitätseinheiten. Dabei haben wir impulsiv keine Schwierigkeiten Empfindenswahrheiten von Unwahrheiten (Lügen) zu unterscheiden. Das wird erst schwierig beim Versuch, die gegensätzlichen Positionen zu definieren, also erst dann, wenn wir uns den Mechanismus des Geschehens ins Bewusstsein rufen; und der zeichnet auch die Trennlinie zwischen Lüge und Fabel. Diese Märchenwahrheit unterscheidet sich von der Lüge durch ihre unbewusste Anspruchsbefriedigung von der bewussten Verfälschung von Tatsachen. Fabeln dienen der Eingliederung in eine Inkreisidentität, Lügen sind indessen verbale Aggressionen auf Treu und Glauben, auf dem die soziale Einheit eines Inkreises beruht. Fabeln sichern den Zusammenhalt von Herd, Familie, Heimat, während Lügen nach der Zerstörung dieser Intimitäts-Identitätsbereiche trachten. Diese tiefenpsychologischen Phänomene verdienen unsere ganze Aufmerksamkeit, und es dürfte kaum einen psychischen Problemfall geben, bei dem wir diesem Aspekt nicht begegnen. Seine Präsenz ist allerdings oft durch dogmatische Analyseansätze verdeckt, und so wird er dann in seiner natürlichen Struktur nicht erkannt.
Geschichte wird zu Geschichten der Schuld und Unterwerfung, der Reue und Busse für etwas, was in Vorzeiten geschehen sein soll und das so dargestellt wird, wie es geschehen sein müsste, um Mitleid und Vergebung zu erheischen. In anderen Zeiten wurde die Grossmächtigkeit und der Heldenmut vergangener Geschlechter hochgehalten, um der Umwelt zu imponieren und deren eventuelle Invasionsgelüste a priori zu knicken. Wir sind auf das Phänomen der Aufarbeitung der problematischen Vergangenheit während Existenzkrisen von Stämmen, Völkern und Nationen gestossen, wenn ihnen vom überlegenen Umkreis eine solche Angleichung abgefordert wurde, falls dieser mächtig genug war, zu erpressen was ihm beliebte und zu erzwingen was ihm gefiel.
Auch in jüngster Zeit, das heisst im letzten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts, wurden uns leidige Beispiele dieser Wechselwirkung beschert. Eines davon betrifft die Schweiz. Sie sah sich gezwungen, eine sogenannte Expertenkommission Schweiz – zweiter Weltkrieg (Bergierkommission /
/ ) einzusetzen, welche die Angleichung des Schweizerischen Geschichtsbildes (ihres Selbstverständisses) an die Forderungen wirtschaftlicher Machtgruppen zu besorgen hatte. Die Vorgaben widersprachen per se den Erfahrungen der betroffenen Generation, die kurzerhand in den Quarantänestatus von ausrangierten Alten versetzt wurde. Letzteres geht aus der Tatsache hervor, dass die fragliche Expertenkommission noch lebende Zeugen, die seinerzeit eine aktive Rolle in der Schweizerischen Politik gespielt hatten, grundsätzlich nicht befragte
) einzusetzen, welche die Angleichung des Schweizerischen Geschichtsbildes (ihres Selbstverständisses) an die Forderungen wirtschaftlicher Machtgruppen zu besorgen hatte. Die Vorgaben widersprachen per se den Erfahrungen der betroffenen Generation, die kurzerhand in den Quarantänestatus von ausrangierten Alten versetzt wurde. Letzteres geht aus der Tatsache hervor, dass die fragliche Expertenkommission noch lebende Zeugen, die seinerzeit eine aktive Rolle in der Schweizerischen Politik gespielt hatten, grundsätzlich nicht befragte . Die Aktivdienst-Generation der Schweizer Armee muss die Relativierung ihrer, am eigenen Leibe erfahrenen Wahrheit erleiden, indem ihr von akademischen Besserwissern ihrer Nachkommen, Spekulation mit ethischen Werten vorgeworfen wird.
. Die Aktivdienst-Generation der Schweizer Armee muss die Relativierung ihrer, am eigenen Leibe erfahrenen Wahrheit erleiden, indem ihr von akademischen Besserwissern ihrer Nachkommen, Spekulation mit ethischen Werten vorgeworfen wird.
Der Bergierbericht wird unter anderen auch durch die Quellenstudien von Michel Fior, vom Neuenburger Universitätsinstitut für Geschichte, der Einseitigkeit überführt (Revue "Relations Internationales" Genf, 2001). Die NZZ Nr. 117, 2001 widmete diesem Schatten des Zweiten Weltkrieges einen Bericht unter dem Titel:"Von braunem Gold, das rotes war", zu dem sie einleitend feststellte, dass "diese Zusammenhänge der provisorische Goldbericht der Bergierkommission mit Schweigen übergeht" .
.
Der Historiker Albert Pfiffner attestiert denn auch den Bergier-Forschern, dass deren Vorgehen vielerorts weder repräsentativ noch beispielhaft war, weil deren getroffene Auswahl der Akten, teils nach bestimmten, teils nach eher zufälligen Geesichtspunkten zustande kam.
attestiert denn auch den Bergier-Forschern, dass deren Vorgehen vielerorts weder repräsentativ noch beispielhaft war, weil deren getroffene Auswahl der Akten, teils nach bestimmten, teils nach eher zufälligen Geesichtspunkten zustande kam.
Wir können ergänzen, dass solches Vorgehen einem Vorurteil entspricht und somit einem "konstruierten Geschichtsbild" dient.
Jede Fachperson, die sich mit geschichtlichen Ereignissen wissenschaftlich befasst, müsste doch voraussetzen, dass Wahrheit an die Umstände der Zeit an den Ort des Geschehens gebunden ist. Auch die eigene Wahrheit des Forschers ist subjektiv an den Ort, an die Art und Weise und an die Zeit seiner Gegenwart gebunden. Was Historiker ihrer sozialen Gemeinschaft an Ergebnissen ihres Trachtens vorlegen, sind Spiegel ihrer subjektiven Befindlichkeit. So nennt Altprofessor für Geschichte Walter Hofer , der sich fundiert gegen den Geist der Bergierkommission wendet, die Vereinigung Deutschösterreichs mit dem Reiche von 1938 (Heim ins Reich!) einen "sogenannten Anschluss durch Hitlerdeutschland", was weder den geschichtlichen Voraussetzungen dazu, noch der seinerzeitigen, örtlichen Stimmungslage gerecht wird. Sein Anliegen (Motiv) war es, die Bedrohungslage, in der sich die Schweiz, wegen der "Appeasementpolitik" der westlichen Demokratien und deren somit schuldhaften Versagens damals befand, deutlich nachempfindbar darzustellen. Diese Intension ist zwar schriftstellerisch wirkungsvoll, aber im Wert unwissenschaftlich. Im gegebenen Fall hätte es übrigens genügt, Adjektiv und Adverb nicht zu verwenden, um die Darstellung seriös zu halten.
, der sich fundiert gegen den Geist der Bergierkommission wendet, die Vereinigung Deutschösterreichs mit dem Reiche von 1938 (Heim ins Reich!) einen "sogenannten Anschluss durch Hitlerdeutschland", was weder den geschichtlichen Voraussetzungen dazu, noch der seinerzeitigen, örtlichen Stimmungslage gerecht wird. Sein Anliegen (Motiv) war es, die Bedrohungslage, in der sich die Schweiz, wegen der "Appeasementpolitik" der westlichen Demokratien und deren somit schuldhaften Versagens damals befand, deutlich nachempfindbar darzustellen. Diese Intension ist zwar schriftstellerisch wirkungsvoll, aber im Wert unwissenschaftlich. Im gegebenen Fall hätte es übrigens genügt, Adjektiv und Adverb nicht zu verwenden, um die Darstellung seriös zu halten.
Es gilt allerseits, dass jede, durch Dokumentenauswahl gerechtfertigte Zweckkonfabulation, in keinem Fall der juristischen wie geschichtlichen Wahrheitsfindung dient. Ein moralisierender Geschichtsforscher ist kein Historiker, sondern ein Moralist.
Eine peinliche Schönheit an Beispielen ist uns durch die Reihe der jeweiligen Neuausgaben der sowjetischen Enzyklopädie der Geschichtswissenschaften geliefert worden. Sie hat die Anatomie einer kontinuierlichen Aufarbeitung der laufenden Aktualisierung nach Massgabe der wechselnden Parteidoktrin. Aus den sich ändernden Perspektiven ergaben sich immerwieder neue Geschichtsbilder. Die zerfallene Union der Sozialen Sowjet-Republiken (UdSSR) war de jure zwar als Union zahlreicher Ethnien, Regionen und Unterrepubliken erklärt, de facto jedoch ein absolut zentralistisch regierter Koloss, ein Moloch, der seine Gliederungen eher verschluckte denn pflegte. Moskau war das Gehirn, und alle Funktionen der Glieder liefen folglich über Moskau. Jene sogenannten Unionsrepubliken waren durch eine vorgeschriebene Ideologie vereint und durch ihre marxistisch-leninistische political correctness zusammengezwungen. Nach dem wirtschaftlichen Kollaps, durch den die marxistische Wirtschaftsphilosophie sich als ökonomische Utopie erwies, fiel das Sowjetgebilde auseinander. Die baltischen, kaukasischen und südwestsibirischen Ethnien besannen sich auf ihre engere Identität. Die osteuropäischen Vasallenstaaten des Sowjetischen Imperiums konnten sich vom ideologischen Druck losstrampeln und suchten sich einer Macht anzunähern, die sie vor der erneuten Einverleibung in den grossen Moloch zu bewahren versprach. Gleiches gilt auch für die ehemals baltischen Sowjektrepubliken. Die Europäische Union scheint ihnen den ersehnten Schutz zu bieten. Ein nun auf Brüssel ausgerichteter Zentralismus, verspricht ihrer Wirtschaft eine neue Prosperität und eine staatliche Selbständigkeit, die sie als sowjetische Unionsrepubliken nicht hatten. Die Europäische Union verkörpert ihnen die Garantie der neuen Freiheit ihrer nationalen Wiedergeburt. Der Verlockung dieser, für sie neuen Toleranz und Grösse, können jene leidgeprüften Nationen kaum widerstehen, obwohl ihr Misstrauen ihnen auch äusserste Vorsicht gebietet .
.
Die Schweiz gehört nicht zu den befreiten Ländern. Sie konnte nach der Helvetik (dem von Napoleon Bonaparte 1798 bis 1803 diktierten Einheitsstaat), eine Föderation ihrer Kantone aufbauen, worin die einzelnen Ethnien, durch keine übergeordnete Macht bedrängt, ihren Eigenheitsanspruch anmelden und ausleben. Die Vielgestaltigkeit der Confederatio Helvetica ist an der Vielzahl der Idiome erkennbar, die in eigenen Territorien lebendig sind. Es ist von Schweizerdeutsch die Rede, wenn es sich um die Gemeinschaft der oberallemannischen Mundarten handelt, die unter sich fast so verschieden sein können, wie vergleichsweise etwa flamisch von meklenburgisch. Ein zentralistischer Einheitsstaat entspräche selbst im deutschsprachigen Teilgebiet nicht der Schweizerischen Eigenart, und weniger noch in Beachtung der französich-, italienisch- und romanischsprachigen Kantone, Regionen und Täler, welche in ihrer Gesamtheit die Schweizerische Eidgenossenschaft bilden. Dass deren politische Sehnsüchte nicht so geartet sein können wie die der baltischen, ostmitteleuropäischen und der balkanischen Nationen, ist offensichtlich. Was für die einen Verheissung sein muss, wäre für den anderen eine Zumutung. Was für die einen ein Zugewinn an Demokratie ist, wäre für den anderen die Opferung der funktionierenden Selbstbestimmung.
Wahrheit gilt nur unter den Umständen ihrer Zeit am Orte des Geschehens. Suchen wir politische Wahrheiten, so müssen wir sie dort, unter denselben Bedingungen, zur selbigen Zeit, am ein und demselben Orte suchen, wie, wann und wo sie geschehen waren.
Aus der Geschichte lernen? Das klingt nach dem verdächtigen Vorsatz, sich der Geschichte bedienen zu wollen, um aus deren Versatzstücken sich eigene Mausoleen zusammenzustellen.
Geschichte lehrt nicht, sie prägt!
Historiker sammeln deren Produkte, ohne die Funktionen der Prägeeinrichtung zu erforschen, weil die Lehre von den Kräften und deren Wirkungen in Motivationen und Tatverläufen ein eher sozialpsychologischer Fachbereich wäre, falls sie studiert würde.
Die Krähe, die auf der Walstatt selektiv nach Augäpfeln pickt, qualifiziert sich mit ihrer Geschichtsforschung als Leichenfledderin.
Der Bundesratsbeschluss vom 19. Dezember 1996 zur Einsetzung der Historikerkommission enthielt die Formel, dass diese der "historischenWahrheitsfindung" diene; aber es war von vornherein eine zweckgerichtete Unternehmung, deren Beschränkung sich als wahrheitseinengend auswirken musste.
Was haben die (de jure schweizerischen) Junghistoriker, die sich mit der Suche nach Wahrheit in den weltpolitischen Verquickungen zu befassen hatten, welche die Kriegsjahre 1939-1945 zeichneten, der Identität des sozialen Inkreises ihrer Nation doch für einen Tort angetan, indem sie, aus ihrer Vision des 50 Jahre später geltenden Weltbildes heraus moralisierten und einseitig nach Dokumenten suchten, die ihren grimmigen, anklägerischen Gemütszustand zu rechtfertigen hatten. Mit diesem Wurf von verbalen Brandsätzen auf das eigene Heim, verabschiedeten sie sich aus der innersten sozialen Identität ihrer Herkunft. Moralisierende Historiker, die auf eine selbstgeklitterte "Wahrheit", die so kombiniert nicht in der Gesamtheit der Zeitdokumente steht, fixiert sind, treiben eher Ethizismus denn Historik. Deren Moralisieren ist zudem so wertvoll wie ein Schwimmunterricht, der von dafür entlöhnten Nichtschwimmern, aus bequemen Strandkörben heraus, bereits ertrunkenen Seeleuten über die See hinaus erteilt wird. Den lauthalsen Strandhockern selbst hilft's allemal, wenigstens pekuniär. Es sind die Kartenleger, die Tarockmagier beim Spiel mit historischen Daten, welche Tatsachen mischen, um ein gemogeltes Geschichtspuzzle darzubieten und damit Verrat an der Wahrheit verüben.
Guter Rat ist teuer (wertvoll). Etymologisch gibt die Vorsilbe ver... dem germanischen Grundwort raten(=sich etwas gedanklich zurechtlegen) die negative Bedeutung: "durch falschen Rat irreleiten", beziehungsweise "etwas zu jemandes Verderben unternehmen".
Die personelle Zusammensetzung der Bergier-Kommission müssen dieselben Bundesräte verantworten, die auch einen anschlusseuphorischen Kurs, zur letztlichen Aufhebung der nationalen Autonomie steuerten und beibehielten, der im Widerspruch zu ihrem Amtseid stand, mit dem sie sich zur "Wahrung der Unabhängigkeit" verpflichtet hatten.
Solche Beispiele weisen auf die Bedeutung der Treue im Wahrheitsspektrum. Untreue ist deren klare Verneinung. Das gemeingermanische Adjektiv treu ist verwandt mit trauen dürfen und mit Trost, wie mit dem mhd. betriuwen = betreuen, also in Treue erhalten und schützen. Etymologisch geht treu auf got. triggws = treu, zuverlässig, aengl. triewe = treu, ehrlich, engl. true = treu, wahr, richtig, echt, schwed. trygg = sicher getrost, lit. drûtas = stark und fest zurück . Ungetreue Dienstausübung zeugt also auch gleich von Niedertracht. Sie ist Verrat.
. Ungetreue Dienstausübung zeugt also auch gleich von Niedertracht. Sie ist Verrat.
Landesverrat wird mit der erfolgten Machtverlagerung gewöhnlich durch den siegreichen soziologischen Auskreis sanktioniert. Auf eben diese Bestätigung unredlich erweiterter, persönlicher Macht, zielt gewöhnlich der Landesverrat aktiver Politiker. Während und nach dem zweiten Weltkrieg hatten die besetzten Länder, im Westen wie im Osten, ihre Quislinge auf Zeit, im Dienste der Nationalsozialisten wie auch der sozialistischen Internationale. Quisling wurde zu ihrem Synonym. Der Norweger war, als Mitarbeiter von Fridjof Nansen von 1922-1926, durchaus ein geachteter Politiker. Er war 1931-1933 Kriegsminister, und gründete dann die "Nasjonal Samlig". Sein Vaterlandsverrat geschah nicht, indem er einer bestimmten Ideologie anhing, sondern durch die Dienstbeflissenheit im Auftrag fremder Gesinnungsgenossen, als er 1940 deren Willen als Ministerpräsident Norwegens von Hitlers Gnaden vollstreckte.
wurde zu ihrem Synonym. Der Norweger war, als Mitarbeiter von Fridjof Nansen von 1922-1926, durchaus ein geachteter Politiker. Er war 1931-1933 Kriegsminister, und gründete dann die "Nasjonal Samlig". Sein Vaterlandsverrat geschah nicht, indem er einer bestimmten Ideologie anhing, sondern durch die Dienstbeflissenheit im Auftrag fremder Gesinnungsgenossen, als er 1940 deren Willen als Ministerpräsident Norwegens von Hitlers Gnaden vollstreckte.
Weltweit haben wir auch noch das Problem mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Nirgendwo entsprechen die Staatsgrenzen den Siedlungsgebieten ethnischer (völkischer) Einheiten. Beispielsweise die Albaner, obwohl sie in einer zusammenhängenden geographischen Region leben, sind gegenwärtig auf fünf verschiedene Staaten und autonome Teilstaatsgebilde verteilt. Sie haben kein gemeinsames Selbstbestimmungsrecht, welches die Vereinten Nationen UNO angeblich als Menschenrecht garantieren. Vom Staatskoloss, mit den demographischen wie geographischen Ausmassen eines Kontinents China, mit seinen vielen Ethnien, für welche es kein Selbstbestimmungsrecht gibt, kann Machtverzicht nicht erwartet werden, weil er als militärische Grossmacht Vetorecht hat, das in der UNO nur traditionell militärischen Grossmächten vorbehalten ist. Von Selbstbestimmung für Afrika, wo die Staatsgrenzen gemäss der Aufsplitterung ihrer kolonialen Vergangenheit, aber nicht nach dem Siedlungsgebiet seiner Völker verlaufen, kann keine Rede sein. Das Gegenteil ist der Fall. Die Weltvölkergemeinschaft diktiert die Grenzen und sorgt damit für perennen Konfliktstoff und Bürgerkriege zwischen den verschiedenen Ethnien eines Landes. Die Weltorganisaion UNO garantiert die ethnische Durchmischung, wie konfliktträchtig diese auch immer sei, aber nicht die ethnische Unteilbarkeit. Wegen der geltenden political correctness müssen wir sogar Regionen, wie Palästina und Israel, von einer näheren Betrachtung ausnehmen, um weder die eine noch die andere Seite, mit ihren jeweiligen Protektoren, bei ihrem Tun zu behaften, und die Uno, ihrer Inkonsequenz wegen, zu rügen. Das ist eine Probe des Tatbestandes der Wahrheitsfeigheit, will heissen Angst vor der Ächtung zu haben, die jede Person trifft, welche unter Missachtung des obrigkeitlichen Meinungsdiktats, die Dinge bei ihrem rechten Namen nennt. Für selbstbewusste Identitäten wäre es angesichts solcher Realität mindestens dümmlicher Leichtsinn, eine historisch gewachsene und abgesicherte Selbstbestimmung innerhalb eines funktionierenden Staatsverbandes, zu Gunsten des neoromantischen Konstrukts eines europäischen Zentralismus aufzugeben, dessen Orchester oekonomische Schalmeien bläst, die beileibe noch längst nicht aufeinander abgestimmt sind. Es schlägt ohne Takt der pumpende Rhythmus, und die Völkerharmonie bleibt ein Ziel kommender Generationen.
Sprachgeschichtlich führt das indogermanische uer (Gunst und Freundlichkeit erweisen) auch in die Richtung des althochdeutschen alawari (freundlich, wohlwollend), was gleichbedeutend dem altisländischen olvaerr (freundlich, gastlich) ist, und dem gotischen allawerei (schlichte Güte, arglos), entspricht, wie das mittelhochdeutsche alwaere (schlicht, einfälltig, dümmlich), von dem es den noch heute lebendigen Ausdruck auf bärndütsch allwäg (phonetisch etwa äuä) gibt. Das sind die etymologischen Wurzeln des, seit dem siebzehnten Jahrhundert, gebräuchlichen Adjektivs albern (sich kindisch oder närrrisch benehmen).
Denken wir an einige Albernheiten der hohen Politik, stimmt der geschichtliche Inhalt des Begriffes, eben die schlichte, gütige Einfältigkeit, eher versöhnlich, aber dies nur bei eigenem schlicht gütigem Gemütszustand. Andernfalls müssen wir darauf bestehen, dass Politik ernsthaft betrieben werde, und schlichte Güte darin reine Dümmlichkeit wäre. Eine solche wird von jeder pragmatischen politischen Gegenpartei voll zum Nachteil des Dummen ausgenützt. Darin haben in den letzten zwei Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts die helvetischen Politreformer Furore gemacht. Die Schweizerische Aussenpolitik wurde seinerzeit von Bundesrat Flavio Cotti bestimmt. Nicht nur, dass die flachbrüstige Diplomatie sich darauf kaprizierte zu winseln, anstatt selbstbewusst aufzutreten, sich gar von den Ränkespielen eines amerikanischen Senators erpressen liess, nicht nur, dass sie sich von einem Getränkegiganten mit fragwürdigen biographischen Glanzdaten, als Privatperson aber Präsident eines Weltkongresses, den Krieg erklären liess und sich darauf mit Konzessionen einliess (sich freikaufte), diese "schlichte Güte" der Schweizer Staatsrepräsentanten führte endlich gar zur Auflösung des neutralen Dispositivs der Landesverteidigung. Es wurde eine (trotz Beteuerung doch nicht unbewaffnete) militärische Einheit einem Kontingent einer anderen Nation angegliedert, welches wiederum als Untereinheit der Truppe einer anderen Nachbarnation unterstellt war, um als "Swisscoy" militärische Hilfe im Kosovo zu leisten, für eher zivile Dienste, die für nicht militärische Körperschaften durchaus eine sinnvolle und angemessene Aufgabe wären. Schon die Namensgebung war sichtlich albern. Es wäre zu vermuten, dass der Name auf ein Gedicht von Hans Joachim Ringelnatz
bestimmt. Nicht nur, dass die flachbrüstige Diplomatie sich darauf kaprizierte zu winseln, anstatt selbstbewusst aufzutreten, sich gar von den Ränkespielen eines amerikanischen Senators erpressen liess, nicht nur, dass sie sich von einem Getränkegiganten mit fragwürdigen biographischen Glanzdaten, als Privatperson aber Präsident eines Weltkongresses, den Krieg erklären liess und sich darauf mit Konzessionen einliess (sich freikaufte), diese "schlichte Güte" der Schweizer Staatsrepräsentanten führte endlich gar zur Auflösung des neutralen Dispositivs der Landesverteidigung. Es wurde eine (trotz Beteuerung doch nicht unbewaffnete) militärische Einheit einem Kontingent einer anderen Nation angegliedert, welches wiederum als Untereinheit der Truppe einer anderen Nachbarnation unterstellt war, um als "Swisscoy" militärische Hilfe im Kosovo zu leisten, für eher zivile Dienste, die für nicht militärische Körperschaften durchaus eine sinnvolle und angemessene Aufgabe wären. Schon die Namensgebung war sichtlich albern. Es wäre zu vermuten, dass der Name auf ein Gedicht von Hans Joachim Ringelnatz beruht, der da sang: "Kannst du dich über ihn werfen, just wie im Koy, dann tu's!" (Koy steht für Koitus); aber so liegen die Dinge nicht. Die Sache hat vielmehr Methode einer anderen Richtung. Es sollte eine Angleichung an den anglizistischen Sprachgebrauch der vereinten europäischen Streitkräfte sein. Hatten die Schweizer sich in naziheroischer Zeit erfolgreich vor der Provinzialisierung und dem Anschluss an ein grossdeutsches Reich und dessen damalige "Neue Weltordnung" gewehrt und sich die Unabhängigkeit bewahren können, sollte nun eine freiwillige Angliederung an eine neuerliche Neue Weltordnung erfolgen und dazu gehört, als entscheidender Schritt, die "Internationalisierung der Streitkräfte." Zuständig für dieses Ressort war seinerzeit Bundesrat Adolf Ogi
beruht, der da sang: "Kannst du dich über ihn werfen, just wie im Koy, dann tu's!" (Koy steht für Koitus); aber so liegen die Dinge nicht. Die Sache hat vielmehr Methode einer anderen Richtung. Es sollte eine Angleichung an den anglizistischen Sprachgebrauch der vereinten europäischen Streitkräfte sein. Hatten die Schweizer sich in naziheroischer Zeit erfolgreich vor der Provinzialisierung und dem Anschluss an ein grossdeutsches Reich und dessen damalige "Neue Weltordnung" gewehrt und sich die Unabhängigkeit bewahren können, sollte nun eine freiwillige Angliederung an eine neuerliche Neue Weltordnung erfolgen und dazu gehört, als entscheidender Schritt, die "Internationalisierung der Streitkräfte." Zuständig für dieses Ressort war seinerzeit Bundesrat Adolf Ogi , und Freude herrscht darüber keineswegs.
, und Freude herrscht darüber keineswegs.
Der Balkan ist das Feld der Tat des hochgemuten Bundesrat. Der Balkan – er ist schon geschichtlich bekannt und berüchtigt als gewaltiger Strudel und Sog. Wie und wo der erste Weltkrieg begann, erzählen uns noch unsere Väter. Wo islamischer, christlich-orthodoxer und römisch-katholischer Glaube sich in den Haaren liegen, dem Sammel- und Staubecken der Völkerwanderungen, dem das grossmächtige Osmanien einst seinen Stempel aufdrückte, dem byzantinischen Glacis, in diesem Brückenkopf des Islam, wo kulturstarke, autonome Ethnien in der Diaspora ständig um ihre Identität kämpfen, da sollen Schweizer Soldaten die sozialistische Moral ihrer eigenen Regierung verteidigen? Sie will halt "grosse Politik" spielen, wirft Neusöldner ins Feld wie Bleisoldaten in den Sandkasten und benimmt sich etwa so, wie Goethe es 1774 zum Auftakt des Osterspaziergangs , als Verhalten eines politischen Kannegiessers beschrieb:
, als Verhalten eines politischen Kannegiessers beschrieb:
"Nichts Bessres weiss ich mir an Sonn- und Feiertagen,
Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei,
Wenn hinten, weit, in der Türkei,
Die Völker aufeinander schlagen."
Zudem waren "militärische Friedensmissionen" schon eine "Breschnew-Doktrin" , wie sich die erste Nachkriegsgeneration in Berlin, Budapest und Prag noch erinnern wird. Es ist unsinnig mit Scharfschützen und Panzern Dinge besorgen zu lassen, die rein zivile Angelegenheiten bleiben sollten. Es wären Zivildienste dafür einzusetzen, nachdem sie aus zivilen Berufen rekrutiert und dafür spezialisiert würden. Zivile Ordnungsdienste sind nicht militärische, sondern Polizeiaufgaben.
, wie sich die erste Nachkriegsgeneration in Berlin, Budapest und Prag noch erinnern wird. Es ist unsinnig mit Scharfschützen und Panzern Dinge besorgen zu lassen, die rein zivile Angelegenheiten bleiben sollten. Es wären Zivildienste dafür einzusetzen, nachdem sie aus zivilen Berufen rekrutiert und dafür spezialisiert würden. Zivile Ordnungsdienste sind nicht militärische, sondern Polizeiaufgaben.
Sie wollen halt dabei sein, unsere Schauplatz lüsternen Magistraten. Sie wollen, so sagen sie, den Frieden zu Bern sichern, indem sie sich in die Händel der Südslawen mischen, will heissen, sich durch Reisläufer vertreten lassen. Nein, das ist nicht mehr eine verträgliche Albernheit, das ist sehr ernst. Der Schwanengesang einer abgeschminkten Helvetia ist damit angestimmt.
Die Folgen sind messbar. Im März 2001 hat der zuständige Bundesrat in einem Referat feststellen müssen, dass die Armee 95 nicht mehr funktioniere, weil es an Subalternoffizieren und Unteroffizieren fehle. Er meinte, der schwindenden Attraktivität der militärischen Karriere mit verstärkter Internationalisierung der Ausbildung der Streitkräfte begegnen zu können.
in einem Referat feststellen müssen, dass die Armee 95 nicht mehr funktioniere, weil es an Subalternoffizieren und Unteroffizieren fehle. Er meinte, der schwindenden Attraktivität der militärischen Karriere mit verstärkter Internationalisierung der Ausbildung der Streitkräfte begegnen zu können.
Die militärische Bereitschaft zur Selbstverteidigung der Neutralität, weicht demnach der Doktrin des Mitmachens auf Seiten des Stärkeren. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker wird unverhohlen als das Recht vereinter Mächte, über die Völker zu herrschen, verstanden. Das ist zwar so realistisch wie defaitistisch, und bringt die Frage mit sich, ob eine Militärdoktrin überhaupt noch sinnvoll sei, wenn es kein nationales Eigeninterresse mehr zu verteidigen gibt. Berufsmilitär zum Selbstzweck? Das müsste die Bürger das Fürchten lehren.
Gleichentags sprach ein anderer Bundesrat über das Thema, ob Staaten noch souverän seien und empfahl, vermehrt in Interessenkategorien zu denken, als von nicht existenter Unabhängigkeit zu träumen. Auch das bezeugte den heutzutage blühenden defaitistischen Realismus der Schweizerischen Staatsführung. Beiden Referaten fehlte die Bezugnahme auf die Strukturen der mentalen Wirklichkeit, die den Interaktionen zwischen den soziologischen In- wie Auskreisen zugrundeliegen. Politiker sollten diese sozialpsychologischen Grundlagen kennen, um ihre Weltanschauungen sachlich begründen zu können.
über das Thema, ob Staaten noch souverän seien und empfahl, vermehrt in Interessenkategorien zu denken, als von nicht existenter Unabhängigkeit zu träumen. Auch das bezeugte den heutzutage blühenden defaitistischen Realismus der Schweizerischen Staatsführung. Beiden Referaten fehlte die Bezugnahme auf die Strukturen der mentalen Wirklichkeit, die den Interaktionen zwischen den soziologischen In- wie Auskreisen zugrundeliegen. Politiker sollten diese sozialpsychologischen Grundlagen kennen, um ihre Weltanschauungen sachlich begründen zu können.
Diese Beispiele führten uns in das Labyrinth versteckter Wahrheiten. Aus einer kodierten Sprachregelung ist erst herauszufiltern, was sie meint. Das ist zwar nicht unser Thema, aber wir müssen es anschneiden, weil wir nolens volens damit konfrontiert sind. Dem Kontakt mit Lug und Trug, Hinterhalt und Irreführung, Falschheit und Heimtücke, Dialektik und Diplomatie kann niemand entgehen. Dabei gilt es auf der Hut zu sein, um nicht was recht ist für falsch und was falsch ist für recht zu nehmen. Diese negative Realwelt ist, wie gesagt, nicht Gegenstand unserer Untersuchung, obwoh sie die Arena des Kontrastprogramms zur Wahrheit darstellt. Da wimmelt es von Autoren und Darstellern jeder sozialen Schicht wie jeden Bildungsniveaus und jeden Gemüts. Literarische wie wissenschaftliche Zirkel treten dort ebenso auf, wie Laientheatergruppen mit ihren Schwänken und Schelmenstreichen, die sich an Verrat und Untreue belustigen. Der Schaden anderer amüsiert, der eigene schmerzt, Schadenfreude ist nur dann die reinste Freude, wenn der Schaden wirklich nur andere trifft. Es ist die Welt der Sophismen, die Welt der Spiegelfechtereien. Auf einer unregelmässigen Spur müssen wir vom Ausflug in moralsumpfiges Gelände wieder zur Wahrheit zurück finden.
Da gibt es das Beispiel der politischen Hinterlist. Sie brilliert durch ihren Facettenreichtum. Besonders imponieren darin die sogenannten "diplomatischen" Schachzüge, bei denen sorglos vertrauensselige Bürger nicht merken, wie ihre Rechte unterlaufen werden. Raffinierte Gaunereien demokratisch installierter Falschspieler finden legitim im Einklang mit deren Volksmandat statt. Um entdecken zu können, dass es auch indirekte Nötigungsmöglichkeiten gibt, setzt voraus, mit solchen Spielzügen selbst vertraut zu sein, sei es durch erfahrene Niederlagen, sei es durch schöpferische Ideen als Mitspieler im selben Poker.
Es gibt Methoden, mit denen demokratische Zuständigkeiten hintergangen werden. Zum Beispiel findet durch möglichst globale Staatsverträge eine Kompetenzverlagerung aus dem soziologischen Inkreis (nationale Parlamente) in den Auskreis (internationale Gremien) für, nach aussen gerichtete, interne Interessenbereiche statt.
Klaus Dieter Wolf von der technischen Universität Darmstadt, hat eine Studie veröffentlicht, die zwar anders ausgerichtet ist als die unsere, die aber folgerichtig aufgearbeitetes Material liefert, das sich hier einbringen lässt. Die Studie befasst sich mit der "international governance". Sie untersucht, wie die Zuständigkeit der Legislative durch globale Konventionen geschmälert, der relative Freiraum der Exekutive aber insofern erweitert wird, wie er nicht mehr durch die Legislative kontrolliert werden darf.
von der technischen Universität Darmstadt, hat eine Studie veröffentlicht, die zwar anders ausgerichtet ist als die unsere, die aber folgerichtig aufgearbeitetes Material liefert, das sich hier einbringen lässt. Die Studie befasst sich mit der "international governance". Sie untersucht, wie die Zuständigkeit der Legislative durch globale Konventionen geschmälert, der relative Freiraum der Exekutive aber insofern erweitert wird, wie er nicht mehr durch die Legislative kontrolliert werden darf.
Das Vertragsrecht verlangt Vertragstreue zu den vertraglich gebundenen Partnern, und diese Treue steht über den internen gesetzgeberischen Rechten. Die machtausübenden Staatsinstitutionen haben damit eine Referenzbasis, die ausserhalb ihrer Nationen liegt. Dies ergibt einen Spielraum für absolute Regierungsformen, was mit "Entmachtung der parlamentarischen Volksvertretung" überschrieben werden kann. Solche internationalen Verträge kumulieren mehr und mehr. Beispiele sind die global konzipierten Übereinkünfte, von denen sich nur autoritär regierte Staaten oder unabhängige Mächte fernhalten können. Die Menschenrechtskonvention, die Antirassismuskonvention, die Kinderrechtskonvention, die Klimakonvention, sind durchwegs gut, bisweilen gar romantisch klingende Vorgaben von hohem ethischen Wert, was nichts daran ändert, dass sie von gesetzgeberischer Natur sind und damit die Meinungsfreiheit aufheben, indem sie bestimmte Meinungen verbindlich machen. Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert zwar das Recht auf freie Meinungsäusserung, die der parteiisch ausgerichtete Rassismusartikel dahingegen aber strafrechtlich beschneidet. Grossenteils handelt es sich jedoch um "humane" Einfälle, die sich nicht durchsetzen lassen. Kriege können verboten werden, aber dennoch stattfinden. Kinderarbeit kann verboten werden, aber damit wird auch verboten, was der Stolz der Kinder sein könnte, wenn die Lebensverhältnisse danach sind. Solche Konventionen können auch nur verbindlich sein und Nachachtung finden, wenn ein gewisser ziviler Lebensstandart besteht und eine funktionierende Rechtstreue innerhalb und ausserhalb des Staatsgebietes herrscht, wo sie gelten sollen; aber selbst mit diesen Voraussetzungen bleibt das demokratische Fundament eine fragile Inkreisübereinkunft. Meinungen vorschreiben ist wie Gedanken diktieren; es funktioniert umso besser, je einfältiger, gutgläubiger und friedfertiger die menschliche Herde ist, oder auch überhaupt nicht.
In den so nennbaren "Delegations-Demokratien", die lediglich die Volkswahl der periodisch zu bestätigenden oder neu zu besetzenden Parlamentssitze kennen, wirkt sich die Entmachtung des Parlaments nur indirekt auf die Bürger aus. Über alle lokalen Bedingungen hinweg wird für nationale Belange eine internationale Gerichtsbarkeit installiert. Durch verschobene Zuständigkeiten entsteht eine gewisse Rechtsunsicherheit. Wessen Mass soll gelten? Amerikanische Gepflogenheiten greifen auf Europa über. Beispielsweise werden durch eigene Triebhaftigkeit verschuldete Selbstschädigungen dem Hersteller des missbrauchten Genussmittels angelastet, der dann zu Genugtuungsleistungen von schwindelerregenden Ausmassen an den Tunichtgut verurteilt wird. Das sind amerikanische Rechtsgrundsätze, die mit phantastischen Zahlen jonglieren, welche in Europa eher als Unrecht denn als Gerechtigkeit empfunden werden. Alles wird grenzenlos, uferlos und weit. Der Zug ins Grenzenlose ist ein Aspekt der Sehnsucht, und hat schon immer das menschliche Streben erfasst, besonders wenn es darum ging, Weltreiche zu gründen, eine allgültige Macht über alles zu setzen, Gleichheit zu fordern und Denken wie Fühlen zu konformieren. Mit der Globalisierung kleingemeinschaftlicher Belange, ist die Untergrundorganisation von neuen Subkulturen nach alten Mustern, wie beispielsweise lokale Rebellionen, maffiose Bruderschaften, Bandenbildung als Staatsersatz (siehe Tschetschenien) jedoch vorprogrammiert, denn die Anlage zur Inkreis-Auskreis-Gliederung in Kreisen verschiedener Bindungsdichte kollektiver Subjektivität ist naturgegeben und lässt sich nicht wegbefehlen.
Für die Schweiz, als deren Ursprung und Raison d'être noch immer gilt, keine fremden Richter über sich zu dulden, sind das schwerwiegende, existenzgefährdende Entwicklungen. Allerdings hat ein Staatswesen (eine Nation) nur so lange Gestalt, wie seine Glieder sich mit ihm identifizieren. Mit anderen Worten: Die Schweiz besteht nur durch das Bekenntnis zum Schweizertum, so wie jedes andere Volk auch in seiner jeweiligen Eigenart. Durch das Referendums- und Initiativrecht des Souveräns (der Stimmbürger), die eine Kontrolle der Regierungsgeschäfte ermöglichen, ist die Demokratieentmündigung seiner Bürger durch den Internationalismus direkt sichtbar und wirksam. Die Taktik, durch internationale Verträge das Volk hinters Licht zu führen, ist weder redlich noch ehrlich, und somit auch nicht wahrhaftig. Wegen ihrer traditonell weitgehenden Volksrechte bietet die Schweiz auch besonders auffällige Beispiele, wie durch Taktik der Exekutive das Legislativrecht des Volkes unterlaufen wird ; aber kaum jemand nannte dies bisher Betrug. DieVolksmeinung könnte sich jedoch betonter bei den Wahlen zeigen, was aber nur bedingt der Fall ist, denn Parteizugehörigkeit ist im Lande der Eidgenossen (wie vielleicht auch anderswo) Familientradition, und man wählt die vertrauten Leute auch dann, wenn man mit ihrer aktuellen Politik nicht einverstanden ist. Dennoch meint man so etwas wie eine nationale Rückbesinnung zu spüren, die auf den, gar öffentlich erklärten, Internationalismus zur Untergrabung der Volksrechte antwortet.
; aber kaum jemand nannte dies bisher Betrug. DieVolksmeinung könnte sich jedoch betonter bei den Wahlen zeigen, was aber nur bedingt der Fall ist, denn Parteizugehörigkeit ist im Lande der Eidgenossen (wie vielleicht auch anderswo) Familientradition, und man wählt die vertrauten Leute auch dann, wenn man mit ihrer aktuellen Politik nicht einverstanden ist. Dennoch meint man so etwas wie eine nationale Rückbesinnung zu spüren, die auf den, gar öffentlich erklärten, Internationalismus zur Untergrabung der Volksrechte antwortet.
Wenn auch das heutige Adjektiv albern auf dasselbe indogermanische Stammwort uer zurückgeführt werden kann wie wahr, so heisst das natürlich nicht, dass diese beiden neuzeitlichen Wörter miteinander identisch sind; doch gibt es zwischen ihnen die Brücke wohlgesinnt, arglos und einfältig. Das liesse die Meinung zu, dass dem Prädikat wahr nur mit situationsbedingten Vorbehalten vertraut werden sollte. Dieser Vorbehalt, der im Bärnbiet mit dem noch heute lebendigen allwäg ausgedrückt wird, gehört zur Wertung einer Wahrheit, ob diese einer einvernehmlichen Prüfung standhält oder ob sie eine einseitige ist, eine erklärte, deren Gültigkeit noch zu überprüfen wäre. Ungeprüft und widerspruchslos glauben was mitgeteilt wird, ist arglos. Arglosigkeit liegt nahe bei dümmlich, und wir haben es gar nicht gern, wenn man von uns die Tugend der Einfältigkeit erwartet.
Wir setzen aber gerne voraus, dass jemand in guten Treuen an seine eigene Wahrheit glaubt, auch wenn diese im Widerstreit mit der Wirklichkeit liegt. Politisch hat das sein Gewicht. Wenn uns weis gemacht wird, dass unsere Unabhängigkeit mit der Einschränkung unserer Entscheidungsfreiheit steige, dann ist das für uns eine Zumutung, an die der Verkünder solcher Wahrheit wohl selbst glauben mag; andernfalls wäre er ein politischer Rosstäuscher, falls er geschworen hätte, diese Unabhängigkeit zu wahren und zu schützen. Wir sind uns dessen bewusst, dass das böse Wort vom Landesverrat in den Ohren von etlichen "Kulturschaffenden" gar nicht bös klingt, da ja Begriffe wie Heimat und Vaterland ihnen als Provokationen gelten, und sie sich damit im Einklang mit der political correctness dieser Zeit befinden. Sie frönen dem strammen Konformismus ihresgleichen, sich dennoch für Nonkonformisten haltend.
Das Adjektiv wahr kommt endlich dem Umstand zu, dem man vertrauen könnte aber nicht müsste, falls nicht alle Aspekte desselben diese Zuschreibung verdienten. Damit wäre das Urteil unwahr noch nicht gefällt. Unwahr ist das Gegenteil jeglicher Spielart des Wahren. Das hat mit der Bewusstheit zu tun, mit dem wissentlich Verfälschten und dem bewussten Vortäuschen nicht bestehender Fakten. Wahrheit ist das als wirklich Erkannte und Unwahrheit ist die Verneinung dessen. Das oft mit Partizipien und Adjektiven verbundene Präfix un – verneint einen Begriff und verkehrt ihn somit in sein Gegenteil. Diese Vorsilbe ist in indogermanischen Sprachen in gleicher Funktion immer lebendig geblieben und beruht auf der Wortnegation n - , ne, nei, das wir auch in nein, nicht, nie und nur gebrauchen.
Wenn also ein Magistrat selbst nicht daran glauben würde, was er uns auftischt, dann spräche er unwahr. Er würde sich damit als Heimtücker zeigen. Wir müssen darauf vertrauen, dass unsere Spitzenpolitiker uns ihre Wahrheit andienen, von der sie überzeugt sind, dass es eine solche sei, auch wenn es uns schwerfällt so albern zu sein, diese für bare Münze zu nehmen.
Sprache ist das Verständigungsmittel, mit dem wir erklären und die Beweggründe zu unserem Tun darlegen. Mimik und Gestik begleiten den sprachlichen Ausdruck, obwohl entwicklungsgeschichtlich es sicher umgekehrt war, das heisst, dass Sprache eine spätere Erwerbung der Mitteilungsmöglichkeiten ist, die Mimik und Gestik begleitete. Es könnte also sein, dass ein Wahrheitsschwadroneur durch seine dazu im Gegensatz stehende Mimik verrät, ob seiner Wahrheit zu trauen ist oder nicht.
Jede Inkreisbindung folgt der intimen Wahrheit, die mit der Raison d'être des Sozialkörpers identisch ist. Mit diesem Motiv steht und fällt die soziale Identität. Deshalb ist es notwendig genau hinzuhören, wenn wortgewaltige Exponenten einer Weltanschauung "ihre" Wahrheiten verkünden. Vorsicht ist allein schon deshalb angebracht, um der mit pathologischer Insistenz vorangetriebenen Botschaft volksbeglückender Utopisten zu entgehen. Besondere Aufmerksamkeit verlangt die suggestive Wirkung des rhythmisch ständig Wiederholten, denn "Wahrheiten" werden auch gemacht, wenn sie mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen. Die Gefahr liegt im suggerierten Konsens über die Gültigkeit von angenommenen, scheinbar bewiesenen, geschichtlichen Daten. Wenn der "Fortschritt" gar zu fest auftritt, gilt es einzuhalten, durchzuatmen und sich auf das naheliegende Private zurückzunehmen. Vielleicht wird gerade die Wohnung eines Verstorbenen ausgeräumt, eines kultivierten, letzten Vertreters der Elterngeneration. Vom geistigen Reichtum, vom subtilen Eigenwert der Voreltern, bleibt gewöhnlich den Nachgeborenen nichts, weil er ihnen nicht zugänglich war. Mit dem Ableben sind auch die besonderen Bedingungen des Gewesenen abgelöst. So droht einem ehrenhaft Verstorbenen noch eine schmachvolle rituelle Tötung, wenn die Erben seine Hinterlassenschaft fleddern. Erst dann zeigt sich, wie fremd ihnen der Ahn immer gewesen war. Die Nachkommen sind zu oft auch Scharfrichter am Kulturerbe ihrer Wohltäter. Weiss der Himmel, wie viele Kostbarkeiten täglich durch die Müllabfuhr zermalmt werden, wie viele persönliche Bibliotheken in den Abfallbennen dem Dreck beigesellt werden, der die Abraumhalden füllt oder die Brennöfen nährt. Damit wird jeweils eine gewachsene Seinswahrheit vernichtet. Das gilt nicht nur für Einzelschicksale, sondern auch für das Kulturerbe ganzer sozialer Entitäten.
Neue Generationen sind ungeduldig und treten oft als Bilderstürmer, Kulturrevolutionäre, Tobsüchtige auf, sich an allen Gütern vergreifend, deren Sinn sie nicht verstehen, weil dieser ausserhalb ihres mentalen Niveaus liegt. Erbfähigkeit ist auch ein Aspekt der Kultur. Wer alles besser weiss, weil er nichts versteht, dem sollten wir widerstehen, wenn er uns mitzureissen droht. Um zur Erfahrungsreife zu kommen, braucht es gesitteten Respekt vor dem Erbe, das durch seine Erhaltung erworben wird. Dagegen steht die überhebliche Unkultur der Möchtegerne. Alles in allem herrscht jedoch das botanische Urwaldgesetz: Je üppiger das Verfallende war, umso wilder wuchert die frische Gelegenheitsvegetation. Lebendig ist stets die Kultur (auch Unkultur) der Gegenwart. Das ist unsere Realität. Wir identifizieren uns ja mit der (selbst) erfahrenen Wahrheit, und falls wir dieser nicht mehr trauen, zweifeln wir am Selbstbewusstsein und damit an der Daseinsberechtigung der eigenen Leistung.
Die Definition des Wahren lautet:
Wahr ist, was umstands-, orts- und zeitgebunden in sich selbst beruht; daraus verrückt, wird's albern.
Das ist nicht nur sicher, sondern regt auch einen lebendigen Umgang mit allem an, was uns als Wahrheit aufgenötigt wird.
TOCHandfeste Unterschiede
Die Sehnsucht nach einem Himmel der Glückseligkeit auf Erden in einem Weltreich Gottes hat zur Folge, dass sich immerwieder einige politische Schwachköpfe für Gott halten und dieses Gottesreich auch gründen wollen. Sie streben die Weltherrschaft an und haben dann ein Gefolge, das sich für die himmlische Heerschar hält. Hier nur die Al-Kaida Osamabin Ladens anzusiedeln, wäre zu kurz gegriffen. Auch dessen rhetorischer Gegenspieler sprach von einem Kreuzzug und bot zum (Jüngsten) Gericht auf, die Schafe von den Böcken trennend, die Guten von den Schurken, und also sprechend: "Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns!" Dieses globale Reich, mit der einzig möglichen guten Regierung, wäre immerhin auch dann, wenn sich das Gute als solches definieren liesse, ein Reich der Rechthaber. Wir kämen uns alle darin sehr verloren vor, denn wir sähen weder das Ende, noch eine Grenze dessen, was uns plagt. Heimat haben wir nur in den Grenzen unserer Sinnhaftigkeit, in dem, was wir erfassen und erfüllen können. Darüber hinaus erfreuen wir uns der Nachbarn, deren Heimat wir deshalb anerkennen, weil wir wissen, welches die unsere ist. Substanzlose Nachbarschaft wäre ein Nichts. Vielleicht ist es uns deshalb in der Unendlichkeit ungemütlich, und vielleicht kehren wir deshalb nach unseren weiträumigen Ausflügen nach Hause zurück, damit wir denen, die dort geblieben waren, von der Ferne berichten können; denn dann sind wir wer! Zu denken, es könne eine menschenwürdige Welt ohne Grenzen geben, ist nur ein irrealer Traum und nicht einmal ein schöner. Das Weltforum UNO wird uns die Heimat nicht ersetzen, unseren Gartenzaun, der die Rabatten umschliesst, die wir hegen und pflegen dürfen, ohne dass uns ein Ukas zur Grenzenlosigkeit der Freude, einen Strich durch das Anwesen macht.
Selbstverständlich sind für das Eingebundensein in die Wechselwirkungen grosser Kulturräume auch Aufwendungen nötig. Der Beitritt zur Europäischen Union würde heissen, dass das ohnehin nur bedingt freie Entscheidungsrecht aufzugeben sei, um sich einem (tendenziell autoritären) zentralistisch gelenkten Grossstaat einzugliedern. Bilaterale Lösungen haben jedenfalls den Vorteil, dass auch ein Kleinstaat in seiner Souveränität wahrgenommen wird, dass er von gleich zu gleich mit den grösseren Nachbarn bei freier Entscheidungswahl Beachtung findet, also einen Status geniesst, der mit dem endgültigen Anschluss unter dem Übergewicht der proportionalen Bevölkerungsmassen im Grossraum verloren ginge.
Systematisch wurde in den letzten zwei Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts in der Schweiz nach Sachabstimmungen das Volksmehr durch Regierungsentscheide, die nicht dem Plebiszit unterstanden, unterlaufen, und anderen Entscheiden durch internationale Verpflichtungen vorgegriffen. Eine "Aktion für freie Meinungsbildung" gab eine Broschüre mit dem bezeichnenden Titel "Die Staatskasse als Beute" heraus, wo sie auf 60 Seiten die, parlamentarisch teils nicht abgesegneten, Subventionen des Bundes auflistet. Ihre Zahlen entnahm sie der Staatsrechnung von 1998 und dem Budget 1999. Es sind allerdings auch die durch Volksentscheide sanktionierten Beiträge dabei. Die happigen "freien" Pfründe an internationale Institutionen, denen die Eidgenossen bisher nicht beitreten wollten, fallen jedoch auf. Jetzt aber (2002) wird von der "Obrigkeit" argumentiert, dass die Schweiz ja schon Beiträge leiste, und durch einen Beitritt nur unwesentliche 14 % Mehrkosten hätte
gab eine Broschüre mit dem bezeichnenden Titel "Die Staatskasse als Beute" heraus, wo sie auf 60 Seiten die, parlamentarisch teils nicht abgesegneten, Subventionen des Bundes auflistet. Ihre Zahlen entnahm sie der Staatsrechnung von 1998 und dem Budget 1999. Es sind allerdings auch die durch Volksentscheide sanktionierten Beiträge dabei. Die happigen "freien" Pfründe an internationale Institutionen, denen die Eidgenossen bisher nicht beitreten wollten, fallen jedoch auf. Jetzt aber (2002) wird von der "Obrigkeit" argumentiert, dass die Schweiz ja schon Beiträge leiste, und durch einen Beitritt nur unwesentliche 14 % Mehrkosten hätte . So zahlte der Bundesrat an die Verwaltungskosten der Vereinten Nationen (ohne bisher Mitglied zu sein) schon jährlich CHF 59'441'431.--; an das Umweltprogramm der UNO CHF 3'906'500.--; an allgemeinen Beiträgen an internationale Organisationen CHF 163'933'500.--; an die Entwicklungszusammenarbeit CHF 464'557'709.--; an humanitäre Aktionen CHF 125'816'354.und so weiter und so fort, die Liste ist lang und schwergewichtig. Es kommen Milliardenbeträge zusammen.
. So zahlte der Bundesrat an die Verwaltungskosten der Vereinten Nationen (ohne bisher Mitglied zu sein) schon jährlich CHF 59'441'431.--; an das Umweltprogramm der UNO CHF 3'906'500.--; an allgemeinen Beiträgen an internationale Organisationen CHF 163'933'500.--; an die Entwicklungszusammenarbeit CHF 464'557'709.--; an humanitäre Aktionen CHF 125'816'354.und so weiter und so fort, die Liste ist lang und schwergewichtig. Es kommen Milliardenbeträge zusammen.
Diese Taktik war erfolgreich. Sie wurde am 3. März 2002 durch das Stimmvolk sanktioniert.
Allerdings bedeutet der UNO-Beitritt nicht die Aufhebung der Eigenstaatlichkeit. Es ist ein Vertrag auf Gegenseitigkeit, mit der Tendenz zur internationalen Nivellierung der Volksrechte und der Reglementation zwischenstaatlicher Umgangsformen, in einem dazu paradoxen Vierklassensystem.
Das entscheidende, oberste Organ, ist der Weltsicherheitsrat, der 15 Mitglieder umfasst. Davon bilden die fünf feststehenden Grossmächte USA, Russland, Grossbritannien, Frankreich und China die 1. Klasse. Das waren die Siegermächte von 1945, die sich selbst auf immer erwählten, auch wenn ihre inneren Konstitutionen umbrechen sollten, die einen von der imperialen Diktatur zur relativen Demokratie (Sowjetunion zu Russland) die anderen von der relativen Demokratie zur imperialen Diktatur Kuomintang (Formosa) zum Kommunismus (Festland) mutierend.
Daneben gibt es die zehn auf Zeit gewählten Mitglieder minderen Rechts, das heisst ohne Vetobefugnis der 2. Klasse, der einstigen Mitsieger, die in letzter Minute des grossen Krieges der Allianz beigetreten waren.
Die 3. Klasse besteht aus der Masse der nicht auserwählten Teile der UNO-Vollversammlung, wo nun einige wenige Schweizer mitpalavern werden, aber nicht mitentscheiden dürfen. Letzteres ist nur der vollberechtigten 1. Klasse, kraft ihre Vetorechts vorbehalten.
Schliesslich gibt es noch eine Feindstaatenklausel, betreffend die unbotmässigen Länder der Völkergemeinschaft, als 4. Klasse, gegen welche laut Statut, die Erstklassigen die gesamte UNO-Gefolgschaft, nach dem Motto: "Wenige befehlen, alle müssen dran glauben!" aufbieten können.
Die Schweiz darf sich jetzt ihrer drittklassigen Mitgliedschaft erfreuen und sicher sein, dass sie der Viertklassigkeit entstiegen ist, sofern sie ihre Demokratienormen auf Unostandart hält und keine Eigenwege geht.
Dienen und bezahlen müssen alle, und daran waren die Schweizer auch schon vor dem Volksentscheid vom 3. März über Gebühr, und teils gegen den Willen des Volkes, beteiligt. Dafür werden ihnen nun einige Hoheitsrechte von sechs Komitees und anderen Organen, und vom Sekretariat der Vereinten Nationen abgenommen. Für etliche Sachfragen ist damit das Schweizerische Initiativ- und Referendumsrecht der Stimmbürger durch internationale Verträge unterlaufen. Das trifft zwar nur die, ihrer Rechte auch bewusste Minderheit, denn die Mehrheit der Bürger machte ohnehin nur selten von ihren direkten Volksrechten Gebrauch.
Der Gesamtbundesrat verkaufte uns vor der Abstimmung das Mogelpaket als "Mitsprachegewinn".
Bundesrat Deiss kam dabei als grosser Public Relation Manager heraus. Er hatte bereits am 29. Mai 2000, eine Woche nach dem Ja des Souveräns zu den wenig vorteilhaften, die Volksrechte einengenden, Verträgen mit der Europäischen Union erklärt: "Zeitlich vordringlich und reif ist nun der Beitritt zur UNO. Diesen wollen wir bis im Jahr 2002 schaffen." Das ist gelungen. Die Babylonische Sprachverdrehung hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Es bleibt abzuwarten, ob Deiss sich nun auch noch als Prophet erweisen wird, denn er sagte noch: "Der Beitritt zur Europäischen Union ist und bleibt das Ziel des Bundesrates."
kam dabei als grosser Public Relation Manager heraus. Er hatte bereits am 29. Mai 2000, eine Woche nach dem Ja des Souveräns zu den wenig vorteilhaften, die Volksrechte einengenden, Verträgen mit der Europäischen Union erklärt: "Zeitlich vordringlich und reif ist nun der Beitritt zur UNO. Diesen wollen wir bis im Jahr 2002 schaffen." Das ist gelungen. Die Babylonische Sprachverdrehung hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Es bleibt abzuwarten, ob Deiss sich nun auch noch als Prophet erweisen wird, denn er sagte noch: "Der Beitritt zur Europäischen Union ist und bleibt das Ziel des Bundesrates."
Besagtes Weltforum UNO begünstigt durch seine Struktur das Faustrecht. Ein himmeltrauriges Beispiel der Aktualität des beginnenden Jahrtausends bietet der Bruderzwist der Kinder Abrahams auf dem geschichtsreichen Boden Palästinas. Die UNO-Resolutionen 242 und 338, die Teilung des Landes betreffend, werden durch den, von der vetoberechtigten Grossmacht USA protegierten, militärisch weit überlegenen Nutzniesser, schlicht ignoriert. Anders als im Balkankonflikt des ausgehenden 20. Jahrhunderts, fallen keine Bomben auf einen "expandierenden Agressor", wie die offizielle Lesart der gleichgeschalteten Weltpresse im Falle des Balkans es zu sehen empfahl. Der, mittels einer faschistischen Siedlungspolitik in die angrenzenden Ländereien expandierende Kraftprotz am Ostufer des Mittelmeeres, wurde nicht zurückgebunden. Die USA gefiel sich in der Rolle des Vermittlers, wo nichts zu vermitteln, sondern nur zu befolgen wäre.
Wiederholt hatte die ständig gedemütigte, angestammte Bevölkerung des Gazastreifens und der Westbank der Jordansenke nach internationalen UNO-Beobachtern verlangt, wogegen sich Israel, mit Unterstützung der Vetomacht USA, stets schroff sperrte. Seit September 2001 und während den ersten drei Monaten 2002 besuchte Premier Sharon mehrmals den amerikanischen Präsidenten, welcher den direkten Kontakt mit dem Palästinenserpräsidenten erklärtermassen ablehnte, bis dass dieser die Forderungen des ersteren erfüllt haben werde! Gleichzeitig brach die militärische Grossaktion los, die den Sündenbock Yasir Arafat de facto gefangensetzte und isolierte. Wird die geographische Ausgangssituation zu diesem Gewaltakt in Betracht gezogen, so ist aus dem Kartenmaterial ersichtlich, dass das durch die UNO den Palästinensern zugesprochene Land schon ghettoisiert war, bevor die, durch "General" Sharon, mit seinem Tempelspaziergang provozierte Intifada ausbrach. Zum 4. April 2002 hielt endlich George W. Bush junior, Präsident der Vereinigten Staaten, eine Rede, die weitherum als politischer Kurswechsel interpretiert wurde; aber Bush trieb den Ministerpräsidenten Israels verklausuliert lediglich zur Eile, die Zerstörung der Infrastuktur palästinensischer Siedlungen zu vollenden. Die Fristerstreckung für Sharon könnte auch durch das Reiseprogramm des höchsten Krisendiplomaten der USA, Aussenminister Powell, angenommen werden, der wohl ein Treffen mit Arafat ins Auge fasste, aber erst für den 12. April und zwar abhängig von der Erlaubnis durch den israelischen Premier. Folgerichtig ging die Kriegsaktion mit schwerem Gerät und aus der Luft noch hastiger weiter. Stereotyp wiederholten Bush, wie auch sein Aussenminister Powell, die von Sharon vorgegebene Standardformel, dass der (isolierte!) Palästinenserpräsident nicht genug täte, um den Terror (der Verzweiflungstäter) zu unterbinden. Am 14. April war es denn, nach Absprache mit Sharon, endlich so weit, dass Powell auch Arafat traf. Die Zerstörungsorgie der Soldateska konnte weiterhin toben und trotz eines humanen Appells des Generalsekretärs der UNO Kofi Annan, stellte sich am 18. April Bush wie gewohnt, weiterhin hinter Sharon.
Die Indizien lassen eine strategische Absprache zwischen Sharon und Bush zur Liquidierung der palästinensischen Identität vermuten. Mit dem verbalen Deckmantel "Terrorbekämpfung", dürfte es sich um die orale Rechtfertigung geplanter Racheaktionen handeln.
Die üblen diplomatischen Spiele und die sichtbaren Grausamkeiten gegen Leib, Gut und Leben, überdecken das delikate Detail, dass Israel der einzige rassisch-demokratisch definierte und zivilisiert erscheinende Staat ist, der die Folter, gesetzgeberisch geordnet, erlaubt. Dieser Aspekt lässt die Kamikazeaktionen der Palästinenser nicht nur als verzweifelte Verteidigungstaktik, sondern geradezu als gebotenen Selbstschutz der Täterschaft dastehen. Freilich ist der Terror, der damit ausgeübt wird, unbeschreiblich grausam, aber die Täter sehen sich selbst unverschuldet als Opfer und können einseitiges Bedauern nur als weitere Rechtfertigung ihres Handelns begreifen.
Rache ist ein Durst, ein nur durch entsprechendes Tun stillbares, gleichsam physisches Urbedürfnis. Die Geschichte eines Rachedurstes beginnt mit dem Kettenglied, das aus einer langen Abfolge herausgegriffen wird. Rache, als aktueller Status Israels, antwortet also auf eine Reihe von Selbstmordattentaten, die das zivile Leben im gesamten Lande unsicher machten. Zweifellos sind die zu Tode zerfleischten Menschen zu betrauern. Es sind Opfer eines schrecklichen Terrors. Mitfühlbar ist auch die Wut, die darauf antwortet und die Rache, die über die empfundene Ohnmacht obsiegt, welche eine solche alltägliche Bedrohung begleitet. Aber eben, das herausgegriffene Glied der Aktions-Reaktionskette löst das Rätsel des Verhängnisses nicht. Die Palästinenser kennen einen anderen Beginn der Geschichte. Sie haben nicht nur grosse Teile ihres angestammten Siedlungsgebietes verloren. Die nun seit über fünfzig Jahren in Flüchtlingslager gedrängten Vertriebenen verblieben mit ihren Kindern und Kindeskindern dort. Das Restland ist von Besatzern durchsetzt und zwangsweise Fremdsiedlern geöffnet. Ihr Ackerland wurde von Strassen durchschnitten, die diesen Fremden vorbehalten sind. Die Existenzbedingungen der autochthonen Bevölkerung sind eingeengt, und sie sehen keinen Schimmer einer Änderung ihres so gezeichneten Unglücks. Ständige Demütigungen durch fanatische jüdische Siedler sind für die Palästinenser unerträglich. Sie haben keine Aussicht auf eine andere Zukunft und sehen nur noch einen Ausweg in der Selbstopferung. Andere mit sich in den Tod reissen, auch wenn es sich um anonyme, wahrscheinlich sympathische und friedliche Einzelpersonen handelt, scheint zudem das einzige Mittel, das Selbstopfer bekannt zu machen, damit der Tod wenigstens diesen einen Sinn, den der Sensationsnachricht bekommt. Vergessenwerden, unter diesem Schleier haben die Palästinenser schon lang vegetiert, und der eigene Tod soll sie wenigstens für Augenblicke aus der Vergessenheit reissen. Die Mittel in diesem ungleichen Kampf sind so verschieden, dass es schwer fällt, beider Seiten Elend gleich zu würdigen. Sicher ist nur, dass Racheaktionen die Probleme nicht lösen, sondern nur bezeugen können.
Wir haben es nicht mit einem Rassenkonflikt auf Tod und Verderben zwischen Pseudogermanen und Semiten zu tun, sondern mit einem semitischen Bruderkrieg. Es ist sicher nicht gut das zu tun, was gemäss der Überlieferung am Treiben der weiland politischen Kampfstaffeln Hitlers als gnadenlos sadistisch, barbarisch und mörderisch verabscheut und vermarktet wurde.
Es handelt sich nicht um rassische Qualitäten die sich hier auftun, sondern um mit perfektionierter Mechanik aufgerührten sadistischen Urschlamm.
Die UNO-Resolutionen, die Israel zur Mässigung aufriefen, wurden zu begleitenden Sprüchen im Bühnenaufzug eines Dramas degradiert, in dem der starke Faustkämpfer dafür Beifall erntete, dass er den verröchelnden Miesling peinigte. Das sind Reaktionen primitiver, soziopathischer Impulse, einer Art Schadenfreude. Da werden Verzweiflungsakte grundsätzlich als ungehorsame Böswilligkeit, als verwerfliche Charakterschwäche verurteilt, wenn jemand seiner eigenen Schwäche erliegt.
Der israelische Publizist Amos Oz rief dazu auf, den legitimen Kampf der Palästinenser um einen eigenen Staat, vom islamischen Fanatikerkrieg gegen Israel zu unterscheiden. Er fürchtet, dass der Vernichtungsfeldzug Sharons zur weltweiten Ächtung der Judenheit führen könnte. HINC ILLAE LACRIMAE
rief dazu auf, den legitimen Kampf der Palästinenser um einen eigenen Staat, vom islamischen Fanatikerkrieg gegen Israel zu unterscheiden. Er fürchtet, dass der Vernichtungsfeldzug Sharons zur weltweiten Ächtung der Judenheit führen könnte. HINC ILLAE LACRIMAE . Es muss mit Nachdruck angemerkt werden, dass die jetzige Staatspolitik des Medinet Israel nicht mit dem ethischen Judentum identisch ist. Die moralischen Anforderungen des Judaismus sind sehr hoch und stehen im diametralen Gegensatz zum aktuellen politischen Gebaren der Mehrheit des Staatsvolkes, das aus der jüdischen Ethik in die Barbarei zurückfiel.
. Es muss mit Nachdruck angemerkt werden, dass die jetzige Staatspolitik des Medinet Israel nicht mit dem ethischen Judentum identisch ist. Die moralischen Anforderungen des Judaismus sind sehr hoch und stehen im diametralen Gegensatz zum aktuellen politischen Gebaren der Mehrheit des Staatsvolkes, das aus der jüdischen Ethik in die Barbarei zurückfiel.
Der "Sharonismus" beleidigt die Thora und ist damit antijüdisch. Eigene Missetaten können nicht damit gerechtfertigt werden, dass die Vorfahren Opfer eben solcher Brutalitäten waren. Es sind Personen die den Frontwechsel vollziehen, nicht die Werte. Die Nachkommen der Auserwählten des Zufalls, welche die Shoa überlebten, können sich zwar auf deren Peiniger berufen wenn sie es denen gleichtun, aber um den Preis des Verrats an den Shoaopfern.
Wer wegen einer Notlage etwas entwendet hat, was anderen gehörte, sollte wenigstens so viel zurückerstatten, dass die Betrogenen nicht ihrerseits in Not geraten. Ein Vernichtungsfeldzug ist keine Friedensvorgabe und bewahrt gerade im Siegestaumel den, in gespreiztes Heldengetue gekleideten Hass.
Nun siegen sie wieder, diese Helden.
Für Kulturkreise mit hohem gemeinschaftlichem Freiheitsgut, ist das Heldenhafte einer Soldateska mit dem Gehabe von Kampfmaschinen etwas, das aus den dunklen Niederungen der Raubtierhaftigkeit der menschlichen Urnatur aufsteigt. Deren Rechtfertigungen sind sämtlich unwahr, weil sie das Feindschaftsprinzip vertreten und auf ein einseitig begünstigendes Recht setzen. Schlussendlich ernten jedoch die Sieger eine Zustimmung die so viel Wert hat, wie das Lämmerblöken der verschont Gebliebenen nach dem Blutrausch der Wölfe, (ähnlich dem Publikumsjubel nach dem Boxmatch).
Katastrophisch wird es leicht, wenn sich relative Massen in einem Führer verwirklicht sehen, das heisst sich mit dem identifizieren, was dieser ihnen verheisst. Dann geraten die Zwischenglieder der hierarchischen Struktur ausser Funktion, und es entsteht der hypnotoide massenpsychotische Zustand, der die Völker ins Verderben reisst. Im semitischen Bruderkrieg befinden sich Israeli wie Palästinenser in eben einem solchen Zustand, verkörpert durch ihre Führer Sharon und Arafat.
Die Bedürftigkeit zehrt vom Glanze des Glorienscheins, den sie dem Privilegierten verleiht, mit dem sie sich, ihre eigene Mangelhaftigkeit kompensierend, identifiziert.
Die Menge der Benachteiligten gibt ihre Stimme dem Erfolg, um sich des Machtgefühls ihrer Vielzahl zu versichern, etwa gemäss der Triumphformel: Einer von den Unseren hat es geschafft!
Die Partei der sozial Benachteiligten weist die grössten Einkommensunterschiede unter ihren Mitgliedern aus. In der Schweiz gehen sie vom Sozialhilfeempfänger bis zum Einkommenskrösus. Ein von den Gewerkschaften gefordertes, aber noch nicht erreichtes Mindestjahressalär von CHF 36'000.-- steht 2001 dem Spitzensold von CHF 750'000.-- bei der Post und Bahn (zwei Betriebe mit Leistungsauftrag in öffentlichen Diensten, die durch Steuergelder mitfinanziert werden) gegenüber. Die Partei ist an der Regierung beteiligt. Es ist zu vermuten, dass das Bekenntnis des Spitzenverdieners zu derselben, karrierefördernd war. Er wurde zum Generaldiektor der Bahn noch als Bundesbeamter berufen, der gemäss der Besoldungsklassenskala Anrecht auf das Spitzenjahressalär von CHF 320'626.-- hatte. Nach der Deregulierung (Umwandlung des Staatsbetriebes in eine AG) verdoppelte der Verwaltungsrat die Gage (nach Massgabe der Börsenkurse) auf CHF 750'000.--. Dem zweifellos tüchtigen Manager war das denn doch zu viel. Er erklärte öffentlich, sich mit CHF 600'000.-- bescheiden zu wollen, was ihm dennoch gegenüber seinen weniger vom Glück gesegneten Genossen, peinlich sei. Das war eine unter Glücksrittern viel belächelte Offenbarung, aber versöhnte die Benachteiligten.
Falls jedoch bestens verdienende Genossen meinen sollten, dass ihre Basismitglieder so dumm seien, ihre Einkommen nicht zu vergleichen, wäre das allerdings ein Beispiel von Überheblichkeit. Die Wahrheit des politischen Bekenntnisses wird an den Gegensätzen gemessen, die sich in der Wirklichkeit (den Gehältern) des sozialen Status zeigen. Diese Unterschiede müssen den Benachteiligten schlüssig, in ihrem Idiom, erklärt werden, und es soll ja Sprachvirtuosen geben, die sich das zutrauen.
Der Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)
 , tat dies an der Jubiliäumsversammlung 100 Jahre Verband Schweizer Lokomotivführer (VSLF) mit den Worten: "Ihr habt Anspruch auf die besten Chefs! Und die tun das nicht mehr nur aus Idealismus, sondern um Geld!" War das nun gekonnt, oder Chuzpe? Ein Leistungsunterschied, wie der solcher Gehälter, ist unmöglich, welcher Arbeit es auch sei. Der Unterschied soll sich aus der (freilich undefinierten) Fülle der Verantwortung ergeben.
, tat dies an der Jubiliäumsversammlung 100 Jahre Verband Schweizer Lokomotivführer (VSLF) mit den Worten: "Ihr habt Anspruch auf die besten Chefs! Und die tun das nicht mehr nur aus Idealismus, sondern um Geld!" War das nun gekonnt, oder Chuzpe? Ein Leistungsunterschied, wie der solcher Gehälter, ist unmöglich, welcher Arbeit es auch sei. Der Unterschied soll sich aus der (freilich undefinierten) Fülle der Verantwortung ergeben.Werden Basislohnempfänger sich nun freuen, dass an ihren Arbeitsplätzen die "besten" Manager rütteln, um die Löhne tief zu halten, damit die Bahn mit ihren Tarifen gegenüber der Strasse konkurrenzfähig bleibt? Sie werden sich freuen, aber nicht daran, sondern am Triumph, dass einige von ihnen es geschafft haben, und ermutigt sein, entsprechende Lohnforderungen zu stellen. Beifall ist ein Plusquam-Effekt des Vorteils.
Auf eine, die Spitzengehälter betreffende parlamentarische Interpellation, antwortete der Bundesrat, dass solche Spitzenlöhne der Kader der einstigen Bundesregiebetriebe gerecht seien, weil im internationalen Vergleich ählicher Kategorien, diese eher noch im Minimalbereich lägen
 .
.
TOCWechselspiele
Zwischen Stube und Ferne geht es ein und aus. Da bewegt sich etwas, die Tür steht mitten im Geschehen. Eine Katze, die nach draussen will, ist dieselbe, die ein andermal nach innen drängt. Dass sie diesen Drang vollziehen kann, ist ihre Freiheit. Bliebe sie ausgesperrt, würde sie leiden, wäre sie eingeschlossen, gälte dasselbe, gäbe es keine Tür, hätte sie kein Ziel.
Mit uns ist es nicht anders. Wir erfahren mit der Analogie unsere Wirklichkeit.
Gewöhnlich bilden Bekenntnisse und erklärte Ansichten ein Orientierungsnetz, das wir dem wahrgenommenen Verhalten unterlegen, um daraus Schlüsse zu ziehen, die wir dann als objektives, finales Bild der Wirklichkeit annehmen. Unsere Motivsuche bewegt sich innerhalb dieses Rahmens, wohl wissend, dass wir uns persönlich von Impulsen steuern lassen, die keineswegs mit einem solchen Bild der Wirklichkeit deckungsgleich sind. Empfindungen die uns treiben, sind unser persönliches Geheimnis und sogar uns selbst geheimnisvoll. Wir können sie nicht in das Ideal unseres Menschenbildes einpassen, weil wir unserem Ebenbilde göttliche Grösse zugestehen, es als die Verkörperung hoher Tugenden sehen, das zudem wisse, was gut und böse sei, das zur Selbstverantwortung befähigt ist, sich seiner Qualitäten und Möglichkeiten bewusst, eigenständig und von ewig währendem, unersetzlichem Werte wäre. Dem widerspricht die Impulssteuerung unseres Verhaltens, und dieses Selbstbildnis erlaubt schon gar nicht daran zu denken, dass es vorgegebene Verhaltensmuster und vorgegebene Strukturen unserer Denkvorgänge gibt. Wir bleiben an der Oberfläche und fühlen uns sicher mit dem Anschein, den die Vorgänge erwecken. Paradebeispiel für diese Feststellung ist die Motivation zur Bildung kleiner Gruppen. Wir hören uns ihre jeweilige Rechtfertigung an und kümmern uns kaum mehr um die Dynamik, um den Verlauf des Geschehens. Es müsste uns sonst auffallen, dass trotz den recht verschieden verbalisierten Motiven der Vorgang immer gleich ist. Die Rechtfertigungen sind also adaptiert und maskieren einen Instinkt, welcher ausgelebt sein will. Dieser Instinkt verlangt, sich in soziale Zellen zusammenzufinden, oft nur um sich vom Druck der Umarmung durch Familientraditionen befreien zu können .
.
Vorgegeben werden vorzugsweise hochhehre Zwecke, Ideale der Weltbeglückung, die bei ihrer zentrifugalen Aktivität der zentripetalen Verankerung bedürfen. Der Gedankenflug geht über alle menschlichen Masse hinaus in Dimensionen, die ein Einzelner weder umfassen noch kontrollieren kann. So dimensionierte Geltungsansprüche können nur politisch sein. Der Kommunengründungsboom der Endsechziger- und Siebzigerjahre geriet zur Ruralromatik der sich zu Aussteigern erklärenden Pioniere von Versuchen zur Revolutionierung der bürgerlichen Gesellschaft. Es war ein buntes Kaleidoskop von Farben und Formen beim Blick durch die stets gleiche schwarze Röhre.
Das sind einerseits lässliche Jugendsünden, weil sie den schwierigen Übergang vom Versorgtsein in die gewollte, aber den Betroffenen noch unbekannte Selbstverantwortlichkeit zeichnen, und andrerseits Folgen von infantilen Politspielchen. "Jugendkultur" ist ein zeitgemässer Schlachtruf. Politiker überbieten sich gegenseitig mit grosszügigen Angeboten für die Jugend, behandeln sie sozusagen als "privilegierte Rasse", anstatt als kurzes Durchgangsstadium. Mit grosssprecherischen Subventionen von rechtsfreien Räumen und Förderung des Unnützen, kann die sogenannte Jugend rechnen. Es gibt zudem das aktive Bürgerrecht für strafrechtlich noch Minderjährige. Politisch gefährlich seitenlastig wird die sozialrechtliche Grundregel des "gültig bei Gegenseitigkeit" beseitigt. Der Sehnsucht nach der Ablösung aus dem MANICIPIUM wird vorzeitig stattgegeben. "Die Familie verlassen", erscheint als Tugend in himmlischem Lichte. An deren Stelle haben Pseudofamilien, Kommunen, Radaustosstrupps, Hausbesetzer, Demo-Kollektive von Politvagabunden und urbane Anarchonomaden, Gruppen und Grüppchen zur Erprobung neuer Lebensformen zu treten. Es werden gewissermassen Brücken abgebrochen und die alten Heimstätten verbrannt, um nicht mehr zurück zu können, falls die Einsicht käme, dass die Rückkehr vom endlichen Durchbruch zur Reife zeugen würde.
 . Die dort veröffentlichten Beiträge sind vor allem Zeugnisse dafür, wie Bedürftige eine Neigung zu haben scheinen, die Welt mit ihrer Bedürftigkeit missionarisch zu beglücken.
. Die dort veröffentlichten Beiträge sind vor allem Zeugnisse dafür, wie Bedürftige eine Neigung zu haben scheinen, die Welt mit ihrer Bedürftigkeit missionarisch zu beglücken.Geschichtlich fallen periodisch wiederkehrende Reformbewegungen auf, die erklären, dass ihr Kernanliegen die Änderung des Sozialgefüges sei. "Sinnsuche und Sonnenbad, Experimente in Kunst und Leben auf dem Monte Verità"
 zu Ascona, ist der einleuchtende Titel eines schönen Lesebuches über die Motivation der Reformkommunarden um die Wende aus dem 19. ins 20. Jahrhundert. Der Zugang ist geebnet durch die Zeit, die Lokalisation und die gut dokumentierte Art und Weise des Geschehens. Es war bereits in die Banalität des Gewöhnlichen versunken, als Harald Szeemann
zu Ascona, ist der einleuchtende Titel eines schönen Lesebuches über die Motivation der Reformkommunarden um die Wende aus dem 19. ins 20. Jahrhundert. Der Zugang ist geebnet durch die Zeit, die Lokalisation und die gut dokumentierte Art und Weise des Geschehens. Es war bereits in die Banalität des Gewöhnlichen versunken, als Harald Szeemann 1978 daraus das Thema zu einer überaus gekonnten Ausstellung machte. Wenn der Tessiner Bildungsminister Giuseppe Buffi 1999 bescheinigte, dass "Auch dank dem Monte Verità die Università della Svizzera italiana auf einem kulturell vorbereiteten und fruchtbaren Boden wachsen konnte"
1978 daraus das Thema zu einer überaus gekonnten Ausstellung machte. Wenn der Tessiner Bildungsminister Giuseppe Buffi 1999 bescheinigte, dass "Auch dank dem Monte Verità die Università della Svizzera italiana auf einem kulturell vorbereiteten und fruchtbaren Boden wachsen konnte" , ernannte er sozusagen den Ausstellungskünstler Szeemann zum Geburtshelfer der Tessiner Kulturgeschichte, was denn doch fuori posto scheint, zumal die Naturapostel aus dem ennetbergischen Norden im italienischsprachigen Tessin gutmütiges Gastrecht genossen, sich der Fremdsprache deutsch bedienten und mit der autochthonen Bevölkerung nicht identisch waren; aber immerhin beweist solch ein Enthusiasmus, wie weitgehend das kulturelle Selbstverständnis von der Exhibition einer Seinesgestalt abhängt. Es muss darauf hingewiesen werden, dass auch in diesem Falle das einigende Inkreismotiv weltanschaulicher Natur war, und mit Harald Szeemann von einer anarchisch-romantischen Moralisation lebte.
, ernannte er sozusagen den Ausstellungskünstler Szeemann zum Geburtshelfer der Tessiner Kulturgeschichte, was denn doch fuori posto scheint, zumal die Naturapostel aus dem ennetbergischen Norden im italienischsprachigen Tessin gutmütiges Gastrecht genossen, sich der Fremdsprache deutsch bedienten und mit der autochthonen Bevölkerung nicht identisch waren; aber immerhin beweist solch ein Enthusiasmus, wie weitgehend das kulturelle Selbstverständnis von der Exhibition einer Seinesgestalt abhängt. Es muss darauf hingewiesen werden, dass auch in diesem Falle das einigende Inkreismotiv weltanschaulicher Natur war, und mit Harald Szeemann von einer anarchisch-romantischen Moralisation lebte.
Der Deutsche Bundespräsident Johannes Rau gab mit seinem Staatsbesuch der Schweiz, auf besonderen, eigenen Wunsch, dieser Kultur die Ehre. Bekanntlich ist Helvetia eine Konföderation, deren Kantone als Staaten von relativer Autonomie und untschiedlichen Sprachkulturen definiert sind. Das Tessin ist italienischsprachig und versteht seine Kultur als ebensolche. Johannes Rau wurde also hier als offizieller Gast empfangen und besuchte die Tempel der Standeskultur. Dies waren, gemäss seiner eigenen, einschränkenden Wahl, die gewesene Wohnstatt von Hermann Hesse und die Privatpinakothek von Thyssen-Bornemisza in der Villa Favorita, Lugano-Castagnola, beides deutschherkömmliches Kulturgut, und nichts weiter. Das war zweifellos ein Affront für die Italianità dello Stato della Repubblica e Cantone Ticino, aber auch ein Eigengoal der diplomatischen Politesse des Besuchers. Sicherlich war es keine Begegnung, die Inkreis und Auskreis verbindet.
Auch das erwähnte Lesebuch atmet in jedem Sachbereich die Animation des Ausstellers, ist unterhaltsam nachbarlich vertraut und verliert sich mit der Fülle von Subtotalen im Labyrinth der Einzelheiten, die auf die Frage nach der Natur der Strukturen des psychischen Vorgangs wohl zahlreiche Beispiele und Versuche, aber keine sozialpsychologische Aufschlüsselung geben. Sachlich und ergötzlich schafft der fundierte Beitrag von Albert Wirz : "Sanitorium, nicht Sanatorium. Räume für die Gesundheit", einen verlässlichen Grund unter die, der Realität enthobenen, dem Manierismus nicht abholden Schöngeistigkeit der ortsfremden Kulturschamanisten.
: "Sanitorium, nicht Sanatorium. Räume für die Gesundheit", einen verlässlichen Grund unter die, der Realität enthobenen, dem Manierismus nicht abholden Schöngeistigkeit der ortsfremden Kulturschamanisten.
Die Aufrufe der Naturapostel bezeugen eine Sehnsucht nach dem Zurück in ein natürliches Paradies menschlichen Zusammenlebens. Es war ja nicht nur Jean-Jacques Rousseau mit seinen "Discours sur les arts et les sciences" der solche Sehnsucht verspürte, denn sie ist zu allen Zeitaltern lebendig. Vor dreissig Jahren versuchten beispielsweise die Kommunen um Fritz Teufel und Rainer Langhans uns ein freies Leben in einer Gemeinschaft der Freien vorzuleben
der solche Sehnsucht verspürte, denn sie ist zu allen Zeitaltern lebendig. Vor dreissig Jahren versuchten beispielsweise die Kommunen um Fritz Teufel und Rainer Langhans uns ein freies Leben in einer Gemeinschaft der Freien vorzuleben . "Frei war dabei nur der Nackedei". Die Sehnsucht danach, die kleinste soziale Zelle der Pflichtlosen zu erfahren und deren Prinzipien zum Mass der bürgerlichen Gesellschaft zu machen, war ihnen das erklärtermassen "Revolutionäre". Sie hielten das dann für den Kern des wahrhaft naturmenschlichen Anarchismus und neigten unverfroren auch zur Gewalt, um durchzusetzen, was sich nicht von selbst ergibt. Geblieben sind von diesen Reformvorführungen lediglich Legenden um Versuche, die 20 Jahre Menschenleben nicht überdauerten, Legenden, die allerdings Nachahmer inspirierten, wie die Longo-Mai-Kommunen oder andere neorurale, nicht mehr ganz so nackichten Kleinversuche. In unseren entlegeneren Tälern beleben wenige Überbleibsel stellenweise die schöne Landschaft und kommen in raren Fällen sogar ohne Almosen aus.
. "Frei war dabei nur der Nackedei". Die Sehnsucht danach, die kleinste soziale Zelle der Pflichtlosen zu erfahren und deren Prinzipien zum Mass der bürgerlichen Gesellschaft zu machen, war ihnen das erklärtermassen "Revolutionäre". Sie hielten das dann für den Kern des wahrhaft naturmenschlichen Anarchismus und neigten unverfroren auch zur Gewalt, um durchzusetzen, was sich nicht von selbst ergibt. Geblieben sind von diesen Reformvorführungen lediglich Legenden um Versuche, die 20 Jahre Menschenleben nicht überdauerten, Legenden, die allerdings Nachahmer inspirierten, wie die Longo-Mai-Kommunen oder andere neorurale, nicht mehr ganz so nackichten Kleinversuche. In unseren entlegeneren Tälern beleben wenige Überbleibsel stellenweise die schöne Landschaft und kommen in raren Fällen sogar ohne Almosen aus.
Für unsere Untersuchung ist das Kernempfinden interessant, welches stets aufs neu zu solch alten, gescheiterten Versuchen führt. Es treibt vermutlich die endogene Sehnsucht nach gegenseitigem Schutz in einer Wahlverwandtschaft im "familiären" Inkreis nach Verwirklichung.
Von diesen Lebensexperimenten gab es so nennbare Klassiker, wie es eben auch die Reformbewegung der vegetabilen Gesellschaft auf dem Monte Verità zu Ascona war. Robert Landmann hat, als ideell infizierter Zeitzeuge, eine unmittelbare Chronik dieser, an den Namen Oedenkoven gebundenen Sinnsuche geschrieben , und seine Chronik inspirierte einen Schweif von publizierenden Neuentdeckern. Die Bewegung begann um 1900 und verlief sich in ihrem eigenen Ideenlabyrinth bis 1920. Dann zogen die letzten Unentwegten nach Brasilien.
, und seine Chronik inspirierte einen Schweif von publizierenden Neuentdeckern. Die Bewegung begann um 1900 und verlief sich in ihrem eigenen Ideenlabyrinth bis 1920. Dann zogen die letzten Unentwegten nach Brasilien.
Der Start in das zwanzigste Jahrhundert war offensichtlich von einer besonderen Aufbruchstimmung geprägt, die ganze Heerscharen von Sozialutopisten beflügelte und vom Boden abheben liess, sich dennoch dessen bemächtigend, was sie für den Erdboden hielten. Es gab darunter auch momentbeschränkte Experimente, wie zum Beispiel das der Lebensreformer um das "Gottesreich Amden" des Josua Klein , das bereits nach zwei Jahren gescheitert war. Die Kurzlebigkeit der einzelnen Experimente jener zählebigen, hoffnungsschwangeren Reformträume, beruht auf einem Formfehler der praktischen Umsetzung des natürlichen Impulses. Lebensgemeinschaft und Freiheit bedingen sich zwar gegenseitig, können aber nur in zweifelsfrei gefügter Ordnung von Dauer sein. Ohne klare hierarchische Strukturen gibt es kein lebensfähiges Sozialgefüge.
, das bereits nach zwei Jahren gescheitert war. Die Kurzlebigkeit der einzelnen Experimente jener zählebigen, hoffnungsschwangeren Reformträume, beruht auf einem Formfehler der praktischen Umsetzung des natürlichen Impulses. Lebensgemeinschaft und Freiheit bedingen sich zwar gegenseitig, können aber nur in zweifelsfrei gefügter Ordnung von Dauer sein. Ohne klare hierarchische Strukturen gibt es kein lebensfähiges Sozialgefüge.
Die familiäre Generationenfolge ist der naturgegebenen Sozialgliederung analog. An der Spitze steht die Wirtschaftskompetenz der aktiven Generation, die im Idealfall über sich die Weisheit der grösseren Lebenserfahrung des Ausgedinges anerkennt. Kinder und Kindeskinder sind Basis und Lebenszweck der Aktiven. Die Generationenumschichtung geschieht durch die Verjüngung mit dem Nachwuchs und der natürlichen Alterung der Aktiven. Aus dem gleichen System ergibt sich die Sippenvermehrung durch neue Parallelfamilien. Das bekannte Phänomen der Familientyrannen, das die Familienharmonie pervertiert, gilt analog auch für die soziale Polarisierung von Diktator oben und Volk unten, welches sich durch seine inneren Spannungen letztlich selbst zerstört. Das wichtigste Element für den Dauerbestand sind die Zwischenglieder, wie wir es im Kapitel Strukturierte Vorgänge bereits diskutiert haben. Sie garantieren den Zusammenhalt. Wahrscheinlich ist genau dies das (verdeckte) endogene Motiv der Sehnsucht zurück in rurale Verhältnisse der an der urbanen Anonymität leidenden Sucher. Die Erbfolge ist der Sinn einer lebendigen Familientradition und bleibt gesund, wenn sie in der Absicht der aktiven Generationen liegt. Die eigene Hinterlassenschaft ist denn auch der eigentliche Zweck jeder echten kulturellen Tätigkeit.
Zum Thema der territorialen Ausdehnung können wir im Moment auch das Gegenteil, das heisst die territoriale Schrumpfung beobachten. Diverse Ethnien neigen dazu, ihren Innenbereich gegen den Aussenbereich deutlich abzugrenzen. Der soziale Inkreis wird zum Mass der Dinge. Überschaubare und leicht kontrollierbare Ländereien geben dem erfassbaren, ethnischen Innenbereich feste Form. Die Gefühle neigen mehr zum konkret Möglichen und lassen sich weniger auf die Sehnsucht nach der Allgültigkeit ein, die einstmals zur Gründung grosser Imperien trieb. In den Trend zu kleineren Staatsgebilden, zu Kantonen, Kommunen und Heimstätten, ordnen sich nicht nur Schrumpfungen und der Zerfall grosser Gebilde ein, sondern, sozusagen von unten her, auch die Gründungen kleiner Wirtschaftseinheiten. Im Staate Israel sind diese gegenläufigen Tendenzen anschaulich vertreten. Obwohl Palästina von Semiten bewohnt war, setzt sich nun nicht nur das Bedürfnis durch, arabische von den jüdischen Semiten zu trennen, sondern erstere, wider alle Logik, zudem als Antisemiten abzustempeln.
Ein besonders lohnenswertes Studienobjekt zur Natur der Reformbewegungen, und vor allem zur Dynamik der Rückbesinnung auf den Heimatwert kleiner, übersichtlicher Gruppen, bildet die Geschichte der Kibbuzim, deren Wurzeln so weit zurückreichen wie sich Historie belegen lässt. Kommunistische Zellen sind um vieles älter als der politische Kommunismus. Die Gemeinschaften von freien Mitgliedern kleiner Wirtschaftseinheiten gingen seit jeher das Problem des unverdienten wirtschaftlichen Vorteils oder Nachteils an. Es ist ein Problem, das umsoweniger Lösungen erkennen lässt, je weitläufiger, und damit unübersichtlicher, die Wirtschaftseinheiten werden. Die Spur, die später direkt zur Gründung des Staates Israel führte, wurde durch die zweite Alija (Jugendbewegung) kräftig gezeichnet. Uns liegt umfangreiches Quellenmaterial über die verschiedenen Ansätze von Wirtschaftskommunen vor, das vom Soziologen Hermann Meier-Cronemeyer zusammengetragen und gesichtet worden ist
 . Er bekennt, sein Interesse für die Kibbuzim einer seelischen Affinität zu verdanken und sagt auch, dass jeder Kibbuz sein spezielles Flair habe, das für den Wissenschaftler unbegreiflich sei. Auch weist er auf den praktisch gelebten Anarchismus der Alija hin, dem sich ein ebensolcher ideeller hinzugesellte, und wundert sich über das grundsätzliche Paradoxon, dass ausgerechnet eine Bewegung, die dem Staat abgeschworen hatte, und an dessen Stelle lose verbundene, kleine, überschaubare und selbstverantwortliche Gemeinden setzen wollte, zur Gründung eines neuen Staates führte. Er sagt aber auch, dass die von der Jugendbewegung genährte Strukturromantik, selbst bereits diese militante, zur straffsten Organisation hin tendierende Geisteshaltung barg. Selbstverwirklichung erschien diesen frühen Siedlern erst in der Gemeinschaft, im Gespräch möglich. Es sollte ein "Genossenschaftscommonwealth" an die Stelle der Staatsmächte treten. "Wir sind kein Staat, wir sind einfach eine Genossenschaft, eine grosse Genossenschaft, innerhalb derer es wieder eine Anzahl kleinerer Zweckgenossenschaften gibt"
. Er bekennt, sein Interesse für die Kibbuzim einer seelischen Affinität zu verdanken und sagt auch, dass jeder Kibbuz sein spezielles Flair habe, das für den Wissenschaftler unbegreiflich sei. Auch weist er auf den praktisch gelebten Anarchismus der Alija hin, dem sich ein ebensolcher ideeller hinzugesellte, und wundert sich über das grundsätzliche Paradoxon, dass ausgerechnet eine Bewegung, die dem Staat abgeschworen hatte, und an dessen Stelle lose verbundene, kleine, überschaubare und selbstverantwortliche Gemeinden setzen wollte, zur Gründung eines neuen Staates führte. Er sagt aber auch, dass die von der Jugendbewegung genährte Strukturromantik, selbst bereits diese militante, zur straffsten Organisation hin tendierende Geisteshaltung barg. Selbstverwirklichung erschien diesen frühen Siedlern erst in der Gemeinschaft, im Gespräch möglich. Es sollte ein "Genossenschaftscommonwealth" an die Stelle der Staatsmächte treten. "Wir sind kein Staat, wir sind einfach eine Genossenschaft, eine grosse Genossenschaft, innerhalb derer es wieder eine Anzahl kleinerer Zweckgenossenschaften gibt" .
.Das Funktionsgesetz, dem diese Idee entsprang, haben wir mit der graphischen Darstellung des Beziehungsfeldes der Identitäts-Intimitätsbereiche veranschaulicht. So funktionieren alle Gesellschaften während ihrer Permanenz. Was Theodor Herzl als gemeinschaftsorientiertes Ideal vorschwebte, war die Entdeckung der natürlichen Struktur dieser Sozialdynamik. Er hatte nur den Aspekt der Verdrängung weggelassen, mit dem sich Sozietäten in die Quere kommen, und eine solche Bedrohung spornt zu Selbsterhaltungsleistungen an. Dieser Verdrängungsimpuls sorgt einerseits für die Expansion des eigenen Inkreisbereichs, und verwehrt andrerseits die Expansion anderer, die auf Kosten des eigenen Territoriums gänge. Ohne diese Expansion (Wirkmal) fehlt der Struktur die Motivation (Merkmal) und der Antrieb zu jedwelcher Aktivität, jedoch vorwiegend solche, oekonomischer Erfolgsausrichtung. Das ist die Basis des realen Politikums, das schliesslich als Macht in Erscheinung tritt. Diese aktive Auseinandersetzung verschiedener Beziehungskreise, die alle von gleicher Struktur sind, sichern endlich das Auf und Ab der Geschichte, deren Schauplatz sich, je nach Prägnanz und Vitalität ihres Fokus, geographisch verlagert. Von dieser Struktur hängt nicht nur die Wichtigkeit und die Vielfalt der sozialen Körperschaften, von Werkplätzen, Parteien, Nationen und Imperien ab, sondern, nach innen gesehen, auch das Wohlbefinden und das Wohlgefühl des individuellen Stolzes auf die Zugehörigkeit zu einer erfolgreichen Gruppe, Familie, Sippe, Stand, Nation und Rasse (wie schwierig diese auch zu definieren sei). Ein anderes Unruhepotential ist mit dem unverdienten Nutzniess gegeben, einem Phänomen, das sofort auftritt, wenn Sättigung und Überschuss den Erfolg der Gemeinschaft sichtbar werden lässt. Die Schmarotzer hängen am Sozialköper wie Egel, und es ist jedenfalls schwierig, sich von diesen zu befreien. Falls eine Sozietät gewissermassen zur Verfettung neigt, hat sie eher die Tendenz, die Sauger gewähren zu lassen. Schröpfen kann ja auch der Steuerung des Stoffwechsels dienen. Auswuchernder Parasitenbefall könnte das System jedoch zum Kollaps führen.
 , und so gründeten diese Idealisten dann 1904 ihre "naturnahe Kommune", die in ihrem Umfang allerseits von allen kontrollierbar, als eine Familie von Wahlverwandten übersichtlich blieb
, und so gründeten diese Idealisten dann 1904 ihre "naturnahe Kommune", die in ihrem Umfang allerseits von allen kontrollierbar, als eine Familie von Wahlverwandten übersichtlich blieb .
.Es muss die Frage gestellt werden, wieso die Geschichte der Kubbuzim beweist, dass die Gliederung der Erhaltung und Beständigkeit einer Gesellschaftsordnung dient, während andere, im Ansatz ähnliche Siedlungsversuche von "Aussteigern", 20 Jahre Bestand nicht überlebten. Die Antwort gibt Meier-Cronemeyer
 mit seinem Hinweis auf das vermeintliche Paradoxon, dass im Falle der Alija aus anarchischen Idealen eine Nation entstand. Die Sehnsucht nach Geborgenheit widerspricht der abenteuerlichen Idee von einer befreienden Strukturlosigkeit. Freiheit hat eine völlig andere Genese, wie wir schon diskutiert haben. Der Zusammenhalt im Herzl-Konzept wurde durch den äusseren Druck einer feindlichen Umwelt eingeleitet, der zu den notwendigen Strukturen zwang, die zwar im Konzept enthalten, aber verbaliter nicht ihrer Funktionsweise gemäss formuliert worden waren. Die Struktur nämlich erweist sich als ein hierarchisches Muster der Gliederung in verschiedene Dichtigkeitsbereiche. Ohne das so entstehende Verantwortlichkeitsgefälle der Fähigkeiten, wird die blosse Erklärung von Beziehungskreisen zur reinen Romantik, denn Anarchismus wird zum Grab der Freiheitssehnsucht.
mit seinem Hinweis auf das vermeintliche Paradoxon, dass im Falle der Alija aus anarchischen Idealen eine Nation entstand. Die Sehnsucht nach Geborgenheit widerspricht der abenteuerlichen Idee von einer befreienden Strukturlosigkeit. Freiheit hat eine völlig andere Genese, wie wir schon diskutiert haben. Der Zusammenhalt im Herzl-Konzept wurde durch den äusseren Druck einer feindlichen Umwelt eingeleitet, der zu den notwendigen Strukturen zwang, die zwar im Konzept enthalten, aber verbaliter nicht ihrer Funktionsweise gemäss formuliert worden waren. Die Struktur nämlich erweist sich als ein hierarchisches Muster der Gliederung in verschiedene Dichtigkeitsbereiche. Ohne das so entstehende Verantwortlichkeitsgefälle der Fähigkeiten, wird die blosse Erklärung von Beziehungskreisen zur reinen Romantik, denn Anarchismus wird zum Grab der Freiheitssehnsucht.Demokratie ohne Hierarchie ist funktionsunfähig, weil die Ordnungsstruktur des Kompetenzgefälles fehlen würde, das den Selbstschutz der Gemeinschaft darstellt.
Unsere Tugenden, die sogenannten inneren Werte, müssen auch auf die Probe gestellt werden, um als solche zu wirken. Es sind Wirkmale aus dem Unbewussten. Fast schon verlorengeglaubte, weil für lange Zeit nicht beanspruchte Reflexe, werden durch Gefahrenmerkmale aufgeschreckt und lebhaft tätig. Es sind vor allem die Identitätsbereiche, die auf ihre Nützlichkeit und Haltbarkeit erprobt werden müssen, um frisch zu bleiben. Gewisse Bequemlichkeiten, die durch deren Schutzwirkung entstehen, wirken langweilig bis einschläfernd, wenn sie keiner Provokation ausgesetzt sind. So macht es den Anschein, dass die Gefährdung von aussen nötig ist, um das Wir-Bewusstsein zu stärken, und dass andrerseits Müssiggang und genossenes Wohlwollen die Identitätslinien aufweichen. Praktische Beispiele dafür liefern die Kibbuzim, die sich besonders als ein Mittel zur Kolonisation in Krisengebieten und in Krisenzeiten bewährten, während sie im gesicherten jüdischen Siedlungsraum, ihrer Stossrichtung beraubt, die Geschlossenheit verloren.
Bundesräte verleumden ihre Wähler als "Rosinenpicker" um, anlässlich multinationaler Verhandlungen, die eigene schlechte Figur zu verhüllen. Ein Bundespräsident "entschuldigt" SICH öffentlich von Amtes wegen, für Vergehen seiner Vorgänger, die diese gar nicht begangen hatten, posthum, nach mehr als 60 Jahren
 . Die offizielle Schweiz bücklingt gar wegen eines ungetreuen Altpapierdiebes, der von einem allgegenwärtigen privaten Weltkongress zum "one of the century's great heroes" (Helden aller Zeiten) für seinen Abfalldiebstahl ausgerufen wurde. Falls solche Erniedrigungen nicht eine Rückbesinnung auf die nationale Würde einleiten, wird die Schweiz bald zur blossen Fabelvorlage zu einem Schaupiel von Friedrich Schiller schrumpfen, und beim jüdischen Weltkongress in den USA ist der Wilhelm Tell bereits durch den Helden Christoph Meili ersetzt.
. Die offizielle Schweiz bücklingt gar wegen eines ungetreuen Altpapierdiebes, der von einem allgegenwärtigen privaten Weltkongress zum "one of the century's great heroes" (Helden aller Zeiten) für seinen Abfalldiebstahl ausgerufen wurde. Falls solche Erniedrigungen nicht eine Rückbesinnung auf die nationale Würde einleiten, wird die Schweiz bald zur blossen Fabelvorlage zu einem Schaupiel von Friedrich Schiller schrumpfen, und beim jüdischen Weltkongress in den USA ist der Wilhelm Tell bereits durch den Helden Christoph Meili ersetzt.
Die Möglichkeit der Zuflucht in eine nichtreale Wunschwelt ist so lange eine Gnade, wie sich der Visionär nicht den Anforderungen der realen Existenzbedingungen stellen muss. Damit sie gemeistert werden können, müssen sie zuerst erkannt sein.
 . Die Religiosität hat viele Töchter, das heisst verschiedene Ausdrucksvarianten in Form religiöser Bekenntnisse und deren Kirchen. Nicht eine Tochter hat viele Mütter, sondern es ist umgekehrt: Die eine Mutter der Religionen ist das religiöse Empfinden, das allen verschiedenen Bekenntnisformen zugrundeliegt. Religion führt zur ersten Kulturstufe, mit fliessenden Übergängen zur Philosophie, welche wiederum den Eintritt in die Wissenschaften bereitet. Die ritualisierte Verhaltensweise wird zur Empfindensnorm, zum Wirkmal des Identitätsbeweises. Sekten, soziale Gruppierungen und politische Einheiten werden umso verpflichtender, je ausschliesslicher sie auftreten, je strenger ihre innere Zugehörigkeit normiert ist. Deshalb sind weltanschauliche Dominanten in ihrem Wesen tendenziell intolerant, selbst dann, wenn die Toleranz zu ihren Idealen zählt. Verbote und Gebote zeichnen die Charta der Zusammengehörigkeit und schliessen nonkonforme Existenzen aus ihrer Protektion aus. Gedanken- und Redefreiheit bestehen nur im Spielbereich der Zustimmung.
. Die Religiosität hat viele Töchter, das heisst verschiedene Ausdrucksvarianten in Form religiöser Bekenntnisse und deren Kirchen. Nicht eine Tochter hat viele Mütter, sondern es ist umgekehrt: Die eine Mutter der Religionen ist das religiöse Empfinden, das allen verschiedenen Bekenntnisformen zugrundeliegt. Religion führt zur ersten Kulturstufe, mit fliessenden Übergängen zur Philosophie, welche wiederum den Eintritt in die Wissenschaften bereitet. Die ritualisierte Verhaltensweise wird zur Empfindensnorm, zum Wirkmal des Identitätsbeweises. Sekten, soziale Gruppierungen und politische Einheiten werden umso verpflichtender, je ausschliesslicher sie auftreten, je strenger ihre innere Zugehörigkeit normiert ist. Deshalb sind weltanschauliche Dominanten in ihrem Wesen tendenziell intolerant, selbst dann, wenn die Toleranz zu ihren Idealen zählt. Verbote und Gebote zeichnen die Charta der Zusammengehörigkeit und schliessen nonkonforme Existenzen aus ihrer Protektion aus. Gedanken- und Redefreiheit bestehen nur im Spielbereich der Zustimmung.
 ! welch erhabene Hymne an die Freude, die uns allen das himmlisch Hehre erschliesst. Der Text, von Friedrich Schiller, ist mit der gewaltigen Melodie der Sinfonie aus einem Guss
! welch erhabene Hymne an die Freude, die uns allen das himmlisch Hehre erschliesst. Der Text, von Friedrich Schiller, ist mit der gewaltigen Melodie der Sinfonie aus einem Guss . Das edle Herz will zerspringen vor allumfassender Güte. "Alle Menschen werden Brüder!" die globale Ausweitung des Intimen, "diesen Kuss der ganzen Welt" gewidmet, ist eine Expansion des Ichgefühls über alle Identitätsbereiche hinaus. "Ja – wer auch nur eine Seele sein nennt, auf dem Erdenrund! Und wer's nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund!" Beim Genius (und nicht beim Genus) ist die Grenze, das Mass, die Bedingung. Ich-Wir-Ihr-und Sie, die anderen -, auf den Auskreis wird selbst bei einem so göttlichen Hochgefühl gewiesen. Aussenseiter, in ihrer minderwertigen Gefühlsarmut, werden bedauernd vor die Tür der Edlen beordert. Sogar in dieser Dimension der Verbrüderung gilt ein Innen und Aussen. Wenn, wann und wo auch immer Menschen aufeinander einschlagen, handelt es sich also doch nicht nur um Bruderkriege.
. Das edle Herz will zerspringen vor allumfassender Güte. "Alle Menschen werden Brüder!" die globale Ausweitung des Intimen, "diesen Kuss der ganzen Welt" gewidmet, ist eine Expansion des Ichgefühls über alle Identitätsbereiche hinaus. "Ja – wer auch nur eine Seele sein nennt, auf dem Erdenrund! Und wer's nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund!" Beim Genius (und nicht beim Genus) ist die Grenze, das Mass, die Bedingung. Ich-Wir-Ihr-und Sie, die anderen -, auf den Auskreis wird selbst bei einem so göttlichen Hochgefühl gewiesen. Aussenseiter, in ihrer minderwertigen Gefühlsarmut, werden bedauernd vor die Tür der Edlen beordert. Sogar in dieser Dimension der Verbrüderung gilt ein Innen und Aussen. Wenn, wann und wo auch immer Menschen aufeinander einschlagen, handelt es sich also doch nicht nur um Bruderkriege.
 . Das Wissen um die postnatale Prägung der noch in Entwicklung begriffenen Hirnpotentiale und um die Vorprogrammierung späterer Verhaltensmuster, im Verhältnis zur endogenen Programmierung, kann als gesichert gelten
. Das Wissen um die postnatale Prägung der noch in Entwicklung begriffenen Hirnpotentiale und um die Vorprogrammierung späterer Verhaltensmuster, im Verhältnis zur endogenen Programmierung, kann als gesichert gelten /
/ . Die unter den Referenznummern angegebene Literatur der vorliegenden Diskussion zum Thema "Strukturen der mentalen Wirklichkeit", ist natürlich nicht erschöpfend. Vom Angebot der Publikationen über das Phänomen Massen und ihre Führer wurde nicht Gebrauch gemacht, obwohl unser Thema dazu in enger Beziehung steht.
. Die unter den Referenznummern angegebene Literatur der vorliegenden Diskussion zum Thema "Strukturen der mentalen Wirklichkeit", ist natürlich nicht erschöpfend. Vom Angebot der Publikationen über das Phänomen Massen und ihre Führer wurde nicht Gebrauch gemacht, obwohl unser Thema dazu in enger Beziehung steht.Wer sich ernsthaft um grösstmöglichen Pragmatismus bemüht, wäre gut beraten, sich anhand der spezifischen Literatur sachkundig zu machen. Sein Problem wird dennoch das der Auslese sein, denn gerade auf diesem Gebiete gedeihen auch die romantischsten Spekulationen. Jede psychoaktive Unternehmung setzt mit der eigenen Appetenz ein, und so werden wir vor allem das lesen wollen, was unserem Selbstgefühl schmeichelt; aber so ist es schon den Autoren ergangen, die uns ihre Sicht der Dinge offerierten.
TOCZur Erforschung der Psyche werden viele Wege begangen. Sie sind abhängig von der Definition ihres Forschungsgegenstandes. Wenn nicht die Ungewissheit um die wahre Natur der Psyche verbliebe, könnten alle Wege der Annäherung in ihrer Gesamtheit ein rundes Bild derselben ergeben. Von welcher Seite her wir uns auch dem Forschungsobjekte nähern, wissen wir nicht, wie nahe wir ihm schon sind, denn wir haben ja nur Vorstellungen seiner Gestalt, und nur Ansätze der Gewissheit der Formen seines Seins. Andrerseits sollen wir uns weder ein Bildnis noch Gleichnis unseres Ebenbildes machen
 , denn fester Glaube schützt das Gemüt vor dem Verstand. Und doch treibt uns ein Bedürfnis nach dem Verstehen dessen, was uns in forschende Unrast versetzt, uns in das Gestrüpp des Irrgartens der Dialektik lockt. Glück allen, die dabei den Faden der Ariadne nicht verlieren, wenn sie sich in dieses Labyrinth wagen! Jeder Schritt muss kontrollierbare Spuren hinterlassen. Diese Anforderung wird nicht von jedem Zweig der Geisteswissenschaften erfüllt, obwohl sie die Voraussetzung für seriöse Forschungsarbeit ist. Exakte Ergebnisse sind die Bausteine wahren Wissens. Einen hoffnungsvollen Ausblick auf exakte Ergebnisse erschliesst uns die Elektronik
, denn fester Glaube schützt das Gemüt vor dem Verstand. Und doch treibt uns ein Bedürfnis nach dem Verstehen dessen, was uns in forschende Unrast versetzt, uns in das Gestrüpp des Irrgartens der Dialektik lockt. Glück allen, die dabei den Faden der Ariadne nicht verlieren, wenn sie sich in dieses Labyrinth wagen! Jeder Schritt muss kontrollierbare Spuren hinterlassen. Diese Anforderung wird nicht von jedem Zweig der Geisteswissenschaften erfüllt, obwohl sie die Voraussetzung für seriöse Forschungsarbeit ist. Exakte Ergebnisse sind die Bausteine wahren Wissens. Einen hoffnungsvollen Ausblick auf exakte Ergebnisse erschliesst uns die Elektronik  . Messdaten über varie Formen der relativen Psychoaktivität gibt uns das Elektroenzephalogramm, beispielsweise zum Biofeedback oder dem Autogenen Training. Gedankenlesen ist natürlich nicht möglich, aber das Engagement für einen Gedanken kann gemessen werden. Die Intensität der Beteiligung ist messbar, aber nicht die Logik eines Gedankens. Der unausgesprochene Gedanke ist nicht lesbar, aber die Erregung verrät die Spezifität seines Gemütsstatus. Neurometrisch messbar ist die Beschaffenheit der Intensität einzelner Funktionen, aber die themenspezifischen Inhalte bleiben dabei undefiniert. Die unbewusste Psychodynamik äussert sich in Vorgängen des sozialen Zusammenspiels, wie zum Beispiel im Sündenbock-Mechanismus. Der Soziologe K.O. Hondrich
. Messdaten über varie Formen der relativen Psychoaktivität gibt uns das Elektroenzephalogramm, beispielsweise zum Biofeedback oder dem Autogenen Training. Gedankenlesen ist natürlich nicht möglich, aber das Engagement für einen Gedanken kann gemessen werden. Die Intensität der Beteiligung ist messbar, aber nicht die Logik eines Gedankens. Der unausgesprochene Gedanke ist nicht lesbar, aber die Erregung verrät die Spezifität seines Gemütsstatus. Neurometrisch messbar ist die Beschaffenheit der Intensität einzelner Funktionen, aber die themenspezifischen Inhalte bleiben dabei undefiniert. Die unbewusste Psychodynamik äussert sich in Vorgängen des sozialen Zusammenspiels, wie zum Beispiel im Sündenbock-Mechanismus. Der Soziologe K.O. Hondrich  sagt dazu: "Durchschauen können wir den Sündenbock-Mechanismus immer nur für das, was hinter uns liegt. Allenfalls wäre es denkbar, Wildwuchs und Willkür von Sündenbock-Prozessen in die Bahnen einer Ritualisierung zu lenken, wie sie die alten Gesellschaften kannten."
sagt dazu: "Durchschauen können wir den Sündenbock-Mechanismus immer nur für das, was hinter uns liegt. Allenfalls wäre es denkbar, Wildwuchs und Willkür von Sündenbock-Prozessen in die Bahnen einer Ritualisierung zu lenken, wie sie die alten Gesellschaften kannten."Eine andere Wirkweise eines Inkreismechanismus hat Cyril Northcote Parkinson
 beschrieben und quasi als naturgesetzlichen Ablauf, wenn auch ironisierend, definiert. Es handelt sich dennoch um das Protokoll der Beobachtung des progredierenden Verlaufs eines sozialen Inkreisphänomens: Die eigendynamische Entwicklung bürokratischer Verwaltungen zu aufgeblähten Apparaten, die sich zunehmend selbst als Zweck ihrer Existenz beweisen. Beamte und Angestellte verschaffen sich gegenseitig Arbeit und somit das Alibi ihrer Unabkömmlichkeit.
beschrieben und quasi als naturgesetzlichen Ablauf, wenn auch ironisierend, definiert. Es handelt sich dennoch um das Protokoll der Beobachtung des progredierenden Verlaufs eines sozialen Inkreisphänomens: Die eigendynamische Entwicklung bürokratischer Verwaltungen zu aufgeblähten Apparaten, die sich zunehmend selbst als Zweck ihrer Existenz beweisen. Beamte und Angestellte verschaffen sich gegenseitig Arbeit und somit das Alibi ihrer Unabkömmlichkeit.Vielfältig sind die Wege der Erkenntnis selbst innerhalb einer Schule, wie zum Beispiel des Behaviorismus
 /
/ /
/ . Der Realität gerecht wäre dann womöglich eine relativierte Form desselben, und das ist gut so. Verschiedene Gesichtspunkte und Gewichtungen könnten schliesslich ein Rundumpanorma des Sachgebietes ergeben. Es sollte auch selbstverständlich sein, sich nicht von nur einer Schule vereinnahmen zu lassen. Besonders sogenannten Tiefenpsychologien, die ein Bekenntnis zur ausschliesslichen Gültigkeit einer festgeschriebenen Ansicht verlangen, ist zu misstrauen; denn das wäre sektiererisch, wie ein allein seligmachendes Religionsbekenntnis, mit gleichen Vor- und Nachteilen, aber keine wissenschaftlich begründete Erkenntnis. Ausgangsperspektive für die Auseinandersetzung mit dem Thema sollte die biologische Psychologie
. Der Realität gerecht wäre dann womöglich eine relativierte Form desselben, und das ist gut so. Verschiedene Gesichtspunkte und Gewichtungen könnten schliesslich ein Rundumpanorma des Sachgebietes ergeben. Es sollte auch selbstverständlich sein, sich nicht von nur einer Schule vereinnahmen zu lassen. Besonders sogenannten Tiefenpsychologien, die ein Bekenntnis zur ausschliesslichen Gültigkeit einer festgeschriebenen Ansicht verlangen, ist zu misstrauen; denn das wäre sektiererisch, wie ein allein seligmachendes Religionsbekenntnis, mit gleichen Vor- und Nachteilen, aber keine wissenschaftlich begründete Erkenntnis. Ausgangsperspektive für die Auseinandersetzung mit dem Thema sollte die biologische Psychologie sein, ergänzt mit mindestens einem guten Fachwörterbuch der medizinischen und allgemeinen Psychologie
sein, ergänzt mit mindestens einem guten Fachwörterbuch der medizinischen und allgemeinen Psychologie . Darin hat auch die Sexologie ihren Platz. Theoreme, die es bei Appetenz und Durchgang zur Ejakulation und Orgasmus belassen, sind auf einen Sektor des Appetenzphänomens beschränkt und tragen keinen Deut zur Wissenschaft bei. Mit irren Phantasien dazu, sind wir durch die Trivialliteratur reichlich versorgt. Es braucht zu diesem Spielplatz keine weiteren Theorien. Praktische Einrichtungen in dem Gefilde, sind nicht therapeutische Institute, sondern Anstalten zur Versorgung der Klientel und Dauerkundschaft, welche den Erfolg garantieren, der an der Kasse gemessen wird. Erfolg ist kein wissenschaftlicher Beweis, sollte jedoch Gegenstand der Forschung im Rahmen der politischen Wissenschaften Soziologie, Statistik, Kommunikation und Oekonomie sein.
. Darin hat auch die Sexologie ihren Platz. Theoreme, die es bei Appetenz und Durchgang zur Ejakulation und Orgasmus belassen, sind auf einen Sektor des Appetenzphänomens beschränkt und tragen keinen Deut zur Wissenschaft bei. Mit irren Phantasien dazu, sind wir durch die Trivialliteratur reichlich versorgt. Es braucht zu diesem Spielplatz keine weiteren Theorien. Praktische Einrichtungen in dem Gefilde, sind nicht therapeutische Institute, sondern Anstalten zur Versorgung der Klientel und Dauerkundschaft, welche den Erfolg garantieren, der an der Kasse gemessen wird. Erfolg ist kein wissenschaftlicher Beweis, sollte jedoch Gegenstand der Forschung im Rahmen der politischen Wissenschaften Soziologie, Statistik, Kommunikation und Oekonomie sein.
 stammt der vielleicht etwas bissige Kommentar, dass die Psychoanalyse die Krankheit sei, für deren Heilung sie sich halte. Wir müssen jedoch Sigmund Freud zugutehalten, dass er dem zwanzigsten Jahrhundert eine Perspektive erschloss, die der Wissenschaft eine Bresche durch die Glaubensdschungel schlug, deren Sümpfe noch immer nicht trockengelegt sind. Magie, Schamanismus, Hellseherei, Astrologie, Vision, Magnetopathie und Geistprognostik wie Geistheilung sind noch immer die Pseudorealwelt entsprechender Bedürfnisse. Diese Bedürftigkeit eben, konnte von den geläufigen Tiefenpsychologien nicht abgegolten werden. Daraus schliessen, dass eben in den Kenntniskonzepten entsprechende Lücken bestehen, liegt nahe, zumal Freud's Adept C.G. Jungnoch sehr vieler Mystik Raum bietet, in der auch Tarok und Mandala samt Liä Dsii wie I Ging Platz haben. Es ist nicht vorbeigegriffen wenn festgestellt wird, dass auch der Vater der Psychoanalyse eitel genug war, sich für den Hohepriester seiner neuen Mysterien der Seelenschau zu etablieren. Der Sozialbezug psychischer Vorgänge ist mit eben diesen Details ersichtlich, aber analytisch nicht ausgeführt. Die modernen Psychologien sind monoform egozentrisch angelegt, obwohl sich in der Tat herausstellt, dass dies ein soziopathischer Irrtum sein muss. Die publizistischen Erfolge jener Sicht der Dinge, haben vor allem zu einer Vielzahl von Ablegern der Grundthesen geführt, gewissermassen zur sektierischen Aufsplitterung des Glaubens an die nur einzig mögliche Wahrheit des Realitätsbezuges. Mittlerweile hat es uns in das einundzwanzigste Jahrhundert versetzt, und so könnte es doch sein, dass die soziale Identitätspsychologie die monoklinische, theoretische Individualmanie des zwanzigsten Jahrhunderts ablösen wird, zumal wir mit Sex, Ego, Penisneid, Vatermord und Ödipuskomplex in reichlicher Ideenvielfalt bis zum Vomitus abgefüllt worden sind.
stammt der vielleicht etwas bissige Kommentar, dass die Psychoanalyse die Krankheit sei, für deren Heilung sie sich halte. Wir müssen jedoch Sigmund Freud zugutehalten, dass er dem zwanzigsten Jahrhundert eine Perspektive erschloss, die der Wissenschaft eine Bresche durch die Glaubensdschungel schlug, deren Sümpfe noch immer nicht trockengelegt sind. Magie, Schamanismus, Hellseherei, Astrologie, Vision, Magnetopathie und Geistprognostik wie Geistheilung sind noch immer die Pseudorealwelt entsprechender Bedürfnisse. Diese Bedürftigkeit eben, konnte von den geläufigen Tiefenpsychologien nicht abgegolten werden. Daraus schliessen, dass eben in den Kenntniskonzepten entsprechende Lücken bestehen, liegt nahe, zumal Freud's Adept C.G. Jungnoch sehr vieler Mystik Raum bietet, in der auch Tarok und Mandala samt Liä Dsii wie I Ging Platz haben. Es ist nicht vorbeigegriffen wenn festgestellt wird, dass auch der Vater der Psychoanalyse eitel genug war, sich für den Hohepriester seiner neuen Mysterien der Seelenschau zu etablieren. Der Sozialbezug psychischer Vorgänge ist mit eben diesen Details ersichtlich, aber analytisch nicht ausgeführt. Die modernen Psychologien sind monoform egozentrisch angelegt, obwohl sich in der Tat herausstellt, dass dies ein soziopathischer Irrtum sein muss. Die publizistischen Erfolge jener Sicht der Dinge, haben vor allem zu einer Vielzahl von Ablegern der Grundthesen geführt, gewissermassen zur sektierischen Aufsplitterung des Glaubens an die nur einzig mögliche Wahrheit des Realitätsbezuges. Mittlerweile hat es uns in das einundzwanzigste Jahrhundert versetzt, und so könnte es doch sein, dass die soziale Identitätspsychologie die monoklinische, theoretische Individualmanie des zwanzigsten Jahrhunderts ablösen wird, zumal wir mit Sex, Ego, Penisneid, Vatermord und Ödipuskomplex in reichlicher Ideenvielfalt bis zum Vomitus abgefüllt worden sind.
Der engste Bezirk des soziologischen Inkreises ist das Individuum, das Unteilbare, also die Persönlichkeit selbst. Es findet seine Realität mit seiner Beziehung zum Umfeld. Geschieht dies nicht, so haben wir es mit einer schweren Dysfunktion zu tun, mit dem Autismus, der auch als eine Negation des Menschseins gesehen werden kann. Die soziale Beziehung schafft erst die Möglichkeit zur sinnvollen Funktion des psychischen Organismus. Dem engen Kreis der Ich-Du Intimität steht das Feld des erweiterten Wir gegenüber, das an der dualen Intimität teilhat, und zwar, wenn auch vornehmlich objektiv, so doch auch in subjektiver Anteilnahme. Die Auskreisbezirke des Ihr und der weiteren Sozialbeziehungsfelder, sind der subjektiven Qualität der Beteiligung fern. Deren Neugier richtet sich auf das, von dem sie sich ausgeschlossen wähnen. Das wird zu einer latenten Insistenz, die Grenzlinie des Intimen aufzubrechen. Gelingt dies, dann verliert die Inkreisidentität ihren Bezugsrahmen. Die in sich geschlossene Selbstsicherheit wandelt sich in Unsicherheit, die einzelnen Komponenten des gewesenen Inkreises werden beeinflussbar und zugänglich für Ganzheitsideen religiösen, politischen und ideologischen Ursprungs. Es ist wie mit dem Bauern, der seinen Besitz oder Existenzboden verliert, und sich so eine neue Existenzphilosophie sucht. Er lebt in der Folge von den Angeboten einer neuen Erwerbsgrundlage. So etwas hat seine Bedeutung nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Identitätseinheiten grösseren Umfanges, wie für überholte Berufe, für Stände, Bürgerschaften, Kulturkreise, und unter letzteren besonders für die Sprachkulturen von Minderheiten jedwelcher Grösse, die in einen umfassenderen Machtbereich aufzugehen haben. Mit dem Identitätsverlust brechen Unsicherheiten auf, die zur Instabilität der psychischen Gesundheit führen.
Es wäre zwar zeitgemäss, aber nach dem hier Dargestellten unsinnig, nun den Zukunftsvisionär zu mimen und neue Zeitalter zu prophezeien; denn jedes Neue von heute ist morgen so alt wie das Neueste übermorgen sein wird. Wir gehören zu den Seienden. Was nach uns kommt, geschieht in unserer Abwesenheit, aber was jetzt ist, dürfen wir mitgestalten und durchstehen. Es dürfte menschlich sein, sofern wir menschlich fühlen. Wir sind die Akteure dieser Generation und haben hier keine Bleibe. Wer möchte gross angeben eine Zukunft zu verstehen, die er niemals erleben wird, wenn er es schon mit der Vergangenheit nicht schafft, geschweige denn mit seiner Gegenwart? Lieben und pflegen wir sie, sie wird es uns vergüten.
TOCZusammenfassung
Die Instinktforschung im Rahmen der Biologie und Ethologie hat uns zur Einsicht in naturgeschichtliche Entwicklungen geführt, die auch für die Spezies Mensch gelten.
Das Empfindungsspektrum ist zerebral festgelegt und in Strukturen der subjektiven Innenwelt organisiert. Für das Individuum sind sie endogen, weil sie mit der Evolution seiner Spezies zu seinen Merk- und Wirkorganen wurden. (Funktionskreis von Uexküll).
Wirkmale orientieren sich an Merkmalen, um zu ihrer Auswirkung zu kommen. Es sind aufeinanderbezogene Schlüsselreize. Diese Abläufe geschehen nach Normmustern, die real verschieden besetzt sein können, das heisst die Aktualität ist zwar momentgerecht jeweilen neu, aber die Vorgänge sind alt.
Einige Strukturen solcher Vorgänge wurden hier dargestellt, besonders psychopassive-psychoaktive Verlaufsformen, Inkreis-Auskreis-Funktionen und die Bindungsdichte der kollektiven Identität.
Es ist die Dynamik die uns belebt, und nicht die Maske, auf die wir reagieren. Es sind die Wirkmale und die Merkmale, nach denen wir Ausschau halten, die unsere Psychodynamik bestimmen, um unsere Psychoaktivität sinnfälllig ausleben zu können, denn die latenten Triebe sind nicht monolothisch sondern dynamisch und brauchen zu ihrer Aktivierung Reizvorgaben.
Triebe stillen angediente Bedürfnisse, die ihnen, begrifflich auch verfremdet, unterlegt werden können. Die soziale Dynamik wird durch Inkreis-Auskreis-Konstellationen bestimmt, wie sie der grammatische Aufbau der Personalpronomina zeichnet.
Soziale Befindlichkeit lässt sich am Umgang mit der Sprachkultur ablesen. Sie offenbart die Qualität des Selbstbewusstseins auf jeder Identitätsstufe.
Subjektive Befindlichkeit ist ein, von den Wechselwirkungen im soziologischen Inkreis abhängiger Status.
Die "Begegnung" an den Trennlinien zwischen sozialem Inkreis und Auskreis ist das Werteschaffende und nicht die Einvernahme, die jede Einzelidentität der sozialen Inkreise in Konformitätsnormen zu pressen sucht. Das Wirkmal in der Begegnung ist die Neugier auf Anregung, Aufregung und Wandlung.
TOCQuellenregister
*ADLER, Alfred (1923): "Praxis und Theorie der Individualpsychologie." Wien.
*o. V. (2002): ARBEITSKREIS gelebte Geschichte: "Erpresste Schweiz - Eindrücke und Wertungen von Zeitzeugen." Th. Gut. Stäfa.
*BAERLOCHER, Felix (1999): "Die evolutionäre Erkenntnislehre. Wie das menschliche Gehirn zum Denken kam." In: NZZ Nr. 63. Zürich.
*BALINT, Michael (1959): "Angstlust und Regression." Stuttgart.
*BARBUSSE, Henry (fr. 1916, dt. 1918): "Das Feuer."
*BERGIER-KOMMISSION (2002): Der Schlussbericht: "Die Schweiz, der Nationalsozialismus und der zweite Weltkrieg." Pendo. Zürich.
*BERNE, Eric (1967): "Spiele der Erwachsenen. Psychologie der menschlichen Beziehungen." Rowohlt Sachbuch. Hamburg.
*BIRBAUMER, Niels/ Schmidt, Robert F.(1989): "Biologische Psychologie." Springer Lehrbuch. Berlin, New York.
*BOETHIUS: "Trost der Philosophie (5,1)."
*BUFFI, Giuseppe (1999): "10 anni di Fondazione Monte Verità e Centro Franscini."
In: Lafranchi, Claudia (Hg.). Locarno. 1999.
*o. V. (2001): "Bundesratserklärung vom 05.06.2001." In: NZZ. 06. Juni. Zürich.
*CHOMSKY, Noam (1965): "Aspects of the Theory of Syntax." Cambridge.
*CICERO: "de officiis I 10,33."
*COMMISSIONE Indipendente d'Esperti; Svizzera – Seconda Guerra Mondiale; Rapporto intermedio (1998):
"La Svizzera e le transazioni in oro durante la Seconda Guerra Mondiale."
Distributore VCFSM Berna.
*COUCHEPIN, Pascal (2001): Referat: "Sind Staaten noch souverän? " Vor der Société des Officiers du Valais Romand, vom 24.03.2001. Martinach.
*CRAIG, Wallace (1918): "Appetites as Aversions as Constituents of Instincts." In: Biological Bulletin, 34/2.
*DIEDRICH, Oliver (1999): "Mit Gedankenkraft. Elektrische Gehirnaktivität steuert Computer." Heise, H. Hannover.
*DITFURTH, Hoimar von (1976): "Der Geist fiel nicht vom Himmel. Die Evolution unseres Bewusstseins." Hamburg.
*DIWALD, Hellmut (1981): "Im Zeichen des Adlers." Lübbe, G.. Bergisch Gladbach.
*o. V. DOKUMENTATION (1999): "Das Ende der J-Stempel-Saga.
Fallbeispiel von Geschichtsprägung durch Medienmacht." In:
Schriftenreihe PRO LIBERTATE Nr. 11. Bern.
*DORSCH (1976): "Psychologisches Wörterbuch." Hans Huber, Bern, Stuttgart, Wien.
*DUDEN Bd. 7 (1963): "Die Etymologie der deutschen Sprache." Mannheim.
*DURKHEIM, Emile (1912): "Die elementaren Formen des religiösen Lebens." Leipzig.
*DUSS-VON WERDT, Josef (1972): Institut für Ehe- und Familienwissenschaft. Zürich. Bd 1. Bern.
*EBERHART, Hans/ Stahel, Albert A.(2001): "Schweizerische Militärpolitik der Zukunft.
Sicherheitsgewinn durch stärkeres internationales Engagement." NZZ-Verlag. Zürich.
*EHINGER, Paul (1996): "Herrschaft durch Sprache. Political Correctness – auch in der Schweiz." Schriftenreihe PRO LIBERTATE Nr. 5. Zofingen.
*FELDER, Karl (2002): "Börsen und Märkte. Reflexe Fdr." In: NZZ Nr. 45. Zürich.
*FIOR, Michel (2001): "Von braunem Gold, das rotes war. Transaktionen Schweiz-UdSSR jenseits von "Bergier." Institut der Univ. Neuenburg für Geschichte. In: NZZ Nr. 117. Zürich.
*FISCHER, Steven R. (2001): "Eine kleine Geschichte der Sprache. A History of Language." Campus. New York 1999. Frankfurt/Main.
*FRENKEL, Max (1999): "Die Fahrt in die schöne, nicht mehr so neue Welt der Gebietsreform." In: Zeitfragen. NZZ Nr. 105. Zürich.
ders. (2002): "Lorbeeren sind da kaum zu holen." In: NZZ-Folio März. Schweiz 02. Der Stand der Dinge. Zürich.
*FREUD, Anna (1936): "Das Ich und die Abwehrmechanismen." Stuttgart.
*FREUD, Sigmund (1923): "Das Ich und das Es." Studienausg. Bd.: Psychologie des Unbewussten. Zürich.
*FRISCH, Karl von (1965): "Die Tanzsprache und Orientierung der Bienen." Berlin.
*GEMARA. Buch des Talmud. Übertragen von Goldschmidt, L. (1935). Frankfurt/Main.
*o.V.: "Das GESETZ vom 8. Januar 1951 über die polnische Staatsbürgerschaft."
Dz. U.R.P. Nr. 4, Pos. 25. Dokumentation: "Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neisse." In: Ehemaliges Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (Hg.) (1951) Bd. 1-2-3: Weltbild 1992. Augsburg.
*GIERER, Alfred (1985): "Die Physik, das Leben und die Seele." Piper. München.
*GOETHE, Johann W. von. (1832): "Faust". Erster Teil. Vor dem Tor. Vs. 860. Jena.
*GROHMANN, Adolf A. (1904): "Die Vegetarier-Ansiedlung in Ascona." Marhold. Halle.
*HENRY, Andrew F. (1957): "Affekt, Interaktion und Delinquenz." In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 2. Soziologie der Jugendkriminalität.
*HERZL, Theodor (o. J.): "Altneuland." Berlin, Leipzig.
*HOFER, Walter/ Reginbogen, Herbert E. (2001): "Hitler, der Westen und die Schweiz 1936-1945." Verlag NZZ. Zürich.
*HONDRICH, Karl O. (2000): "Die ehrliche Selbsttäuschung. Wie Europa seine Identität an Sündenböcken erprobt." In: NZZ Nr. 91. Zürich.
*HULL, Clark L. (1951): "Essential of behavior." New Haven. Yale VP.
*HUTTERER, Claus J. (1975): "Die germanischen Sprachen. Ihre Geschichte in Grundzügen." Akadèmiai Kiadò. Budapest. Drei Lilien. Wiesbaden.
*ISLER-KERENYI, Cornelia (2001): "Etrusker ohne Geheimnis." Zu den Ausstellungn in Venedig und in Bologna. In: NZZ Nr. 28. Zürich.
*JANZEN, Rod (1973): "Körper, Hirn und Personalität." Stuttgart.
*JASPERS, Karl (1960): "Psychologie der Weltanschauung." Springer. Berlin.
*JIRECEK, Josef C. (1918): "Geschichte der Serben." Leipzig.
*JOSEPHUS, Flavius (1923): "Geschichte des Jüdischen Krieges."
Übersetzt von Clementz, H.. Harz, B. Berlin, Wien.
*JUNG, Carl G. (1967): "Die Dynamik des Unbewussten." ges. Werke, Bd. 8. Zürich.
*KAILA, Eino (1932): "Die Reaktionen des Säuglings auf das menschliche Gesicht."
In: Ann. Universitatis Aboensis, Vol. 17.
*KAMBER, Peter (2000): "Geschichten zweier Leben." Ergänzendes Kapitel zur Neuauflage. Limmat. Zürich.
*KANT, Immanuel (1746): "Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte..." Königsberg.
*KNAAK, Lothar (1975): "Strafe und Sühne in sozialpädagogischer Sicht."
In: Erhardt, Helmut (Hg.) (1975): "Aggressivität, Dissozialität, Psychohygiene."
XII Jahrestagung der Europäischen Liga für Psychische Hygiene. Huber. Bern.
ders. (1993): "Fondamenti e didattica del Training Autogeno, concetto generale dei 5 passi." Corsi per adulti, Bellinzona. ed. 6.
ders. (1956): "Jenseits der Individualität. Die Energetik des Kollektivs." Effretikon.
ders. (1970): "Trotz, Protest, Rebellion. Urform und Bedeutung des Nestzerstörungstriebes." Zürich.
ders. (1983): "Sucht (Psychosoziale Voraussetzungen)." Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.
ders. (1972): "Psychologische Antriebe zur Gründung von Gruppenehen und Grossfamilien." In: Kommune und Grossfamilie. Institut für Ehe- und Familienwissenschaft. Bd 1.Zürich.
*KRANITZ, (1909): "Serbien und das Serbenvolk, von der Römerzeit bis zur Gegenwart."
*KRAUS, Carl (1868-1952): Germanist, Textkritiker. Prof. in Wien und
München.
*KURZMEYER, Roman (1999): "Viereck und Kosmos." Ed. Voldemeer. Springer. Wien.
*LAFRANCHI, Claudia (Hg.) (1999): "10 anni di Fondazione Monte Verità e
Centro Franscini." Locarno.
*LALIVE D'EPINAY, Thierry (2001): Rede vom 24.03.2001 vor dem Verband Schweizer Lokomotivführer (VSLF). Bern.
*LANDMANN, Robert (1973): "Ascona Monte Verità. Auf der Suche nach dem Paradies." Zürich.
*LANGHANS, Rainer/ Teufel, Fritz (1968): "Klau mich." Voltaire Handbuch 2. Berlin.
*LERNER, Alan J. (1964): Musical: "My Fair Lady." Film USA.
*LICHTENBERG, Georg Ch. (1778): Kalenderspruch. Göttingen.
*LORENZ, Konrad/ Leyhausen, P. (1968): "Antriebe tierischen und menschlichen Verhaltens." Piper. München.
*LORENZ, Konrad (1937): "Über die Bildung des Instinktbegriffes."
In: Die Naturwissenschaften. 25.
ders. (1937): "Über den Begriff des Instinkthandlung." In: Folia biotheoretica.
ders. (1965): "Über tierisches und menschliches Verhalten." Bd. II. München.
*MEIER-CRONEMEYER, Hermann (1969): "Kibbuzim, Geschichte, Geist und Gestalt." In: Schriftenreihe des Forschungsinstituts der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hannover.
*MILLS, T.M. (1954): "The Coalition Pattern in the Three-Person-Group." In:
American Sociolog. Review XIX.
*NETSCHEPORUK, Jewgeni (1989): "Die russische Entdeckung der Schweiz: Ein Land, in dem nur gute und ehrbare Leute leben." Limmat. Zürich.
*OBERMÜLLER, Klara (1993): "Im Gespräch mit Jean Rudolf von Salis.
Dem Leben recht geben." Weltwoche ABC. Zürich.
*OBLATKA, Andreas (2002): "Geplatztes Gipfeltreffen der Visegrad-Länder."
In: NZZ Nr. 46. Zürich.
ders. (2002): "Mitteleuropas geschichtliche Altlasten." Leitartiekl. In: NZZ
Nr. 51. Zürich.
*OZ, Amos (2002): "Zwei palästinensisch-israelische Kriege." In: NZZ Nr. 77. Zürich.
*PARKINSON, C. N. (1970): "Parkinsons Gesetz und andere Untersuchungen über die Verwaltung." Rowohlt. Reinbek.
*PFIFFNER, Albert (2001): "Unvollständige Bergier-Akten." In: NZZ Nr. 144. Zürich.
*PIAGET, Jean/ Inhelder, Bärbel (1974): "Gedächtnis und Intelligenz."Walter. Olten.
*PORTMANN, Adolf (1948): "Die Tiergestalt". Basel.
ders. (1949): "Mythisches in der Naturforschung." In: Eranos Jahrbuch XVII. Zürich.
*o.V. (2001): "PROZESS von Grenoble, 16.04.2001 um die Golden Way Foundation und den Sonnentemplerorden." In: NZZ Nr. 89. Zürich.
*RINGELNATZ, Hans Joachim (1955): "Gedichte. Ringkampf." Henssel. Berlin.
*RÖPKE, Wilhelm (1899-1966): "Civitas Humana (1944)". "Fronten der Freiheit (1966)." Genf.
*ROTHENHÄUSLER, Paul (2000): "Nun lügen sie wieder." Quellenbelege. 2. Aufl. Stäfa.
*ROUSSEAU, Jean-Jacques (1750): "Discours sur les arts et les sciences." Paris.
*RUCH, Peter (1990): "Theologische Wurzeln des Liberalismus." In: NZZ Nr. 224. Zürich.
*SCHADE, J.P. (1971): "Die Funktion des Nervensystems." Stuttgart.
*SCHENKENDORF, Max von (1783-1817). Lyriker, preussischer Freiheitskämpfer aus Tilsit. In: Illustriertes Taschen-Liederbuch. 9. Aufl. (1927). Mülheim/ Ruhr.
*SCHILLER, Friedrich von (1759-1805): "An die Freude." (1799) "Das Lied von der Glocke." Jena. Gedichte. Ex Libris. Bd 3. (1975) Zürich.
*SCHMID, Samuel (2001): Referat: "Führung in Staat, Wirtschaft und Armee." Vor dem Redressement national, vom 24.03.2001. Bern.
*SCHURZ, J. (1972): "Gehirnstruktur und Verhaltensmotivation." In:
Naturwissenschaftliche Rundschau. 25,45.
*SCHWAB, Andreas/ Lafranchi, Claudia (2001): "Sinnsuche und Sonnenbad. Experimente in Kunst und Leben auf dem Monte Verità." Limmat. Zürich.
*SHAW, Georg B. (1914): Bühnenstück: "Pygmalion." London.
*SIMMEL, Georg (1920): "The Triad." The sociology of Georg Simmel.
Ed. Gy Wolff K.H. Glencoe. Illinois.
*SKINNER, B.F. (1974): "Die Funktion der Verstärkung in der Verhaltenswissenschaft." Kindler. München.
*SPENGLER, Oswald (1923): "Der Untergang des Abendlandes." München.
*SPITZ, René A./ Wolf, K.M. (1946): "The smiling response." In: Genet. Psychol. Monographs, Vol. 34.
*o.V. (1979): "SPRACHGLOSSE: Im Duden – nichtsdestotrotz." In: NZZ Nr. 226. Zürich.
*STAMM, Rudolf (2001): "Die UNO auf dem Weg zu mehr Effizienz, Geringe Mehrkosten eines Schweizer Beitritts." In: NZZ Nr. 89. Zürich.
*o.V. (2000): "Die STAATSKASSE als Beute." (Hg.) Aktion für freie Meinungsbildung. Zürich.
*STRAUB, Eberhard (2001): "Eine kleine Geschichte Preussens." Siedler. Berlin.
*STUCKE, Werner (1982): "Die Balintgruppe." däv. Köln-Lövenich.
*SZEEMANN, Harald (1978): "Monte Verità Berg der Wahrheit." Lokale Anthropologie als Beitrag zur Wiederentdeckung einer neuzeitlichen sakralen Topographie. Electa Editrice. Tegna.
*TALLINN, Mt. (2001): "In Estland macht sich EU-Skepsis breit." In: NZZ Nr. 151. Zürich.
*TERENZ, Publius Terentius Afer (195-159 a. C.): "Andria." I 1,99.
*TINBERGEN, Nikolas (1952): "Instinktlehre." Berlin. Hamburg
*TOLMAN, W. (1951): "Einführung in die moderne Psychologie." Humbolt. Wien.
ders. (1968): "Motivation, Persönlichkeit, Umwelt." Hogrefe. Göttingen.
*TORELLI, M. (Hg.) (2000): Katalog: "Gli Etruschi." Bompiani. Milano.
*UEXKÜLL, Jakob J. Baron von (1921): "Umwelt und Innenwelt der Tiere." Berlin.
ders. (1940): "Bedeutungslehre." Barth. Leipzig.
*VETTER, Reinhold (2001): "Kant statt Kalinin. Von der Hoffnung einer Stadt, endlich wieder zu Europa zu gehören." In: NZZ Nr. 41. Zürich.
*WEIZSÄCKER, Viktor von (1947): "Der Gestaltkreis." Stuttgart.
*WIRZ, Albert (2001): "Sanitorium, nicht Sanatorium. Räume für die Gesundheit." In: Sinnsuche und Sonnenbad. Experiment in Kunst und Leben auf dem Monte Verità. Limmat. Zürich.
*WITTENBERG, Alexander (1957): "Vom Denken in Begriffen. Mathematik als Experiment des reinen Denkens." Uni. Zürich.
*WOLF, Klaus D. (2000): "Die neue Staatsräson. Zwischenstaatliche Kooperation als Demokratieproblem in der Weltgesellschaft." Nomos. Baden-Baden.
*WULFILA (um 311-383): Gotische Evangelienübersetzung CODEX ARGENTEUS (Prunkhandschrift, Oberit. 6. Jht.) heute in Uppsala. Schweden.
*ZENTNER, Christian (1988): "Heim ins Reich. Der Anschluss Österreichs 1938." Südwest. München.
*ZMIRAK, John (2001): "Wilhelm Röpke. Swiss Localist, Global Economist." ISI-Books. Wilmington (Delaware).
Namenregister
A
Adler Alfred 46, 130
Annan Kofi, Generalsekretär der UNO 103
Arafat Yasir, palästinenser Präsident 102, 106
B
Baerlocher Felix 16, 130
Balint Michael 35, 36, 53, 130
Barbusse Henry 39, 130
Beethoven Ludwig van 121
Benes Edvard Siehe Benesch Eduard
Benesch Eduard, tschechischer Staatsgründer 39
Bergier Jean-François (Kommission) 83, 131
Berne Eric 77, 130
bin Laden Osama 43, 99
Birbaumer Nils 64, 124, 130
Bismarck Otto von 39
Boethius Anicius Manlius Severinus 14, 130
Breschnew Leonid, Diktator UdSSR 91
Buffi Giuseppe, ehemaliger tessiner Staatsrat 111, 112
Bush George W., Präsident der USA 103
C
Carlo Magno Siehe Karl der Grosse
Chomsky Noam 77, 130
Cicero Maecus Tullius 73, 130
Clementz Heinrich 38, 132
Clinton Bill 32
Cotti Flavio 89
Couchepin Pascal 93, 130
Craig Wallace 16, 130
D
Deiss Joseph 102
Diedrich Oliver 123, 130
Ditfurth Hoimar von 16, 130
Diwald Hellmut 41, 130
Dorsch, Psychologisches Wörterbuch 11, 124, 130
Duden, Lexikon 23, 25, 34, 72, 87, 130, 134
Dürkheim Emile 120
Dürrenmatt Friedrich 55
Duss-von Werdt Josef 111, 130
E
Eberhart Hans 95, 131
Ehinger Paul 25, 131
Erhardt Helmut 48, 132
F
Felder Karl 24, 131
Fior Michel 83, 131
Fischer Steven Roger 19, 131
Frenkel Max 12, 59, 131
Freud Anna 46, 131
Freud Sigmund 35, 46, 131
Frisch Karl von 15, 131
Frisch Max 55
G
Gemara, Buch des Talmud 70, 131
Gierer Alfred 15, 131
Goethe Johann Wolfgang von 91, 131
Golden Way Foundation 28, 133
Goldschmidt Lazarus 70, 131
Grohmann Adolf-Arthur 118, 131
H
Harz Benjamin 38, 132
Henry Andrew F. 60, 131
Herzl Theodor 116, 131
Hesse Hermann, Schriftsteller 112
Hitler Adolf, Diktator Grossdeutschland 84, 88, 105, 131
Hofer Walter 84
Hondrich Karl Otto 123, 131
Huber Hans 48, 124, 130, 132
Hull Clark Leonard 123, 131
Hutterer Claus Jürgen, 35, 67, 78, 131
I
Inhelder Bärbel 69, 133
Isler-Kerényi Cornelia 19, 20, 131
J
Janzen Rod 122, 132
Jaspers Karl 63, 132
Jirecek Josef Constantin 39, 132
Johannes, Evangelium 32, 112
Josephus Flavius 38, 132
Jung Carl Gustav 46, 125, 132
K
Kaila Eino 60, 132
Kamber Peter 80, 132
Kant Immanuel 16, 35, 40, 61, 132, 134
Karl der Grosse 54
Klaus Vaclav, tschechischer Parlamentspräsident 40
Klein Josua 114
Kranitz 39, 132
Kraus Carl 124
Ku-Klux-Klan 42
Kurzmeyer Roman 114, 132
L
Lafranchi Claudia 111, 112, 130, 134
Lalive d'Epinay Thierry 107, 132
Landmann Robert 113, 118, 132
Langhans Rainer 113, 132
Le Pen Jean-Marie 39
Lenin Wladimir 76
Lerner Alan Jag 29, 132
Lewinsky Monica 32
Leyhausen P. 16, 132
Lichtenberg Georg Christoph 69, 132
Lorenz Konrad 16, 46, 132, 133
Lübbe Gustav 41, 130
M
Matthäus, Evangelium 48
Meier-Cronemeyer Hermann 115, 118, 133
Meili Christoph 119
Mills T.M. 60, 133
Moses 22, 48, 123
Murad I und II, türkische Sultane 38
Muschg Adolf 55
N
Nansen Fridjof 88
Netscheporuk Jewgeni 75, 133
O
Obermüller Klara 55, 56, 133
Oblatka Andreas 40, 133
Ogi Adolf 90
Orban Viktor, ungarischer Ministerpräsident 40
Oz Amos 105
P
Papen Franz von 41
Parkinson C.N. 123, 133
Pfiffner Albert 83, 133
Piaget Jean 69, 133
Portmann Adolf 15, 18, 65, 133
Powell Collin, Aussenminister USA 103
Q
Qohèlet (Prediger) 14, 17
Quisling Vidkun 88
R
Rau Johannes, deutscher Bundespräsident 112
Reginbogen Herbert E. 84, 131
Ringelnatz Hans Joachim 90, 133
Röpke Wilhelm 58, 135
Rosenbaum Wladimir 80
Rothenhäusler Paul 55, 133
Rousseau Jean-Jacques 112, 113, 133
Ruch Peter 34, 133
S
Salis Jean Rudolf von 55, 56, 133
Schadè J.P. 122
Schenkendorf, Max von 36, 133
Schiller Friedrich 53, 119, 121, 133
Schmid Samuel 92, 133
Schmidt Robert F. 64, 124, 130
Schurz J. 122, 134
Schwab Andreas 111
Sharon Ariel, israelischer Ministerpräsident 102, 103, 106
Shaw Georg Bernard 29, 134
Simmel Georg 60, 134
Skinner B.F. 123, 134
Spengler Oswald 12, 134
Spitz, R.A. 60, 97, 134
Stahel Albert A 95, 131
Stalin Josef, Diktator UdSSR 55
Stamm Rudolf 100, 134
Straub Eberhard 40, 41, 134
Stucke Werner 70, 134
Szeemann Harald 111
T
Tallinn, Mt. 85, 134
Terenz, Publius Terentius Afer 105
Teufel Fritz 47, 55, 112, 113, 132
Thiel Torkel Tage 80
Thyssen-Bornemisza, Pinakothek 112
Tinbergen Nikolas 16, 17, 134
Tolman W. 123, 134
Torelli M. 19, 134
U
Uexküll Jakob Johann, Baron von 50, 56, 60, 62, 63, 128, 134
V
Valangin Aline 80
Vetter Reinhold 40, 134
W
Weizsäcker Viktor von 16, 134
Wilhelm I von Preussen 41
Wilhelm Tell 119
Wirz Albert 112
Wittenberg Alexander 62, 134
Wolf K.M. 60
Wolf Klaus Dieter 93, 134
Wolff K.H. 60, 134
Wulfila 'Ulfilas' 67, 68, 134
Z
Zeman Milos, tschechischer Ministerpräsident 40
Zentner Christian 54, 135
Zmirak John 58