|
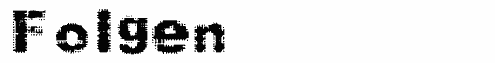

Trauerfeier in Westberlin für die Opfer des Aufstandes.

Die Folgen des 17. Juni 1953

3. Die Folgen

Der Volksaufstand zeigte deutlich, dass die von der UdSSR errichtete
SED-Diktatur nur durch Waffengewalt und Terror entstanden war und auch
nur mit diesen Mitteln aufrecht erhalten werden konnte. Nach der
Niederschlagung des Aufstandes und der Verfolgung dessen Anführer,
verbreitete das ZK (Zentral Komitee) der SED ihre Version der
Vorkommnisse:
Es habe sich um einen "faschistischen Putschversuch"
gehandelt, eine "Konterrevolution". Gesteuert worden sei er
von westdeutschen und amerikanischen Politikern aus Westberlin.
"Durch ihre Agenten und andere gekaufte Subjekte, die vor allem
von Westberlin aus massenhaft in die DDR eingeschleust wurden, gelang es
den aggressiven Kräften des deutschen und des amerikanischen
Monopolkapitals , in der Hauptstadt Berlin und einigen Orten der
Republik Teile der Bevölkerung zur Arbeitsniederlegung und zu
Demonstrationen zu bewegen. Am 16. und 17. Juni zogen Tausende
faschistischer Schläger sowie viele irregeleitete Westberliner
Jugendliche in organisierten Gruppen über die Sektorengrenze,
verteilten Flugblätter und setzten Warenhäuser der HO und andere
Gebäude am Potsdamer Platz in Brand... Insgesamt kam es jedoch nur in
272 von den etwa 10'000 Gemeinden der DDR zu Unruhen, und zwar nur dort,
wo die imperialistischen Geheimdienste ihre Stützpunkte hatten oder
wohin sie Agenten schicken konnten." (Quelle: St. Doernberg, Kurze
Geschichte der DDR, S. 239 und 241)
Mit aller Härte wurde gegen die Anführer der Demonstrationen
vorgegangen. Fast 1400 Personen wurden verhaftet. Doch man ging sogar
noch weiter: Am Nachmittag des 18. Juni gab der sowjetische
Stadtkommandant von Ost-Berlin die standrechtliche Erschiessung des
West-Berliners Willi Göttling bekannt, welcher angeblich aktiv an den
Unruhen beteiligt gewesen war.
In der SED folgte eine "Reinigung von feindlichen
Elementen", angeordnet von den Sowjets, die kein weiteres Risiko
eingehen wollten. Dabei wurden die Gegner von Ulbricht, Zaisser und
Herrnstadt, aus der SED ausgeschlossen, und somit Ulbrichts Position
gestärkt. Zudem wurden noch weitere Mitglieder ausgeschlossen, denen
man Passivität oder sozialdemokratische Ansichten vorwarf. Insgesamt
wurden auf diese Weise über 60 Prozent der gewählten
SED-Bezirksleitungen bis 1954 ausgeschlossen. Dass Volk machte dazumal
die bittere Erfahrung, dass der Versuch einer gewaltsamen Veränderung
des politischen Systems solange keine Aussicht auf Erfolg hat, wie die
UdSSR das Regime in der DDR in den Händen hält.
Trotz allem übte die SED auch vage Selbstkritik. So gab zum Beispiel
Ulbricht auf der 15. Tagung des ZK der SED zu: "Schonungslos
müssen wir feststellen: Die Provokationen am 17. Juni habe die Partei
überrascht." (Quelle: W. Ulbricht, Die gegenwärtige Lage und der
neue Kurs der Partei, S. 70). Auch schon an der 14. ZK-Tagung am 21.
Juni legte die SED ein Schuldbekenntnis ab: "Wenn Massen von
Arbeitern die Partei nicht verstehen, ist die Partei schuld, nicht der
Arbeiter." (Quelle: M. Krämer, Der Volksaufstand vom 17. Juni
1953, S. 129)
Am 21. Juni wurden die Arbeitsnormen auf den Stand vor dem 1.4.1953
zurückgenommen und die Lohnkürzungen rückgängig gemacht. Im Oktober
1953 senkte die Regierung die Preise fast aller Waren in den HO (Handels
Organisation) Läden um 10 bis 25 Prozent. Und Ende 1954 reduzierten die
UdSSR die Kosten für die sowjetische Besatzung, die von den Deutschen
selber aufgebracht werden mussten, auf 5 Prozent des Staatshaushaltes.
Dazu wurden noch die Sowjetischen Aktiengesellschaften (inklusive der
wichtigen Leuna-Werke, aber ohne die uran-fördernde Wismut-AG) für
2,55 Milliarden Mark an die DDR verkauft.
Mit diesen Massnahmen verbesserte sich die Lebenslage der DDR
Bevölkerung, doch trotzdem flüchteten weiterhin Tausende. 1953
flüchteten 331'000 Menschen, 1954 waren es 184'000 und 1955 immer noch
252'000 (Quelle: H. Weber, Die DDR - 1945-1986, S. 39)
Der Westen (allen voran Frankreich, UK und USA) reagierte auf die
Vorkommnisse des 17. Juni sehr zurückhaltend, da er die UdSSR auf
keinen Fall provozieren wollte. Auch war man unvorbereitet. Josef
Strauss, damaliger Stellvertretender Vorsitzender der CSU, in seiner
Autobiographie (F.J. Strauss, Die Erinnerungen, S. 204): "Wir
hatten zwar Informationen, dass die Unzufriedenheit unter den Menschen
drüben von Tag zu Tag stieg, dennoch wurden wir von dem plötzlichen
Ausbruch der Unruhen und dem demonstrativen Freiheitswille
überrascht." Auch nach dem Aufstand hielt sich die Bundesregierung
in ihren Stellungnahmen und ihren Aufforderungen bewusst zurück.
So blieben denn auch Interventionen des Westens gegen die Politik der
Verfolgung und Vergeltung der SED nach dem Juni-Aufstand aus.
Später wurde diese westliche Zurückhaltung Gegenstand von heftiger
Kritik.


Gedenktafel:

Die Gedenktafel für die Opfer des 17. Juni 1953.
Angebracht am heutigen "Bundesministerium der Finanzen in
Berlin", Wilhelmstrasse 97. Hier entlud sich, als das Gebäude noch
"Haus der Ministerien" hiess, am 17. Juni 1953 der
Volksaufstand.
Text der Gedenktafel:
An dieser Stelle
vor dem "Haus der
Ministerien" der DDR,
forderten am 16. Juni 1953
die Bauarbeiter der
Stalinallee
im Bezirk Friedrichshain
die Senkung der
Arbeitsnormen,
den Rücktritt der Regierung,
die Freilassung aller
politischen Gefangenen
sowie freie und geheime
Wahlen.
Diese Protestversammlung
war Ausgangspunkt
des Volksaufstandes
am 17. Juni 1953
Wir gedenken der Opfer.
17. Juni 1993
|