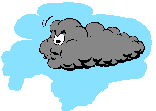
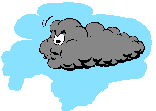
Es gibt neun Götter, die Blitze
senden, und elf Arten von solchen. Jupiter schleudert drei.
So einfach war es, bevor die Wissenschaft
sich der Erforschung der mächtigsten
elektrischen Naturerscheinung annahm.
Heute weiss man Genaueres über das natürliche
Hochspannungswunder Blitz. Zu dieser
Erkenntnis hat die Schweizer Blitzforschung einen
massgebenden Beitrag geleistet. Jedem
von uns, seien wir ehrlich, sitzt trotz
naturwissenschaftlicher Erkenntnis
und aufgeschlossener Denkweise auch heute noch
ein wenig die Angst vor dem Phänomen
Blitz und Donner im Nacken. Diese Furcht
wurzelt tief.
Tötungszauber und Fruchtbarkeitsmagie
Der Blitz fuhr der Menschheit seit
jeher in die Glieder, und sie fühlte sich, je nach
Kulturstufe, hin- und hergerissen
zwischen elementarer Furcht vor dem Tötungszauber
seiner dämonischen Kraft und
ehrfürchtiger Verehrung seiner Eigenschaft als Teil des
fruchtbarkeitsspendenden Gewitters.
In unzähligen bildlichen Darstellungen
rund um die Welt hat dieses Urphänomen der
Natur seine Spuren hinterlassen, als
Donnerkeil, Donnerstein und Teufelsfinger in der
alten und als Donnervogel in der neuen
Welt. Gemalte und gemeisselte Blitzfeuer und
heilige Blitzgräber zeugen noch
heute vom grossen Zittern der Antike vor der
zerschmetternden Kraft des Himmelsfeuers,
zumal im vorderasiatischen und
griechisch-römischen Kulturkreis.
Blitz-, Donner-, Wind- und Regengottheiten sind
Legion.
Auch die Kunst nahm sich des himmlischen
Feuers an. Während die Gotik noch zögerte,
wagte die Renaissance erste Gewitterdarstellungen,
und der Barock schliesslich zeigte
eine ganz besondere Vorliebe für
das Motiv des Blitzes. Die Malerei der Neuzeit überliess
die Blitzdarstellung der Fotografie.
Vom Donnerkeil zum Hochspannungsphänomen
Aber auch der Respekt vor dem Blitz
wandelte sich im Laufe der Zeiten. Schleuderten ihn
im Altertum erhabene Götter,
bekam der Blitz in Renaissance und Barock eine leicht
komische Note, und das heitere Rokoko
lässt spielende Putten mit Blitzchen um sich
werfen, als wären es harmlose
Papierschlangen. Von der Romantik zur Neuzeit wandelte
sich dann das Blitzverständnis
grundlegend, der mystische Donnerkeil mauserte sich zum
erklärbaren, luftelektrischen
Vorgang.
Nur einmal noch, in Wilhelm Buschs
satirischer Bildergeschichte vom heiligen Antonius
von Padua, tritt eine Blitzgottheit
in Erscheinung und lässt den unheiligen Dr. Alopecius
durch Blitzschlag ein böses Ende
in Rauch und Asche nehmen...
Naturwunder Blitz und Donner
Als erster hatte der englische Geistliche
D. William Wall den Geistesblitz, der Blitz sei
eine Form des elektrischen Funkens.
Stephen Gray (1666 - 1736) kam zu demselben
Vergleich, und der Leipziger Physikprofessor
Johann Heinrich Winkler (1703 - 1770)
widmete in seinen physikalischen Schriften
ein ganzes Kapitel der Frage, “ob Schlag und
Funken der verstärkten Elektrizität
für eine Art des Donners und Blitzes zu halten sind.”
Dem Amerikaner Benjamin Franklin (1706
- 1790) gelang es 1752 erstmals, Elektrizität in
der Atmosphäre nachzuweisen,
indem er an einer elektrisch leitfähigen, nassen Schnur
einen Drachen steigen liess und dabei
aus einem angehängten Schlüssel Funken ziehen
konnte. Zum Glück tat er das
nicht während eines Gewitters, sonst hätte ihn dasselbe
Schicksal ereilt wie den Petersburger
Physikprofessor G.W. Richman im Jahre 1753, der
den Blitztod fand, als er während
eines Gewitters die Stärke der Wolkenelektrizität zu
messen versuchte.
Es dauerte dann rund 200 Jahre, bis
man das Phänomen Blitz voll erforscht hatte und bis
die Erkenntnisse in wirksamen Blitzschutz
umgesetzt wurden. Trotzdem geistern auch
heute noch Irrmeinungen herum.
Die Mär vom “heissen” und “kalten” Blitz
Für den Volksmund ist die Sache
einfach: “Heisse” Blitze können etwas anzünden, weil
sie heiss sind, “kalte” aus dem gegenteiligen
Grund nicht. Die wissenschaftliche
Erklärung der Elektrizitätslehre
lautet in etwa: Den “heissen”, das heisst
stromschwächeren, Blitz kann
man mit einem Schweisslichtbogen vergleichen, den
“kalten”, das heisst stromstarken,
mit einer Explosion.
Was den Begriff der Spannung anbetrifft:
Diese ist beim Blitz unklar. Man müsste sie
zwischen Wolke und Erde messen können;
doch diese Millionen Volt kann man bloss
schätzen. Was sich dagegen genau
messen lässt, ist der Strom des Blitzes, der ja auch
bis zum Boden herunterkommt, also
mit Messgeräten erfassbar ist.
Während die Bauernregel “Je mehr
Donnerwetter, je fruchtbarer das Jahr” wohl stimmen
mag, da Gewitter das für den
Pflanzenwuchs lebensnotwendige Regenmass mit sich
bringen, könnte die Befolgung
der nachstehenden Volksmundregel für das Verhalten bei
Blitzschlag recht böse Folgen
haben: “Vor den Eichen sollst du weichen, doch die Buchen
sollst du suchen”.
Diese irrige Auffassung stammt wohl
daher, dass man die Blitzeinschläge an glatten
Buchenstämmen stets weniger gut
sah als solche an Bäumen mit borkiger Rinde, welche
beim Blitzeinschlag in grossen Fetzen
weggefegt wird. Daraus schloss man irrtümlich,
Buchen seien weniger gefährdet.
Das stimmt keineswegs. Richtig ist, während eines
Gewitters überhaupt nicht unter
Bäumen zu stehen, schon gar nicht unter freistehenden.
Wie man der Blitzgefahr ausweicht
Fast alle Blitzunfälle ereignen
sich im Freien. Der Blitz schlägt vornehmlich an Stellen ein,
welche die Umgebung wesentlich überragen.
Nicht nur am Einschlagsort besteht Gefahr,
sondern auch im Umkreis von etwa 30
m. Blitzunfälle sind nicht immer tödlich. Wenn ein
Teil eines Blitzstromes über
den menschlichen Körper fliesst, kann dies zu unwillkürlichen
Muskelreaktionen führen, die
einen Menschen mehrere Meter fortschleudern können;
daher sind auch Stellen mit Absturzgefahr
zu meiden. Ganz allgemein hält man sich am
bestem an die vom der Blitzschutzkommission
des Schweizerischen Elektrotechnischen
Vereins aufgestellten Hinweise für
das Verhalten im Freien bei Gewittern.
Gefährdete, das heisst zu meidende
Standorte sind: einzeln stehende Bäume und
Baumgruppen, Waldränder mit hohem
Bäumen. Aussichtstürme und andere Objekte auf
freiem Feld, Berggipfel und Berggrate,
Freileitungsmasten, hohe Kräne, Schwimmbäder
und Seen (besonders deren Ufer), ungeschützte
Zelte und Boote mit Metallmasten,
Aufenthalt neben Auto oder neben Weidezäunen,
Tragen überragender Gegenstände
(Pickel, Ski, Fischerrute), Anlehnen
an Felswände.
So schützt man sich vor Blitzschlag
Am sichersten ist man in Wohnhäusern,
Stahlskelettbauten, Baracken mit
zusammenhängenden Blechwänden
und -decken, in Autos mit Ganzmetallkarosserie,
Traktoren mit Metalldach, Eisenbahnwagen,
Ganzmetallwohnungen, in Metallkabinen von
Seilbahnen, Schiffen oder Lastwagen,
in Höhlen, wo man stehen kann (ohne dass der
Kopf zu nahe an die Decke kommt),
im Innern eines Waldes mit gleichmässig hohem
Baumbestand, jedoch nicht in der Nähe
einzelner Bäume oder herabhängender Aeste.
Notlösungen bei Ueberraschungen
findet man im Innern von Hütten, Kapellen, Scheunen
(aber nicht an Aussenwände anlehnen),
unter Freileitungen (jedoch nicht in der Nähe von
Masten), durch Niederhocken mit geschlossenen
Füssen in Bodenmulden, Hohlwegen
oder am Fuss von Felsvorsprüngen
(geschlossene Füsse deshalb, damit nicht via
gespreizte Beine eine sogenannte Schrittspannung
entstehen kann).
Was tun bei Blitzunfall?
Sofern der Unfall nicht tödlich
ist, muss sofort mit Wiederbelebungs- und
Erste-Hilfe-Massnahmen begonnen werden:
Mund-zu-Mund-Beatmung, äussere
Herzmassage, Seitenlagerung, vor Unterkühlung
schützen. Abdecken von
Verbrennungen mit sauberer Gaze, sofort
den Arzt rufen und bis zu seinem Eintreffen mit
Wiederbelebungsmassnahmen fortfahren.
Kleiner Trost: Die Chance, vom Blitz je
getroffen zu werden, ist laut Wahrscheinlichkeitsrechnung
für den einzelnen Menschen
verschwindend klein....
Blitzforschung von Weltruf
Auf dem Monte San Salvatore im Tessin
schlummert seit langer Zeit ein seltsames, einst
weltberühmtes Institut im Dornröschenschlaf:
Hier war während über drei Jahrzehnten
das Phänomen Blitz erforscht
worden. Die Schweizer Blitzforschung nahm ihren Anfang
vor mehr als fünfzig Jahren entlang
von Hochspannungsleitungen. Damit eng verbunden
ist der Name des heute 93jährigen,
in Zollikon lebenden Professors Karl Berger. Er war
Leiter des Messstation auf dem San
Salvatore und zugleich Dozent für
Hochspannungstechnik an der ETH. Dass
die Schweizer Blitzforschung weltweite
Anerkennung genoss, bewiesen die Einladungen
Professor Bergers, auch bekannt unter
dem Namen “Vater des Blitzes”, bis
nach Uebersee sowie seine beiden Ehrendoktortitel
von der Technischen Hochschule München
und der Universität Uppsala.
1926 hatte Berger mit Messungen von
Blitzüberspannungen auf grossen elektrischen
Leitungen der SBB und verschiedener
Elektrizitätswerke begonnen. Um den
Apparatetransport zu vereinfachen,
stellten ihm die Bundesbahnen 1930 zwei alte,
ausrangierte Eisenbahnwagen zur Verfügung;
den einen für die Instrumente, den anderen
zum Wohnen. So wurden bis 1936 jeden
Sommer an irgeneiner Hochspannungsleitung in
der Schweiz Blitzmessungen durchgeführt.
Hexenkessel Tessin
Da der Blitzstrom nur am Ort des Einschlags
selber genau zu messen ist, verliess man
die Leitungen im Flachland und stieg
1937 auf die Berge. Dort war die Wahrscheinlichkeit
grösser, Blitze direkt zu erfassen.
Auf fünf Bergspitzen - Säntis, Pilatus, Rigi,
Rochers-de-Naye und San Salvatore
- wurden Messeinrichtungen installiert. Als
blitzintensivste Ecke der Schweiz
erwies sich das Tessin. Da hier die Gewitterdichte am
grössten ist, treten pro Quadratkilometer
und Zeiteinheit auch am meisten Blitze auf.
Daher entschied man sich definitiv
für den San Salvatore.
1943 wurde mit Hilfe von Soldaten der
Uebermittlungstruppen auf dem Gipfel des San
Salvatore der erste von zwei Blitzmasten
aufgestellt, und die Station wurde bemannt. Die
Wallfahrtskirche auf dem Gipfel diente
als Fotolabor, das nahegelegene
Eremitengebäude des ehemaligen
Klosters als elektrische Messstation. Blitzschutz ist
erforderlich für die verschiedensten
zivilen und militärischen Institutionen wie Kraftwerke,
Luftverkehr usw.
Kein Land auf der Welt hatte so viele
Blitzstrommessungen gesammelt wie die Schweiz.
1951 war unser Land auch Gründungsmitglied
der Europäischen Blitzschutzkonferenz,
die seither alle zwei Jahre tagt.
Bis 1954 hatten der Schweizerische
Verein und der Verband Schweizerischer
Elektrizitätswerke das Institut
finanziert: bis 1972 sprang der Nationalfonds mit Krediten
ein. Dann aber versiegte die Geldquelle
endgültig, weil genügend Blitzschutzdaten
vorlagen. Die Aufgabe der Forschungskommission,
den Blitz im Hinblick auf den Schutz
von Gebäuden und Einrichtungen
zu erforschen, war zu ihrem Abschluss gekommen.
Wie ein Blitz entsteht
Im turbulenten Innern der Gewitterwolke
werden Regentropfen und Eiskristalle zerrissen.
Die grösseren Teile bleiben unten,
die kleineren werden emporgewirbelt. Dadurch
trennen sich die elektrischen Ladungen.
Wird die Spannung zwischen zwei Wolkenteilen
oder zwischen Wolke und Boden für
das Isolationsvermögen der Luft zu gross, erfolgt
eine Entladung, ein Funkenüberschlag,
genannt Blitz. Man unterscheidet Wolken- und
Erdblitze.
Seinen Weg bahnt sich der Blitz,
indem er sich in einem komplizierten Vorgang einen
leitfähigen Kanal (Durchmesser
einige Zentimeter) bildet, den er ruckartig stufenweise
vorantreibt. Kommt diese Gleitentladung
in Bodennähe, so schlägt ihr von unten her
häufig eine Fangentladung entgegen,
die den Kanal fertigstellt und damit die stromstarke
Hauptentladung einleitet. Verschiedene
Seitenverzweigungen erreichen den Boden nicht
und enden blind in der Luft.
[Wanderrevue 3/1992, Heini Hofmann]