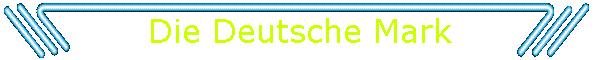|
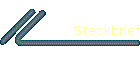
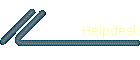
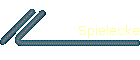
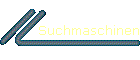
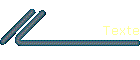
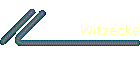
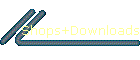
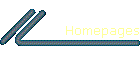
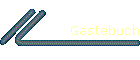

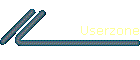
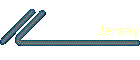
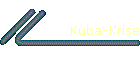
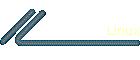
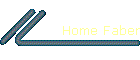
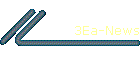
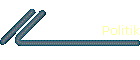
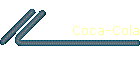
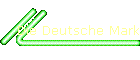
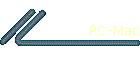
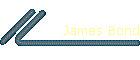
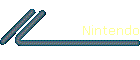
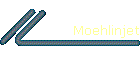
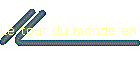
| |
Die
Deutsche
Mark
© by Christoph Banik
Kurzrüttistrasse 12
4313 Möhlin
1. Inhaltsverzeichnis
| Kapitel 2 |
Der Krieg ist vorbei |
Seite 3 |
| Kapitel 3 |
Die Zigarettenwährung |
Seite 4 |
| Kapitel 4 |
Die Wege zur Währungsreform |
Seite 4 |
| Kapitel 5 |
Der Tag X |
Seite 6 |
| Kapitel 6 |
Die Teilung Deutschlands |
Seite 7 |
| Kapitel 7 |
Der Turn-around |
Seite 8 |
| Kapitel 8 |
Das Wirtschaftswunder |
Seite 8 |
| Kapitel 9 |
Die Midlife-Crisis |
Seite 10 |
| Kapitel 10 |
Aus zwei wird eins |
Seite 10 |
| Kapitel 11 |
Die 90er Jahre |
Seite 12 |
| Kapitel 12 |
Eine Ära geht zu Ende |
Seite 13 |
| Kapitel 13 |
Nachwort |
Seite 15 |
| Anhang |
Die Währungsreformgesetzte (Auszug) |
Seite 16 |
|
Marshall-Plan |
Seite 17 |
|
Kurzbiographie von Ludwig Erhard |
Seite 18 |
|
Maastrichter Vertrag |
Seite 19 |
Hinweis: Meine Arbeit basiert grösstenteils auf zwei Quellen: "Die D-Mark - Eine
Biographie" von Wolfram Bickerich erschien 1998 im Rowohlt Berlin Verlag GmbH,
Berlin; und "50 Jahre Deutsche Mark" von Helmut Kahnt, Michael H. Schöne und
Karlheinz Walz erschien 1998 im H. Gietl Verlag & Publikationsservice GmbH,
Regenstauf.
Sämtliches Informationsmaterial im Anhang stammen von "Microsoft Encarta
Enzyklopädie Plus 2000". Alle anderen Quellen sind explizit angegeben.
2. Der Krieg ist vorbei
30. April 1945: Der Führer des Grossdeutschen Reichs, Adolf Hitler, beging im Bunker
der Reichskanzlei Selbstmord und entzieht sich so der Verantwortung. Einen Tag später
verschoss sich auch sein Propagandaminister Joseph Goebbels. Am 7. Mai 1945 unterzeichnete
Generaloberst Jodl die bedingungslose Gesamtkapitulation und beendete somit den Krieg in
Deutschland. Die Truppen der vier Siegermächte besetzten wenige Zeit später auch die
letzten Teile des Reichsgebiets und teilten Deutschland und Berlin in vier Besatzungszonen
ein.
Der Staat funktionierte sowenig wie der Mechanismus einer modernen Wirtschaft.
Deutschland lag in Schutt und Asche; Die grossen Städte waren ein einziges Trümmer- und
Ruinenfeld. Von den zehn Millionen Wohnungen 1939 wurden im Krieg mehr als 20 Prozent
zerbombt oder unbewohnbar. Die Versorgung der Bevölkerung war schlecht, die Infrastruktur
des Landes grösstenteils zerstört. Das Reich versank im grenzenlosen Elend. Es war die
Zeit, in der alles offen war - politisch, sozial und ökonomisch; Die Stunde Null
erreichte Deutschland und mit ihr die Zeit des Hungers: Die tägliche Lebensmittelration
für den Normalverbraucher bestand aus 300 Gramm Brot, 15 g Zucker, 20 g Fleisch, 7g Fett,
30 g Nährmittel und 400 Gramm Kartoffeln, was 1550 Kalorien entsprach. Vier von Fünf
Deutschen waren unterernährt. Doch die meisten dieser Lebensmittel gab es trotz
Bewirtschaftung mit Bezugsmarken nur auf dem Papier, so dass die tägliche Kalorienmenge
zeitweise auf unter 1000 fiel.
Die Stimmung in den vier deutschen Besatzungszonen war angesichts der akuten
Notsituation gedrückt. Eine Kältewelle im Januar 1947 traf auf eine Bevölkerung, die
ohne ausreichenden Brennstoff und wenig Nahrung dem Winter ausgeliefert war. Die
industrielle Produktion kam zum Stillstand. Kohlezüge wurden rigoros geplündert.
Obwohl die Bauern strengen Ablieferungskontrollen unterworfen waren, richtet sich gegen
sie der Vorwurf der Städter, aus der Lebensmittelnot Gewinn zu schlagen durch überhöhte
Preise im freien Warenverkehr und durch rigorose Tauschbedingungen. Bis ins Jahr 1948
bestanden legale Tauschzentralen, in denen Verbrauchsgüter ihren Besitzer wechselten. Die
unvermeidliche Konsequenz der materiellen Not war eine steigende Kriminalität, die auch
auf die Jugendlichen übergriff.
3. Die Zigarettenwährung
 | Das Geld, die alte
Reichsmark, war nahezu wertlos geworden; man konnte nichts damit kaufen, sondern brauchte
stattdessen Bezugsscheine, oder man konnte alles auf dem Schwarzmarkt dafür bekommen. Die
Reichsmark wurde eigentlich durch die Zigaretten ersetzt. Wer Zigaretten anbieten konnte,
stiess auf das Interesse von Millionen von Nachfragern; mehr als 60 Prozent der Deutschen
waren Raucher, auch wegen der angeblichen hungerstillenden Wirkung des Nikotins. Die
Zigarette wies damals all jene Eigenschaften auf, die eine gute Leitwährung auszeichnet:
Sie war hinreichend haltbar, teilbar und konnte damals mühelos in kleinen Einheiten in
Verkehr gebracht werden. Sogar im Ausland konnte mit ihr Handel betreiben werden. Sie
besass die ökonomischen Eckpfeiler einer Währung und diente somit als Recheneinheit,
Tauschmittel, Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel und war nebenbei kaum
inflationsgefährdet da die Raucher ständig einen Teil konsumierten. Der Wert einer
Zigarette im Vergleich zur Reichsmark stieg zwischen 1939 und Juni 1948 von 4 Pfennig auf
60 Reichsmark. Der Schwarzmarkt boomte. Die Polizei
beschlagnahmte in jener Zeit Unmengen von Tieren, Fleisch, Autos, Benzin, Zigaretten,
gefälschte Bezugsscheine und vieles mehr.
4.Die Wege zur Währungsreform
|
Der Begriff Währungsreform war in der Nachkriegszeit negativ besetzt. Er symbolisierte
Inflation, Währungsschnitt und Nachteile für einzelne Gruppen - etwa für die Besitzter
von Geldvermögen litten immer von solchen Eingriffen in den Währungswert.
Laut John M. Keynes gab es nur drei Möglichkeiten zur Kriegsfinanzierung: Steuern,
Inflation oder Staatsverschuldung, wobei die letztgenannten zwei Möglichkeiten fliessend
ineinander übergingen. Die nationalsozialistische Regierung unter Adolf Hitler entschied
sich hauptsächlich für die zweiter Variante und nahm in grossem Ausmass Kredite auf, die
fast durchweg als Reichswechsel oder Schatzanweisungen bei der Reichsbank landeten und
somit meist neugeschöpftem Geld entsprachen. Die immensen Ausgaben der öffentlichen Hand
wurden durch Verschuldung des Reichs finanziert, duch den Lohn- und Preisstopp sowie durch
eine gelenkte, staatliche Begrenzung des Angebots wurden die Ausgaben der Haushalte und
Unternehmungen für Konsum und "kriegsunwichtige" Anschaffungen gebremst. Bei
Kriegsende existierte ein Geldvolumen von mehr als 300 Milliarden Mark, wobei nur wenige
handelbare Güter gekauft werden konnten. Das Sozialprodukt des Jahres 1945 wird dagegen
auf allenfalls 50 Milliarden Reichsmark geschätzt - ein Sechstel der umlaufenden
Geldmenge. Als äusseres Merkmal dieser zurückgestauten, preisgestoppten Inflation
resultierte ein Geldüberhang, der aus der unfreiwilligen Zunahme der Kassenbestände
(Überversorgung mit liquiden Mitteln) resultierte. Um den riesigen Geldüberhang zu
beseitigen und eine Balance zwischen Angebot und Nachfrage zu schaffen, gab es drei
wesentliche Möglichkeiten die Wirtschaftslage in diesem Land zu normalisieren. (Eine
Inflation konnte es nach der offiziellen Regierungslinie eigentlich gar nicht geben.):
Die verdeckte Inflation sollte durch eine Politik der offenen Inflation ersetzt werden,
wodurch sich der Wert des Geldvermögens systematisch verringert und allmählich ein
Gleichgewicht mit den laufenden Realeinkommen und den vorhandenen Realvermögen
hergestellt würde. Freilich mehr in der Theorie; denn in der Praxis wären im
Nachkriegsdeutschland die Preise aufgrund der Nachfrage explodiert und die Geldschöpfung
fortgesetzt. Damit wäre ein permanenter Inflationsprozess entstanden, gleich einer
Schraube ohne Ende.
Eine Minderheit der Experten sprach sich für eine zweite denkbare Variante der
Geldreform aus: Der Geldüberhang sollte durch wirtschaftspolitische Massnahmen des
Staates abgetragen werden. Diese Variante hätte den Staat zum Träger der Reform gemacht:
Er hätte die Steuern drastisch erhöhen, die Produktivität dramatisch steigern und für
reiche Exportüberschüsse sorgen müssen. Mit dem Ertrag all dieser Massnahmen würde der
Staat seine Schulden in Höhe von 400 Milliarden Reichsmark zurückzahlen, das
überzählige Geld also vernichten können. Dem Wirtschaftskreislauf wäre damit die
überschüssige Liquidität entzogen worden. Eine damals ziemlich graue Theorie, obwohl
die westlichen Besatzungsmächte die Steuererhöhung in die Tat umsetzten. Also keine
Ermutigung für einen schnellen Wirtschaftsaufschwung.
Die dritte Möglichkeit war die nächstliegende: Die Reduktion der nominellen
Geldvermögen durch eine Abwertung des Geldes bei gleichzeitigem Lastenausgleich für die
Hauptbetroffenen und einer Vermögensabgabe durch die Besitzer von Sachwerten oder durch
eine zeitweilige Blockierung von Geldvermögen. Eine Mehrheit der deutschen
Währungsexperten empfahl diesen dritten Weg, welcher auch im Colm-Dodge-Goldsmith-Plan
(Abkürzung: C-D-G-Plan) verwirklicht wurde. Unter anderem musste er die folgenden
Bedingungen erfüllen:
- Die Behandlung Deutschlands als wirtschaftliche Einheit.
- Die Realisierung einer umfassenden Lösung und nicht nur einer Teillösung.
- Die Durchführung der Reform als einmaliger, harter Einschnitt anstelle einer zu milden
Lösung um die Notwendigkeit einer Reform zweiten auszuschliessen.
- Die Sicherstellung einer gerechten und verwaltungstechnisch machbaren Durchführbarkeit.
Die Feststellung des Umstellungs-(Abwertungs-)Verhältnisses war nicht einfach, da
hierbei neben den zu erwartenden Veränderungen der Zahlungsgewohnheiten der Bevölkerung
auch die Entwicklung von Produktion, Verbrauch und Einkommen geschätzt werden mussten.
Wegen der möglichen hohen Fehlerbandbreite enthielt der C-D-G-Plan auch keine fest
definierte Höhe einer benötigten Bargeldmenge, sondern er geht davon aus, dass sich die
Höhe des Geldumlaufs automatisch an der Nachfrage orientieren wird. Lediglich die
Gesamtsumme von Bar- und Buchgeld musste festgesetzt werden.
Der Wahl der Umtauschrate im Verhältnis 10 Reichsmark zu 1 Deutschen Mark (Abkürzung
DM) lagen zwei Überlegungen zu Grunde: Es erschien zum einen besser, mit einem kleinen
statt mit einem grossen Vorrat an neuem Geld zu beginnen, zum anderen würde sich das
Geldvolumen in den ersten Monaten und Jahren nach der Umstellung schon allein deswegen
erhöhen, weil sich ein Defizit in den öffentlichen Kassen kaum vermeiden lassen würde.
Der Colm-Dodge-Goldsmith-Plan beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Leitsätze:
- Die Deutsche Mark ist die Geldeinheit von Deutschland. Sie wird in 100 Deutsche Pfennige
unterteilt.
- Eine autorisierte Emission von Deutsche-Mark-Noten in den Nennwerten von 1/2, 1, 2, 5,
10, 20, 50 und 100 DM
- Vorhandene und zur Zeit im Umlauf befindliche Münzen von 1, 5 und 10 Pfennig (ohne
Unterscheidung der Arten, wie Reichspfennig, Rentenpfennig, usw.).
- Alle anderen nicht genannten Noten und Münzen sollten ihre Gültigkeit verlieren.
- Umstellung aller Verbindlichkeiten und Forderungen im Verhältnis 10 Reichsmark für 1
DM . Löhne, Preise, Mieten, Steuern, Gebühren und Abgaben sowie sonstige wiederkehrende
Zahlungen und Vergütungen blieben im jedoch Verhältnis 1 Reichsmark zu 1 DM, da eine
Reduktion des Geldüberhangs nur durch eine Abwertung (Vernichtung) des vorhandenen
Geldbestands möglich war.
- Sämtliche Staatsschulden wurden für null und nichtig erklärt.
- Personen mit einem Vermögen über 10'000 DM mussten eine Sonderabgabe bezahlen.
5. Der Tag X
Schon kurz nach dem Krieg war eigentlich
jedem klar, dass eine Währungsreform kommen musste. Als Zentralbank der Länder im
Vereinigten Wirtschaftsgebiet entsteht am 1. März 1948 in Frankfurt die Bank deutscher
Länder. Das Grundkapital betrug 100 Millionen Reichsmark. Ein Direktorium leitete die
Bank, deren Politik vom Zentralbankrat bestimmt wird. Die Alliierte Bankkommission
überwachte die Tätigkeit der Bank. Als im März 1948 die Sowjets aus dem Alliierten
Kontrollrat auszogen und zwei voneinander unabhängige deutsche Zentralbanken in West und
Ost existierten, ahnte die westdeutsche Bevölkerung den unmittelbar bevorstehenden Tag X
der Währungsreform. Die Preise der Produkte stiegen in jenen Tagen ins Astronomische, da
viele Bürger ihre Reichsmark so schnell wie möglich loswerden wollten. In Erwartung des
neuen Geldes hielten viele Händler ihre Waren zurück, um diese später gegen neues
(gutes) Geld verkaufen zu können.
Die französische Regierung erklärte sich zur Beteiligung an der Reform
bereit, während der sowjetische Militärgouverneur die Aufschiebung um eine Woche und
neue Beratungen forderte, als er die Mitteilung von der Währungsneuordnung erhält. Da
Westalliierten eine Einigung mit der sowjetischen Militäradministration nicht für
möglich hielten, wurde die Umtauschaktion wie vorgesehen am 18. Juni 1948 bekanntgegeben
und am 20. Juni 1948 durchgeführt.
Von der Bank Deutscher Länder werden die in den USA gedruckten
Banknoten verteilt. Jeder Bürger der Westzonen erhielt zunächst 40 DM für 40 RM, wobei
20 DM im August 1948 folgten. Da genügend Güter vorhanden waren konnte so das neue Geld
seine gesunde Kaufkraft voll entfalten. Insgesamt kamen an diesem 20 Juni 500 Tonnen
Bannknoten im Gesamtwert von rund 5.7 Milliarden DM in den Geschäftsverkehr. Juristische
Personen, Unternehmer und Gewerbetreibende erhielten einen sog. Geschäftsbeitrag von 60
DM je beschäftigtem Arbeitnehmer. Die Reichsbahn und die Reichspost wurden mit 300
Millionen DM versorgt. Im Laufe der nun beginnenden Woche mussten die Bürger der
Westzonen ihre über die Kopfquote hinausgehenden Reichsmarknoten bei Banken und
Sparkassen abliefern. Die Hälfte davon wurde im Verhältnis 10 zu 1 einem Freikonto
gutgeschrieben, die andere Hälfte zunächst auf einem Festkonto blockiert und ab Oktober
1948 um 70 Prozent gekürzt freigegeben. Daraus ergab sich das endgültige
durchschnittliche Umstellungsverhältnis 100 Reichsmark zu 6.5 Deutschen Mark. Die
Alliierten wollten mit der geringeren Umwandlungsquote die Notenumlaufmenge niedrig halten
und den sich ab Herbst 1948 deutlich abzeichnenden Preisauftrieb in den Griff bekommen.
Zwei Tage nach der Währungsreform wurden die exorbitanten Einkommen-
und Körperschaftssteuern gesenkt, um den Konsum anzuregen und speziell die kleinen
Einkommensbezieher besserzustellen. Die Steuerlast wurde dabei nahezu halbiert.
Jedoch brachte die Währungsreform auch Härten, die fast immer zu
Lasten des kleinen Mannes gingen. Der Wohlhabende dagegen wurde für den fälligen
Wirtschaftsaufschwung gebraucht und daher geschont. Ein Sozialrabatt hätte anfänglich
die Bürokratie überfordert. So bemühte sich der Gesetzgeber hinterher den angerichteten
Schaden ein wenig zu reduzieren; Auf alle am Tag der Währungsreform steuerpflichtigen
Vermögen wurde eine Vermögensabgabe in Höhe von 50 Prozent geschaffen, allerdings auf
30 Jahre verteilt, damit die Reichen nicht investitionsmüde wurden. Ferner wurde eine
Hypothekengewinnabgabe eingeführt, die einem Schuldner jenen Gewinn abschröpfte, den er
mit der Verringerung seiner ursprünglichen Schuld auf 10 Prozent erzielte. Der neu
geschaffene Lastenausgleichfonds, in den die Erträge aus diesen Abgaben flossen,
verteilte das Geld hauptsächlich an die durch Krieg und Währungsreform benachteiligten
Personen.
6. Die Teilung Deutschlands
Erhards Bekenntnis zur Marktwirtschaft konnte der einst mit den USA
verbündeten sowjetischen Besatzungsmacht nicht gefallen. Zudem war die Sowjetunion seit
1948 auch nicht mehr Mitgied im Kontrollrat. Sogleich verbot sie den Gebrauch der neuen
Währung in der Ostzone und in ganz Berlin. Am 23. Juni 1948 verkündete die Sowjetunion
eine eigene Währungsreform die neben ihrem Besatzungsgebiet auch im Westteil Berlins
gelten sollte. Als Antwort untersagten die drei westlichen Stadtkommandanten die
Verwendung der neuen Ostmark in Westberlin. Auch die Sowjetunion reagierte: Sie schnürt
Westberlin zu Land und Wasser von Westdeutschland ab; die Berliner Blockade begann. Sie
endete im Juli 1949. Die Teilung Deutschlands verfestigte sich in dieser Zeit mehr und
mehr. Die Ostmark blieb schwach, die D-Mark wurde stärker. Die Währungsreform hatte
Deutschland tatsächlich gespalten.
7.Der Turn-around
Trotz allgemeiner Bedenken bewährte sich die Geldreform in Verbindung mit einem
energischen Abbau der Befehlswirtschaft und einer im ganzen zweckmässigen Geldpolitik der
Zentralnotenbank; die Marktpreisbildung erhielt wieder ihren Sinn, der innere Geldwert
stabilisierte sich, ein Wechselkurs bildete sich heraus, der eine Teilnahme
Westdeutschlands an der arbeitsteiligen und Leistungswettbewerb beruhenden Weltwirtschaft
ermöglichte.
Die D-Mark ging anfangs weniger durch Höhen als vielmehr durch Tiefen; und erst nach
einiger Zeit erwies sich, dass sie auf der Erfolgsspur war.
Um den ökonomischen Wiederaufbau Deutschlands zu ermöglichten verzichteten die
westlichen Siegermächte auf wesentliche Teile ihrer Restaurationsforderungen und setzten
die Staatsschulden auf 13.7 Milliarden DM fest, welche in jährlichen Raten zu 550
Millionen zurückgezahlt wurden.
Trotz dieser Umstände begann die Mark 1948 mit einem Fehlstart. Der erste
Käuferansturm nach der Währungsreform brach mit der Zahlung der Löhne und Gehälter
Ende Monat Juni los. Binner weniger Tage stiegen manche Preise für Konsumgüter
dramatisch an, während andere (zumeist für Produkte, die keine Güter des täglichen
Bedarfs waren) billiger wurden. Trotz eines Generalstreiks wurden die Löhne nicht
erhöht, wodurch die endlose Schraube des Preis-Lohn-Karussells verhindert wurde.
Durch den Korea-Krieg begann der eigentliche deutsche Wirtschaftsaufschwung, da die
Produktionskapazitäten der deutschen Konkurrenten durch die Rüstung für die USA
gebunden waren. In diese Lücke stiessen die deutschen Exporte, denen sonst ein so
schneller Vormarsch auf die Weltmärkte schwergefallen wäre. Die deutsche Wirtschaft
wurde als Exportlieferant gebraucht (und diesen Status hat sie ausgebaut und bis heute
gehalten).
Der Beginn des Krieges wurde durch Angst und Schrecken unter den Bürgern begleitet,
wodurch Hamsterkäufe die Verbraucherpreise in die Höhe jagten.
 Durch
Marshall-Plan und Exportförderung bei gleichzeitiger Dämpfung der Binnennachfrage drehte
sich die negative deutsche Handels- und Zahlungsbilanz erstmals Ende März 1951 um. Die
Bundesrepublik konnte im Jahresverlauf erstmals ihre gesamten kurzfristigen
Auslandsschulden zurückzahlen, die Bank deutscher Länder eine Währungsreserve in Höhe
von 1.5 Milliarden D-Mark neben einem ersten Goldbestand von symbolischen 116 Millionen
Mark anlegen. 1952 verzeichnete Deutschland bereits einen Handelsüberschuss von 2.3
Milliarden Mark, der sich 1953 auf über 4.1 Milliarden erhöhte.
Die Deutsche Mark hatte offensichtlich den schweren Test bestanden. Von nun an war die
D-Mark im Aufwärtstrend. Die goldenen Jahre der D-Mark konnten beginnen, und mit ihnen
das Wirtschaftswunder.
8.Das Wirtschaftswunder
Die Wirtschaftsexperten sind sich einig: Ein Wunder war die Deutsche
Mark eigentlich nicht. Es war vielmehr eine Mischung aus glücklichen Umständen und
Fleiss, Konsenswillen der Tarifpartner und Verzichtbereitschaft der Bürger und basierte
auf der Kombination von hohen Wachstumsraten, dem daraus folgenden raschen Abbau der
Arbeitslosigkeit und hohen realen Einkommenssteigerung für die meisten Bürger bei
dennoch stabilem Geldwert.
Die goldenen, fetten Zeiten der Mark waren die sieben Jahre des Aufbaus zwischen 1952
und 1958; damals wurde das Fundament für eine der härtesten Währungen der Welt gelegt.
1952 hatte die Bundesrepublik Deutschland bereits wieder ein Produktionsniveau
erreicht, das mit dem Vorkriegsstand vergleichbar war, und zwischen 1953 und 1960 stieg
das Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik um unglaubliche 61Prozent. Neben der
Währungsreform bildeten vor allem der rasche Wiederaufbau der Städte und der Industrie
sowie günstige Exportbedingungen (Korea-Krieg) wichtige Voraussetzungen für das
Wirtschaftswunder; ein entscheidender psychologischer Faktor war sicher auch der
Aufbauwille der Bevölkerung. Ausserdem profitierte die Bundesrepublik von der im Rahmen
des Marshallplanes geleisteten Wirtschaftshilfe der USA, der Wert der Exporte
verdreifachte sich. Die Währungsreserven stiegen um das 17-fache auf 26.1 Milliarden, die
Geldbestände fast um das 100-fache auf stolze 11.1 Milliarden D-Mark. Jahr für Jahr
wurden mehr als 500'000 Wohnungen fertiggestellt und etwa genauso viele neue
Arbeitsplätze geschaffen. Die Zahl der Arbeitslosen sackte im September 1955 auf 495'000,
was einer Quote von 2.7 Prozent entsprach. Statistisch gesehen war die Vollbeschäftigung
erreicht. 1956 resultierte daraus eine Arbeitszeitverkürzung von 48 auf 45 Stunden pro
Woche bei einer Lohnerhöhung um 9 Prozent.
-
1957 wurde die Deutsche Bundesbank gegründet und beendete die Arbeit der Bank
deutscher Länder. In Paragraph 12 wurde die Arbeitsteilung zwischen Regierung und Bank
festgelegt: "Die Deutsche Bundesbank ist verpflichtet, unter Wahrung ihrer Aufgabe
die allgemeine Wirtschaftspolitik der Bundesregierung zu unterstützten. Sie ist bei der
Ausübung der Befugnisse, die ihr nach diesem Gesetz zustehen, von den Weisungen der
Bundesregierung unabhängig. Ihr oberstes Ziel ist die Sicherung der Währung" wofür
sie 3000 Tonnen Gold hortet, wobei ein Grossteil im amerikanischen Fort Knox gelagert
wird. Hierfür Erhards schlichte Begründung: "Das Gold ist im Ausland sicherer als
in Frankfurt, einer Stadt, die von den hinter der stark befestigten deutsch-deutschen
Grenze stationierten russischen Panzern innerhalb weniger Stunden erreicht werden
könnte".
Seit 1959 war die Mark wieder frei umtauschbar; jeder konnte seine D-Mark in beliebiger
Höhe ohne Genehmigung in jede andere Währung wechseln, Devisen ins Ausland transferieren
und im In- oder Ausland Devisenguthaben unterhalten. Neben Deutschland entschlossen sich
Grossbritannien und die Schweiz zu diesem Schritt, der marktwirtschaftliche Regeln auch
für den Bereich der Währung und des Aussenhandels einführte. Die einzelnen Regierungen
verzichteten damit auf eine Kontrolle des Devisenverkehrs und kehrten mit der
Konvertibilität indirekt wieder zum Geldstandard zurück, da der US-Dollar seit 1934 mit
35 Dollar pro Unze eine feste Relation zum Geld besass.
Die Mark, gerade zehnjährig, war nun aus dem gröbsten raus und mit ihr die deutsche
Wirtschaft.
9. Die Midlife-Crisis
Im Herbst 1968 begann die eigentliche "Sturm- und
Drang-Periode" der eben 20-jährigen Mark. Es schien, dass sich die Unruhen der
rebellierenden akademischen Jugendlichen auf die Währung übertrug: In beiden Bereichen
stimmte die Ordnung nicht mehr. Die Konjunktur drohte zu überhitzen, was eine Gefährdung
des Geldwertes darstellte. (Einem Arbeitslosen standen sechs [!] offene Stellen
gegenüber, worauf sich die Gewerkschaften Lohnerhöhungen von 4.5 Prozent ohne Probleme
hatten durchsetzen können. Darauffolgend stiegen die Konsumentenpreise an; die Inflation
[= Geldentwertung] hätte eingesetzt.) Die Deutsche Bundesbank konnte nicht gegensteuern,
da jede Zinserhöhung einen weiteren Geldzufluss aus dem zinsbilligen Ausland angelockt
hätte. Eine Aufwertung schädigt die Exportwirtschaft (welche für den
"Aufstieg" Deutschlands notwendig war). Die Lage verschärfte sich nach den
Mai-Unruhen in Paris, nachdem Pompidou den Franc um 11.1 Prozent abwertete.
Am 27. Oktober 1968 wurde nun unter der Regierung von Willy Brandt die Mark offiziell
um 9.3 Mark aufgewertet; die neue Parität zum US-Dollar betrug nun 3.66 DM. In den
darauffolgenden Jahren beruhigte sich die Situation in Deutschland wieder. Es schien, als
hätte die D-Mark die "Midlife-Crisis" relativ gut überstanden.
10. Aus zwei wird eins
Die Einführung der (West-) Deutsche Mark als alleinige Währung in der DDR war durch
die Währungsreform von 1990 ermöglicht worden. Innerhalb nur eines halben Jahres wurden
in schwierigen Verhandlungen die entsprechenden Weichen gestellt. Eingebettet war dieser
Währungsaustausch in die zum 1. Juli 1990 vereinbarte Wirtschafts-, Währungs- und
Sozialunion. Dieser Sonntag markiert für die deutsche Währung den Beginn der staatlichen
Einheit, das Ende der Ostmark und den Abschluß einer gigantischen logistischen Operation
zur Einführung des Westgeldes in der DDR.
-
Die Ostmark war für die Dauer ihrer 42jährigen Existenz eine reine Binnenwährung;
ihr Export war verboten, ein internationaler Handel auf den Devisenmärkten fand nicht
statt. Sie trug drei offizielle Namen - bis 1964 Deutsche Mark, bis 1968 Mark der
Deutschen Notenbank, seitdem Mark der DDR.
Weil schon damals ein Geldüberhang bestand, mußten alle DDR-Bürger ihre Geldscheine
bis zum Wert von 300 Mark zum Stichtag 13. Oktober im Verhältnis 1 : 1 umtauschen. Wer
mehr Geld besaß, mußte es auf Konten einzahlen, bis die Rechtmäßigkeit geklärt und
eine «spekulative Herkunft» nicht nachzuweisen war. Damals verringerte sich die
Bargeldmenge um erstaunliche 1,5 Milliarden Ostmark, immerhin 27 Prozent vom gesamten
Geldumlauf. Dennoch hatte der Umtausch keine Auswirkungen auf Währung und Wirtschaft der
DDR, da das Geld in der Zentralverwaltungswirtschaft keine Steuerfunktion besaß. Die
Preise waren künstlich niedrig, das Warenangebot schlecht, nur die Geldversorgung
funktionierte.
Um überhaupt mit Devisen Importe bezahlen zu können erhob die DDR von jedem Besucher
aus dem Westen einen Zwangsumtausch zum Phantasiekurs von 1 : 1 und richtete im ganzen
Land Läden ein, in denen gegen Westgeld praktisch alle Güter des gehobenen Bedarfs
verkauft wurden. Dadurch wurde die Ostmark de facto noch weiter abgewertet, weil jeder
versuchte, sie möglichst schnell in Westmark zu wechseln. Die DDR-Regierung schuf damit
selbst ein weiteres Motiv für die Sehnsucht ihrer Bürger nach dem Westen.
Umgekehrt, im Wege eines regelrechten Menschenhandels, ließ sie gegen westliche Waren
auch Häftlinge oder Familienangehörige frei und in den Westen ausreisen. Seit 1963, dem
Beginn der Freikaufaktionen, strikt darauf, daß niemals ein DDR-Bürger direkt gegen
Westmark geliefert oder getauscht wurde; doch gab es in der Praxis sehr wohl eine
Kopfquote für politische Häftlinge, die in den ersten Jahren durchweg 40000 D-Mark
betrug. In diesem Wert lieferte der Westen pro Kopf Waren des täglichen Bedarfs in die
DDR, etwa Butter, Rohkaffee.
1977 steigerte die DDR den Preis für einen ihrer auszulösenden Staatsbürger auf die
stolze Summe von 95847 DM pro Kopf; Jedenfalls erreichten die Zahlungen der Aktion
Freikauf nun, so schilderte es der westliche Unterhändler Ludwig Rehlinger, «eine
Größenordnung, die langsam auch unter volkswirtschaftlichem Gesichtspunkt für die DDR
ein beachtliches Gewicht erhielt». So war es in der Tat: Bis die Mauer fiel und sich die
DDR am 19. Dezember 1989 vertraglich zur Freilassung aller politischen Häftlinge aus
ihren Gefängnissen verpflichtete, wurden seit 1963 genau 33755 Häftlinge zum Preis von
3.5 Milliarden D-Mark freigekauft. Mit diesem Geld subventionierte Bonn die marode
DDR-Wirtschaft.
Anfangs Oktober 1989 begannen die Demonstrationen («Wir sind das Volk»), worauf die
DDR-Staatsführung ratlos nachgibt, auf Gewalt verzichtet und am 18. Oktober, wenn auch
widerwillig, zurücktritt. Am Abend des 9. November fällt um 23.00 Uhr, als sei es ein
Versehen, die Mauer. Am 20. November rufen die Leipziger Montagsdemonstranten erstmals
«Wir sind ein Volk», und wenig später ertönt der verblüffend ehrliche Ruf: «Kommt
die D-Mark, bleiben wir; kommt sie nicht, gehen wir zu ihr!» Mit diesem Bekenntnis
überholen die Demonstranten viele westdeutsche Politiker, die sich bis dahin eine
Auflösung des ostdeutschen Staates, dessen Ablösung aus dem kommunistischen Machtbereich
und eine Vereinigung mit dem Westen gar nicht vorstellen konnten. Tatsächlich laufen dem
ostdeutschen Staat die Einwohner davon -trotz der Aussicht, die DDR könne sich womöglich
mit freien Wahlen und einer besseren Wirtschaftsordnung reformieren. Allein in der kurzen
Zeit bis zum 31. Dezember 1989 verlassen 2 Prozent oder 343 854 Bürger offiziell den
sterbenden Staat. Die DDR-Währung sackt auf einen Kurs von 20 Ostmark zu einer Westmark,
weil zu viele Besucher oder Ausreisende aus der DDR damit die ersehnte D-Mark kauften.
Am 1. Juli 1990 wurde die Ostmark im Verhältnis 1.80 Ostmark zu 1 DM umgetauscht. Es
errechnete sich aus der Umstellung von Löhnen und Renten zum Kurs 1 zu 1; Schulden,
Guthaben und Forderungen wurden dagegen 2 zu 1 getauscht. 460 Tonnen Geldscheine und 600
Tonnen Münzen im Wert von 27.5 Milliarden Deutschen Mark wurden auf Lastwagen in die DDR
geschafft. Die alten Ostmark-Banknoten wurden in einem stillgelegten Stollen
"entgelagert"; die Münzen (die bis Juli 1991 gültig blieben) wurden
eingeschmolzen und zu Dosen verarbeitet.
Auch für die aussenpolitische Absicherung der deutschen Einheit erwies sich die Mark
als wertvolles Treibmittel: Der Sowjetunion wurde ihre Zustimmung zur Wiedervereinigung
abgekauft. Insgesamt flossen etwa 15 Milliarden D-Mark ins untergehende Sowjetreich und
halfen den Umbau in ein neues wirtschaftliches System zu erleichtern.
Am 22. Juli 1990 wurden die ehemaligen Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aus den ehemaligen, 1952 geschaffenen DDR-Bezirken
Frankfurt / Oder, Cottbus, Potsdam, Rostock, Neubrandenburg, Schwerin, Karl-Marx-Stadt
(Chemnitz), Leipzig, Dresden, Magdeburg, Halle, Erfurt, Gera und Suhl geschaffen.
Knapp einen Monat später, am 23. August 1990, beschliesst die DDR-Volkskammer mit der
erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland.
2. Oktober 1990: Letzter Tag des Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik und
Abgabe aller Gewaltenteilung an die Bundesrepublik. Der Geltungsbereich des Grundgesetzes
und der gültigen Gesetze erstreckt sich seit dem 3. Oktober 1990 auch auf die
beigetretenen Bundesländer.
Das bedeutete die Vereinigung der beiden deutschen Staaten und Berlins und somit die
Wiederherstellung eines souveränen deutschen Gesamtstaates. Die Besatzungsrechte der USA,
der Sowjetunion, Großbritanniens und Frankreichs wurden aufgehoben.
Im übertragenen Sinn ist die Vision Johann Wolfgang von Goethes
von 1828 nach einer deutschen Einheitswährung (schon einmal nach der Reichsgründung
1871 und Einführung der Mark-Währung) dann 1990 zum zweiten Mal Wirklichkeit geworden:
"Mir ist nicht bange, daß Deutschland nicht eins werde, vor allem sei es eins in
Liebe untereinander - und immer sei es eins, daß der deutsche Thaler und Groschen im
ganzen Reiche gleichen Wert habe -eins, daß mein Reisekoffer durch alle deutschen Länder
ungeöffnet passieren könnte. "
11. Die 90er Jahre
Die länger wirkenden Folgen der Einheit waren
gravierend: Zwar konnte die Deutsche Bundesbank die befürchtete Inflationsgefahr aufgrund
der höheren Notenumlaufmenge eindämmen, aber der Währungsschock im Osten trieb zahllose
Firmen in den Konkurs, speziell solche, die bis anhin für die östlichen
Staatshandelsmärkte produzierten: Die Kundschaft konnte die neuen Preise nicht in der
teuren Westmark bezahlen. Das Bruttosozialprodukt der neuen Bundesländer erreichte 1991
30 Prozent des Westniveaus.
Die Deutsche Mark wurde zusehends die europäische Leitwährung: 1991 betrugen die
DM-Devisen-Bestände in den offiziellen Zentralbanken 229 Milliarden, was 18 Prozent der
Weltwährungsreserven entspricht. Damit rangiert die DM auf Platz zwei der Welt hinter dem
US-Dollar (56 Prozent) und vor dem japanischen Yen (11 Prozent). In britischen Pfund, der
einstige Reservewährung Europas, waren nur noch vier Prozent angelegt.
Manche Notenbanken koppelten ihre eigene Währung so eng an die Mark und damit an die
Politik der Bundesbank, dass ein eigentlicher Block entstand (zusammen etwa mit dem
niederländischen Gulden oder dem österreichischen Schilling. Auch die Schweiz ist an
einem Wechselkurs von 80 bis 85 Rappen je D-Mark interessiert).
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und im jugoslawischen Bürgerkrieg Angang dieses
Jahrzehnts entwickelte sich die Mark in etlichen Regionen zur inoffiziellen
Parallelwährung. 1991 gehörte mehr als eine Billion Mark ausländischen Besitzern.
12. Eine Ära geht zu Ende
-
Spätestens im 54. Lebensjahr (1. Juli 2002) ihrer
Existenz soll die Deutsche Mark aufhören zu existieren. So sieht es der Maastrichter
Vertrag vor, der im Dezember 1991 von den Staats- und Regierungschefs vereinbart und im
Februar 1992 von den Aussen- und Finanzministern der Europäischen Gemeinschaft
unterzeichnet wurde, die sich seitdem Europäische Union nennt. Ein Euro entspricht seit
dem 31. Dezember 1998 genau 1.95583 Deutsche Mark.
Selbstbehauptung und Wohlfahrt scheinen heutzutage nur dann garantiert, wenn die
Aussenpolitik auf Konfliktvermeidung und Sicherung des Friedens, die Wirtschaftspolitik
auf bestmögliche Chancen und damit auf Mehrung des Wohlstands angelegt ist. Beides kann
Deutschland nur in Harmonie mit seinen Nachbarn, in einer Integration oder wenigstens
einer wirtschaftlichen Union. Der klassische Aussenhandel läuft besser, wenn die Märkte
miteinander verzahnt und vernetzt sind.
Der europäische Markt ist heute unauflöslich ineinander verflochten. Deutschland
erwirtschaftet rund ein Drittel des Bruttosozialprodukts im Export und verkauft fast drei
Viertel seiner Ausfuhren innerhalb der Europäischen Union, aus der es umgekehrt zwei
Drittel seiner Einfuhren bezieht.
Durch Einführung des Euros (vormals ECU) wird in Europa ein Binnenmarkt entstehen. Die
Wechselkursschwankungen (und -risiken) fallen genauso wie die Umrechnungskosten weg.
Bundesbankpräsident Tietmeyer, dass Deutschland "viel zu verlieren habe -
nämlich eine der erfolgreichsten und besten Geldverfassungen der Welt". Bereits am
1. Juni 1988 warnte Pöhl in einem Brief an den Kanzler: "Jeder Versuch, die
Wechselkurse in der EG (heute EU) dauerhaft zu fixieren und die nationalen Währungen
abzulösen" sei "zum Scheitern verurteilt", wenn es nicht auch "ein
dazu passendes Mass an wirtschafts- und finanzpolitischer Willensbildung und
Entscheidungsfindung auf Gemeinschaftsebene" gebe. Ein "zu früher
Verzicht" auf Wechselkursänderungen könne "einen erheblichen Ressourcen- und
Finanztransfer zu Lasten der starken Mitglieder erfordern und die EG unter Umständen
Belastungsproben aussetzten, denen sie politisch noch nicht genügend gewachsen
wäre".
Davon, dass die Deutschen die eigentlichen Opfer des Maastrichter Vertrags wären,
kann, weder inhaltlich noch im Rückblick die Rede sein, da sie die Eingangskriterien für
alle Teilnehmer der Währungsunion so fest und so hoch zurrten, dass tatsächlich die
Voraussetzungen für eine höchstmögliche Stabilität der künftigen
Gemeinschaftswährung erfüllt scheinen:
Die neue Europäische Zentralbank (EZB) wird so unabhängig wie die Deutsche
Bundesbank; im Gegensatz zu jener wird die sogar ausdrücklich verpflichtet, die
"Preisstabilität zu gewährleisten" und die Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft
nur solange zu unterstützen, "soweit die ohne Beeinträchtigung des Ziels der
Preisstabilität möglich ist."
Ein eigens Zusatzprotokoll zum Maastrichter Vertrag legt vier Konvergenz-Kriterien
fest, die jedes Teilnehmerland erreichen und einhalten muss. Sollte ein Mitglied der
Währungsunion in seiner nationalen Zuständigkeit später zu viele Schulend machen und
damit die Stabilität der Euro-Währung gefährden, kann es sogar öffentlich bestraft
werden. Preisstabilität und Verhinderung eines übermässigen Defizits sind zentrale
Inhalte des Protokolls. Die Neuverschuldung eines Staates darf den Referenzwert von drei
Prozent des Bruttosozialprodukts nicht überschreiten. Die Gesamtschulden eines Mitgliedes
dürfen 60 Prozent des Bruttoinlandprodukts nicht überschreiten, es sei denn, dass das
Verhältnis hinreichend rückläufig ist und sich rasch genug dem Referenzwert nähert.
Die erste Stufe der Währungsunion war im Juli 1990 mit der Liberalisierung des
Kapitalverkehrs innerhalb begründet; die zweite Stufe wurde 1994 mit der Gründung des
Europäischen Währungsinstituts genommen, das die Europäische Zentralbank vorbereitete
und die Funktionsfähigkeit des Europäischen Währungssystems überwacht. Am 1. Januar
1999 trat offiziell die dritte Stufe in Kraft, welche die einzelnen Wechselkurse der
Teilnehmerstaaten (D, F, I, Belgien, Luxemburg, Holland, Sp, P, A, Irland, Finnland)
unwiderruflich an einen Umrechnungskursen zum Euro. Die Parallelität von neuer Währung
und alten Valuten soll höchstens dreieinhalb Jahre, bis zum 1. Juli 2002, dauern. An
diesem Tag verliert das alte Geld seine Gültigkeit, darf aber bei den Zentralbanken
weiter umgetauscht werden. In der Zwischenphase bis 2002 werden alle Konten,
Geldautomaten, Versicherungsverträge, Steuerbescheide, Preise und alles andere, was mit
Geld zu tun hat, umgestellt. Die Operation, bis zu 370 Millionen Menschen mit neuem Geld
zu versorgen, wird gigantische Ausmasse annehmen. Nur der deutsche Finanzminister kann
sich freuen: Er kann in die Haushaltsgeschichte als derjenige eingehen, der die deutschen
Staatsschulden (wenigstens zahlenmässig) mit einem Schlag fast halbiert.
1997 machte das Wort "kreative Buchführung" die Runde in Brüssel, als
einzelne Regierungen ihre Bilanzen vor dem Stichtag zu verschönern trachteten, um die
Kriterien eben doch möglichst punktgenau zu erfüllen, obwohl der Vertrag eine solche
Exaktheit nicht verlangt. Die EU-Kommission warnte in ihrem Jahreswirtschaftsbericht 1997
sogar ausdrücklich vor einmaligen Aktionen, um das Etatdefizit zu drücken: «Es versteht
sich von
selbst, daß die grundlegenden Haushaltspositionen durch solche Maßnahmen mit
vorübergehender Wirkung nicht verbessert werden.»
Das hinderte Belgien 1996 nicht daran, 200 Tonnen seiner Goldreserven auf dem freien
Markt zu verkaufen. Belgiens Regierung zeigte sich darüber hinaus erfinderisch: Die
staatliche Sparkassengesellschaft mußte dem Staat einen Vorschuss auf die Privatisierung
der ebenfalls staatlichen Telefongesellschaft zahlen; das staatliche Lotterieunternehmen
wurde verpflichtet, seine Gewinne für sieben Jahre im voraus an die Staatskasse
abzutreten.
Besonders raffiniert ging die französische Regierung vor, um ihr Etatdefizit zu
mindern. Die staatliche Telefongesellschaft "France Telecom" verkaufte dem Staat
mit Hilfe eines Sondergesetzes gewaltige Pensionsverpflichtungen für ihre Mitarbeiter und
überwies ihm dafür eine Einmal-Zahlung von 37,5 Milliarden Franc, also etwa elf
Milliarden Mark. Der Staat buchte das Geld als Einnahme- obwohl es der Kauf einer
späteren Rückstellung ist - und minderte damit seine Schulden.
Die Wirtschaftswoche gab dem Euro schon den höhnischen Namen Camembert-Währung:
«Rund und weich, französischer Käse.»
Die Verbindlichkeiten der öffentlichen Krankenhäuser sind in Deutschland Teil der
staatlichen Gesamtschuld, in anderen Ländern nicht. Bei der Berechnung des
Drei-Prozent-Schuldenkriteriums werden sie nun überall ausgeklammert; und allein
"diese Rechenoperation mindert Deutschlands Schulden um 0,2 Prozentpunkte. Sie sinken
rechnerisch weiter durch die kurzzeitigen Überschüsse von 8 Milliarden Mark in den
Öffentlichen Kassen der Pflegeversicherung. Des weiteren verkaufte die Deutsche
Bundesregierung "Lufthansa-" und "Deutsche Telekomaktien." Wir sehen
also, dass die Regierungen mit guten Einfällen die leichter erfüllen konnten.
1997 tauchte aus den Leserbriefspalten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Problem
ans Licht, das Bundesbankpräsident Pöhl mitsamt seinen Experten 1991 bei den
Verhandlungen der Zentralbanken zu technischen Details des Maastrichter Vertrages glatt
übersehen hatte: Es geht um die Ermittlung und Verteilung der Gewinne der künftigen
Europäischen Zentralbank (EZB) allen beteiligten nationalen Zentralbanken gemäß ihrem
Anteil am Grundkapital der EZB zustehen. Dieses Grundkapital in Höhe von maximal 5
Milliarden Euro - in Maastricht hieß es noch Ecu -müssen die Notenbanken nach einem
Schlüssel aus Bevölkerungszahl und des Bruttoinlandprodukts einbringen. Hätten alle 15
EU-Mitglieder die Währungsunion erreicht, müsste zum Beispiel Deutschland 23 Prozent des
Kapitals einzahlen und erhielte später entsprechend 23 Prozent der Gewinne. Das Problem:
Der Bundesbank stünden eigentlich 35 Prozent der monetären Einkünfte zu.
Zu dieser Panne im Vertragswerk gesellen sich die Kosten der Umstellung. Heute müssen
Tausende von Computerprogrammen in Banken und Geschäften geändert, Kassen und Automaten
umgebaut, Preise und Mieten neu festgelegt, Preislisten und Kataloge neu geschrieben
werden. Allein der Verband der deutschen Automatenindustrie beziffert die Kosten für
einen Umbau der 130000 Geld- sowie der 3,2 Millionen Münz- und Spielautomaten auf etwa
600 Millionen Mark. 656 Millionen Mark kostet der Umtausch aller deutschen Mark- und
Pfennig-Münzen. Die Aktiengesellschaften müssen ihr Grundkapital neu aufteilen, die
Parlamente in Bund und Ländern einige tausend Gesetze ändern, die Bezüge zur Mark
aufweisen - von der Einkommensteuer über Sozialhilfe- und Unterhaltssätze bis zum
GmbH-Recht. Und weil die Umstellung auf Euro krumme Beträge nach sich zieht, erwarten
Experten für eine Übergangszeit spürbare Folgen für die Preise, da viele Unternehmer
aufrunden und den höheren Preis als Umstellungskosten deklarieren. Die deutschen
Finanzunternehmen rechnen mit Kosten von 10 Milliarden Mark.
Zusätzlich gilt eine psychologische Komponente, die Jim Murray erklärte: "Der
Übergang zum Euro ist ein traumatischer Prozess, denn viele Menschen werden sich wie
Fremde im eigenen Land fühlen, da sie den vertrauten Bezugspunkt zum Geld
verlieren."
Auf der deutschen Bühne, so fand 1997 der Mailänder Corriere della Sera heraus,
spiele ein «kollektives Psychodrama, in dem sich Wirtschaft und nationale Identität,
Politik und die Gespenster der Geschichte vermengelt»: Angst und Stolz spielen darin die
Hauptrollen, der Stolz auf die starke Mark und die Angst um sie. Wenn aber der Euro so
stabil wird wie die Mark- und er hat heute bessere Chancen als sie vor 50 Jahren -, dann
wird auch die Angst obsolet.
Nachwort
Die Deutsche Mark - Eine Erfolgsstory, die ihres Gleichen sucht. Die
D-Mark symbolisiert den Werdegang einer Nation, die nach dem 2. Weltkrieg besiegt am Boden
lag und sich wie Phönix aus der Asche erhob. Die DM begann am 20. Juni 1948 als schwache
Währung und schien bereits 1950 ihrem Ende nahe. Sie trennte Deutschland und war unter
anderem für die Berliner Blockade verantwortlich. Dank dem Marshall-Plan und dem
Korea-Krieg konnte die junge Mark in ungeahnte Höhen aufsteigen. Als wahres
Wirtschaftswunder ging sie so in die Geschichte des 20. Jahrhunderts ein. In den 70er
Jahren erlebte sie wie andere europäische Währungen einige Turbulenzen, welche sie ohne
einschneidende Massnahmen überwinden konnte. Sie erlebte die Wiedervereinigung eines
durch zwei komplett verschiedene Wirtschaftssysteme getrennte Staaten. Weltweit wurde sie
neben dem US-Dollar zur zweiten Leitwährung. Und nun kommt der Euro, nach 54 Jahren und
10 Tagen wird sie zum letzten Mal offiziell gehandelt. Im Grunde genommen ein Abschied
fürs Leben. Wie geht's weiter? Wird der Euro (der bessere Voraussetzungen antrifft als
die D-Mark) sein Niveau halten können? Hoffen wir das Beste.
Anhang
Währungsreform (Währungsgesetz) (Ausschnitt)
Erster Abschnitt
Währungsumstellung
§ 1
1. Mit Wirkung vom 21. Juni 1948 gilt die Deutsche-Mark-Währung. Ihre
Rechnungseinheit bildet die Deutsche Mark, die in hundert deutsche Pfennige eingeteilt
ist.
2. Alleinige gesetzliche Zahlungsmittel sind vom 21. Juni 1948 an:
1. die auf Deutsche Mark oder Pfennig lautenden Noten und Münzen, die von der Bank
deutscher Länder ausgegeben werden.
2. Folgende Noten und Münzen zu einem Zehntel ihres bisherigen Nennwertes:
a) in Deutschland in Umlauf gesetzte Marknoten der Alliierten Militärbehörde zu 1 und
½ Mark,
b) Rentenbankscheine zu 1 Rentenmark,
c) Münzen zu 50, 10, 5 und 1 Reichs- oder Rentenpfennig.
3. Vorbehaltlich früheren Aufrufes verlieren die in Abs. 2 Ziffer 2
bezeichneten Militärmarknoten und Rentenbankscheine mit Ablauf des 31. August 1948
ihre gesetzliche Zahlkraft.
§ 2
Sind in Gesetzen, Verordnungen, Verwaltungsakten oder rechtsgeschäftlichen
Erklärungen die Rechnungseinheiten Reichsmark, Goldmark oder Rentenmark verwendet worden,
so tritt, vorbehaltlich besonderer Vorschriften für bestimmte Fälle, an die Stelle
dieser Rechnungseinheiten die Rechnungseinheit Deutsche Mark.
§ 4
Für alle Reichsmarkverpflichtungen wird ein Moratorium gewährt. Das Moratorium endet
mit dem Ablauf des 26. Juni 1948.
Zweiter Abschnitt
Kopfbetrag
§ 6
Jeder Einwohner des Währungsgebiets erhält im Umtausch gegen Altgeldnoten (§ 9
Abs. 1 Ziff. 1) desselben Nennbetrags bis zu sechzig Deutsche Mark in bar
(Kopfbetrag). Ein Teil des Kopfbetrags in Höhe von nicht mehr als vierzig Deutsche Mark
wird sofort ausgezahlt, der Rest innerhalb von zwei Monaten. Für den Fall, daß dem
Berechtigten bei dem späteren Umtausch von Altgeld ein Anspruch auf Beträge in Deutscher
Mark zusteht, bleibt die Anrechnung des Kopfbetrags hierauf vorbehalten.
§ 7
Die Kopfbeträge werden ausgezahlt von den Stellen, die für die Ausgabe der
Lebensmittelkarten der Berechtigten zuständig sind. Der Kopfbetrag kann für andere
Personen unter denselben Voraussetzungen erhoben werden, unter denen es zulässig ist, die
Lebensmittelkarten für andere Personen in Empfang zu nehmen.
Dritter Abschnitt
Ablieferung und Anmeldung von Altgeld
§ 8
Über Altgeld darf vom 21. Juni 1948 an nur noch verfügt werden, soweit dieses Gesetz
oder weitere Gesetze oder Durchführungsverordnungen es ausdrücklich zulassen.
§ 9
1. Altgeld im Sinne dieses Gesetzes sind:
I. folgende Noten, soweit sie beim Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht außer Kurs
gesetzt worden sind (Altgeldnoten);
a) auf Reichsmark lautende Reichsmarknoten,
b) auf Rentenmark lautende Rentenbankscheine, mit Ausnahme der Rentenbankscheine zu 1
Rentenmark,
c) in Deutschland in Umlauf gesetzte Marknoten der Alliierten Militärbehörde, mit
Ausnahme der Noten zu 1 Mark und zu ½ Mark,
II. im Währungsgebiet bei Geldinstituten unterhaltene Reichsmarkguthaben, gleichviel,
ob die Guthaben bereits fällig sind, oder ob sie später fällig werden oder durch
Kündigung fällig gemacht werden können (Altgeldguthaben).
2. Geldinstitute im Sinne dieses Gesetzes sind die Banken, Bankgeschäfte, Sparkassen
(mit Ausnahme der Bausparkassen), Kreditgenossenschaften, Girozentralen,
Genossenschaftszentralen, ferner die Bank deutscher Länder, die Landeszentralbanken, die
Postscheckämter, die Postsparkasse, sowie alle sonstigen Kreditanstalten des
öffentlichen Rechts.
Marshall-Plan
Der Marshall-Plan oder auch Europäisches Wiederaufbauprogramm (englisch European
Recovery Program, ERP) benannt nach dem Außenminister der USA George Catlett Marshall,
finanzielles Hilfsprogramm zum Wiederaufbau der europäischen Länder nach dem
2. Weltkrieg.
Nach dem Krieg waren Landwirtschaft, Industrie und Rohstoffgewinnung in weiten Teilen
Europas fast ganz zum Erliegen gekommen, und ein großer Teil der Bevölkerung war vom
Hunger bedroht. Europa verfügte über keine Devisen mehr, mit denen im nichteuropäischen
Ausland, vor allem in den USA, Rohstoffe, Werkzeuge und Maschinen zum Wiederaufbau der
schwer angeschlagenen Wirtschaft und Nahrungsmittel für die Not leidende Bevölkerung
hätten gekauft werden können. Mit ihrem Hilfsprogramm verfolgten die USA vier Ziele:
Erstens war Europa potentiell ein großer Absatzmarkt für amerikanische Waren. Durch den
Wegfall der Kriegsgüterproduktion nach 1945 drohte der Wirtschaft in den USA ein massiver
Einbruch, der sowohl durch Lieferungen und Leistungen im Rahmen eines
Wiederaufbauprogramms als auch durch eine rasche wirtschaftliche Gesundung des
Absatzmarktes Europa umgangen werden sollte. Zweitens bestand aus Sicht der USA die
Gefahr, dass Westeuropa ohne amerikanische Hilfe in den Einflussbereich der Sowjetunion
geraten könnte, was die USA als Bedrohung für die amerikanischen Sicherheitsinteressen
betrachteten und durch den Marshallplan zu verhindern suchten. Drittens musste
Deutschland, historisch der industrielle Mittelpunkt Europas, als Puffer gegen die
sowjetische Expansionspolitik wieder aufgebaut werden und in ein gegen die Sowjetunion und
ihren Einflussbereich geeintes Europa integriert werden. Und viertens mussten Hunger und
Not überwunden werden, und zwar nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch als
Vorbedingung für die Verwirklichung der drei vorgenannten Ziele.
Am 5. Juni 1947 stellte Marshall in einer Rede das Europäische
Wiederaufbauprogramm der Öffentlichkeit vor. Laut dem Programm erklärten sich die USA
bereit, die notwendige finanzielle und materielle Unterstützung zu leisten, sofern Europa
ein gemeinsames, langfristiges Wiederaufbauprogramm erstellte. Großbritannien und
Frankreich luden alle europäischen Staaten einschließlich der Sowjetunion zu einer
Konferenz in Paris (Juli bis September 1947) ein. Die Sowjetunion lehnte die Teilnahme an
dem Programm, das sie als "Instrument des Dollarimperialismus" interpretierte,
ab, und in ihrer Gefolgschaft zogen auch Polen und die Tschechoslowakei ihre bereits
gegebenen Zusagen wieder zurück.
Am 3. April 1948 verabschiedete der US-Kongress das Programm als
Auslandshilfegesetz, und bis Mitte 1952 genehmigte er insgesamt über 13 Milliarden
US-Dollar an Hilfe. 70 Prozent davon gaben die Europäer für den Kauf von Gütern in
den USA aus. Die größten Beträge gingen an Großbritannien, Frankreich, Italien und
Westdeutschland – in dieser Reihenfolge. Als im Rahmen des Kalten Krieges ab 1949 die
Spannungen zwischen West und Ost immer stärker wurden, flossen mehr und mehr Mittel in
Militärausgaben statt in den Aufbau der Wirtschaft.
Das Programm erreichte sowohl seine kurzfristigen als auch seine langfristigen Ziele:
Als die Hilfe 1952 endete, war die Gefahr einer Einflussnahme der UdSSR auf Westeuropa
abgewendet, die Industrieproduktion lag 35 Prozent über dem Vorkriegsstand, und die
Bundesrepublik Deutschland war ein eigenständiger Staat mit einer Wirtschaft, die sich
schnell erholte.
Kurzbiographie von Ludwig Erhard
Erhard, Ludwig (1897-1977), deutscher Politiker und Wirtschaftswissenschaftler, galt
als "Vater des deutschen Wirtschaftswunders". Erhard wurde am 4. Februar 1897 in
Fürth geboren. Er studierte an der Universität Frankfurt. Von 1928 bis 1944 war er als
Wirtschaftswissenschaftler an der Handelshochschule in Nürnberg tätig. 1945 beriet er
die amerikanische Besatzungsmacht in wirtschaftspolitischen Fragen und wurde noch im
gleichen Jahr Minister für Handel und Gewerbe in Bayern. Als Direktor für Wirtschaft des
Vereinigten Wirtschaftsgebiets bereitete er die Währungsreform von 1948 mit vor. Bereits
1949 zog Erhard für die CDU in den Bundestag ein, dem er bis 1976 angehörte. Von 1949
bis 1963 war er Bundeswirtschaftsminister. In diesem Amt, das er 14 Jahre lang
ausübte, bestimmte Erhard wesentlich die Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik
Deutschland und gilt als Hauptverantwortlicher für das so genannte Wirtschaftswunder.
Erhard war ein Verfechter der Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, die für den
sozialen Frieden in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit von entscheidender Bedeutung
waren.
1957 wurde Erhard Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und trat 1963 die
Nachfolge Konrad Adenauers als Bundeskanzler an. Dank seines Ansehens bei der Bevölkerung
konnte die CDU/CSU/FDP-Regierung unter Erhard 1965 erneut die Bundestagswahlen gewinnen.
Im folgenden Jahr wuchs die innerparteiliche Kritik an Erhard, es kam zu
Meinungsverschiedenheiten mit der FDP über den Bundeshaushalt, und Erhard sah sich
schließlich gezwungen, von seinem Amt zurückzutreten. 1966/67 war Erhard Vorsitzender
der CDU, anschließend Ehrenvorsitzender der Partei. Erhard starb am 5. Mai 1977 in
Bonn.
Erhard veröffentlichte Wohlstand für alle (1957) und Deutsche Wirtschaftspolitik
(1962).
Maastrichter Vertag
Maastricht, offiziell Vertrag über die Europäische Union, kurz EU-Vertrag,
populäre Bezeichnung für das von den Staats- und Regierungschefs der zwölf
Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft im Dezember 1991 ausgehandelte und am
7. Februar 1992 von den Außen- und Finanzministern der zwölf Staaten in der
niederländischen Stadt Maastricht unterzeichnete Vertragswerk, mit dem die
Voraussetzungen für die Erweiterung der Europäischen Gemeinschaften zur Europäischen
Union geschaffen wurden, d. h. zur Verwirklichung einer Wirtschafts- und
Währungsunion der Mitgliedsstaaten, flankiert von einem Ausbau der politischen
Integration in den Bereichen Außen- und Sicherheitspolitik, Sozial- und
Wirtschaftspolitik sowie Innen- und Rechtspolitik. Der Vertrag trat am 1. November
1993 in Kraft, nachdem er von allen Mitgliedsstaaten ratifiziert worden war (Dänemark
entschied sich im Juni 1992 in einem Referendum zunächst gegen den Vertrag; nachdem
Dänemark einige Ausnahmeregelungen zugestanden wurden, stimmte die Bevölkerung im Mai
1993 für den Vertrag).
Wichtigster Punkt des Vertrags von Maastricht ist die Schaffung der Europäischen
Währungsunion und damit verbunden die Einführung einer gemeinsamen Währung, des Euro,
und die Gründung einer Europäischen Zentralbank. Hinsichtlich des organisatorischen
Rahmens der Europäischen Union bedeutet der Vertrag eine starke Erweiterung gegenüber
den Römischen Verträgen. Die Ratifizierung des Vertrags führte zu zahlreichen
Diskussionen innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten. Insbesondere Dänemark und Großbritannien
äußerten 1992 starke Bedenken, die nationale Kontrolle über ihre Geldpolitik
aufzugeben. Auch wurde eine mögliche Vormachtstellung des wiedervereinigten Deutschlands
von einigen Staaten kritisch betrachtet.
© by Christoph Banik
banik@datacomm.ch
Last update: 26. Dezember 1999
|