4 Verstehen und Verstehensschwierigkeiten
4.1 Verstehen
4.1.0 Umriss
Von aussen betrachtet können wir an einem Gespräch nur anhand von Anzeichen prüfen, ob die Beteiligten verstanden haben. Ein mögliches Kriterium ist hierbei, ob jemand eine Anweisung ausführen kann, oder ob jemand einen Text sinnvoll fortzusetzen vermag (nach Schäflein-Armbruster 1994: 502). Ein kleines Beispiel eines so verstandenen Austausches ist folgende Frage von Arben an Burhanuddin und dessen Antwort zu Beginn ihres Gesprächs:
Beispiel 1 Arben (Kosovo-Albaner) und Burhanuddin
(Afghane) ![]()
| 1 | Ar | nun=also=woher KOmmst du? |
| 2 | Bu | äh ich=ich komme aus afghanistan. |
In diesem Beispiel erfüllt Burhanuddin beide oben genannte Kriterien: Er gibt eine Antwort auf eine Frage und führt mit seinem Beitrag das Gespräch sinnvoll fort.
Dieses einfache Beispiel wirft aber auch Fragen auf. Zum einen besteht die Schwierigkeit, ob nicht vielmehr die hohe Erwartbarkeit im Kontext für das Verstehen verantwortlich ist. Ein weiteres und eher erkenntnistheoretisches Problem ist die Tatsache, dass das Verstehen zwischen Turn 1 und Turn 2 stattfindet und so nicht direkt beobachtbar ist. Die Lautfolgen von Arbens Frage und Burhanuddins Antwort sind dem Verstehen vor- resp. nachgestellt. Was von aussen beobachtbar ist, kann also lediglich auf Verstehen hinweisen.
Während ‚Verstehen‘ einen Prozess bezeichnet, fokussiert der Begriff ‚Verständnis‘ eher das Resultat des Prozesses. Da die Mechanismen, die hier beschrieben werden, alle der Konstruktion von Verstehen gelten, werde ich mich in dieser Arbeit auf ‚Verstehen‘ beschränken. Zudem wird dadurch die konnotative Färbung von ‚Verständnis‘ ausgeklammert, die sich aus dem Ausdruck ‚Verständnis haben für jemand‘ ergibt. Analog zu ‚Verstehen‘ wird im folgenden auch von ‚Nicht-Verstehen‘ oder ‚Missverstehen‘ die Rede sein und nicht von ‚Nichtverständnis‘ oder ‚Missverständnis‘.
Die folgenden Abschnitte 4.1.1 und 4.1.2 dienen dazu, den Begriff ‚Verstehen‘ soweit zu umschreiben, dass damit eine sinnvolle Bestimmung der im Korpus auftretenden Verstehensschwierigkeiten möglich ist.
4.1.1 Sprechakttheoretische Definition und Erweiterung
Da ‚Definition‘ ursprünglich ‚Begrenzung‘ heisst, möchte ich das weite Feld der umgangssprachlichen Formulierung zuerst einengen und damit konkretisieren, um es später auszuweiten und der Fragestellung genauer anzupassen.
Nach der klassischen sprechhandlungstheoretischen Sichtweise von Searle heisst ‚Verstehen‘ das Erkennen der Bedeutung eines Sprechaktes, der einem gegenüber gebraucht wird (Searle 1969: 76). Verstehen ist aus Sicht der Hörerin eng mit dem Erkennen der Absichten des Sprechers verknüpft. (ebd.: 48). Dieses Sich-gewahr-werden der Bedeutung ist laut Searle für die Hörerin möglich, weil der Sprecher gewisse Regeln beachtet. Da diese Regeln beiden GesprächspartnerInnen zugänglich sind, bilden sie einen Teil des gemeinsamen (unterstellten) Wissens. Eine dieser Regeln ist ein gemeinsamer sprachlicher Kode oder die konventionelle Regelung, welche Umstände erfüllt sein müssen, damit ein bestimmter Sprechakt möglich und gültig wird. Damit zum Beispiel eine Aufforderung als solche wahrgenommen werden kann, muss sie eine zukünftige Handlung der Hörerin beschreiben, die diese auch in der Lage ist zu tun, etc. (ebd.:100).
Neuere Ansätze in der sprechhandlungstheoretischen Verständlichkeitsforschung gehen allerdings von einem weiteren Spektrum aus, das nicht nur die sprachliche Handlung und ihre innere Struktur, sondern auch die verschiedenen Arten von Zusammenhängen sprachlicher Handlungen umfasst. Schäflein-Armbruster fasst dies unter dem Slogan zusammen, dass "Verstehen heisst, die Zusammenhänge zu sehen" (1994: 497). So entwickelt er auf der Grundlage der Dialogtheorie von Fritz (1994) eine Darstellung der verschiedenen Bereiche, die für das Verstehen der Hörerin relevant sind und führt aus, welche Art Zusammenhänge im Slogan gemeint sind. Es fehlen allerdings Hinweise auf den soziokulturellen Aspekt der Kommunikation, der oft – und nicht nur zwischen Leuten aus verschiedenen Kulturen – zu Verstehensproblemen führt (s.a. Gass / Varonis 1991: 131).
Im Kapitel zur "inneren Struktur von Handlungen" lehnt sich Schäflein-Armbruster an den Ansatz von Searle an, der eine Einteilung der sprachlichen Handlung in Illokution und Proposition vornimmt, wobei letztere wiederum in Referenz und Prädikation unterschieden wird. Verstehensprobleme treten beispielsweise bei der Referenz auf, weil die Hörerin dabei weitreichende Annahmen über das Wissen des Dialogpartners machen muss.
Aus zwei Gründen ist allerdings der sprechhandlungstheoretische Ansatz zu ‚Verstehen‘ unvollständig:
Erstens – wie schon bei der Sprechakttheorie von Searle selbst – bleibt die gemeinsame Gesprächskonstruktion der interagierenden GesprächspartnerInnen im Hintergrund. Somit wird die Rolle und der Anteil der Hörerin zulasten des Sprechers (fast) völlig ausgeblendet. Wie die Analyse der Dialoge, bei denen Verstehensprobleme auftauchen, zeigen wird, ist aber die sequentielle Komponente sehr wichtig. Das heisst nichts anderes, als dass jeder Beitrag in einer Konversation vom Verhalten des jeweiligen Gesprächspartners abhängig ist. Dies scheint selbstverständlich, wird aber oft ausgeblendet, wie Schegloff in einem Aufsatz zum Einfluss von A-ha, Nicken u.ä. auf das Gegenüber zeigt (Schegloff 1981). Er kritisiert zu Beginn des Aufsatzes, dass die Auffassung von Diskurs als Monolog weit verbreitet ist. Hingegen gewähre die Sichtweise der Konversationsanalyse, dass dem Austauschcharakter einer Konversation die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt werde:
Der zweite kritische Aspekt am sprechhandlungstheoretischen Ansatz betrifft die sogenannte ‚kommunikative Kompetenz‘ (Hymes 1972), die Varonis / Gass – wie oben erwähnt – den soziokulturellen Teil nennen. Die kommunikative Kompetenz ist die Fähigkeit, in einer Situation angemessen auf die sprachlichen und kulturellen Komponenten reagieren zu können. Nach Hymes ist die Liste dieser Komponenten des Sprechens ziemlich lang und umfasst u.a. die äusseren Umstände wie Zeit und Ort, die psychologischen Definitionen der Situation, die Berücksichtigung aller TeilnehmerInnen und die Gesprächsnormen (z.B. wann unterbrochen werden darf) ebenso wie die Wahl des "Instruments": also welche Sprache, welcher Dialekt oder welche Varietät gesprochen wird. Diese Erweiterung der Sichtweise ist wichtig, wenn man sich mit Verstehensproblemen beschäftigt, da alle diese Komponenten das Verhalten der Gesprächspartner beeinflussen. Wenn eine Chinesin als Reaktion auf eine persönliche Frage schweigt, muss das nicht mit fehlendem Verständnis der Frage zusammenhängen. Es ist durchaus möglich, dass es ihr auf Grund ihres kulturellen Hintergrunds unter den vorliegenden Umständen peinlich ist, darüber zu sprechen. (s. Günthner 1993: 51).
"The conversation analytic angle of inquiry does not let go of the fact that speech-exchange systems are involved, in which more than one participant is present and relevant to the talk, even when only one does any talking." (1981:72)
Dass die Kritik Schegloffs heute noch aktuell ist, belegt die etwas einseitige Sicht der Zusammenstellung von Schäflein-Armbruster.
Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass ‚Verstehen‘ von verschiedenen Parametern auch aussersprachlicher Natur abhängt. Das gemeinsame Wissen als Grundlage von ‚Verstehen‘ ist z.T. vorgegeben, wird zum anderen Teil aber erst im Gespräch selbst konstruiert. Dabei sind in der Analyse alle an einer Konversation Beteiligten zu berücksichtigen. ‚Verstehen‘ ist zudem nicht der einzige relevante Aspekt in einem Gespräch.
4.1.2 Verstehen, Nichtverstehen und Missverstehen.
Die drei Begriffe lassen sich schwerlich fassen, ohne dass sie in Zusammenhang zueinander gebracht werden. So muss man sich – nach Rost-Roth – Verstehen und Nichtverstehen als ideelle Endpunkte eines Kontinuums denken, das viele Zwischenstadien aufweist (1994: 36).
Sowohl Rost-Roth (1994:37) wie auch Falkner (1997) stimmen überein,
"dass es hundertprozentige Übereinstimmung von Gemeintem und Verstandenem zwischen zwei KommunikationspartnerInnen nicht gibt." (Falkner 1997: 2; im Original fett)
Angesichts dieser Unsicherheiten sind empirische Untersuchungen sehr wertvoll, da sie anzeigen, wieweit die SprecherInnen in einer Konversation tatsächlich problematische Stellen akzeptieren und tolerieren und wo sie mit einer Reparatur eingreifen.
Genauso lässt sich allerdings auch fragen, ob es umgekehrt ein absolutes Nichtverstehen geben kann. Ich denke, dass das selten der Fall ist, wenn zwei Personen die gegenseitige Aufmerksamkeit haben und bemerken, dass ein Kommunikationsversuch stattfindet. Der Sprecher wird immer etwas mitteilen wollen (was er meint) und die Hörerin wird immer etwas zu verstehen versuchen (was sie in dieser Situation erwartet oder erwarten kann). Damit meine ich nicht, dass man sich immer versteht, sondern dass ein vollständiges Nichtverstehen eher einer Vermeidung von Kommunikation, d.h. einem non-engagement im Sinne von Gass / Varonis (1991: 123) entspricht. Ohne weiter auf die Frage einzugehen, verzichte ich jedoch auf Grund dieser terminologischen Unsicherheit auf eine Unterscheidung zwischen ‚teilweisem‘ und ‚vollständigem‘ Nichtverstehen, wie sie z.B. Gass / Varonis (1991) vornehmen.
Die HörerInnen reagieren auf Verstehensschwierigkeiten in einem Gespräch entweder mit einer offenen Reparatur, durch Vortäuschen von Normalität oder brechen das Gespräch ab. All diese drei Typen von Verhalten können Signale sein, dass Verstehensschwierigkeiten bestehen. Als grobe Bestimmung von ‚Verstehen‘ möchte ich daher für diese Untersuchung ‚reibungslose Kommunikation‘ vorschlagen. Da die direkte Bestimmung von Verstehen oder Nichtverstehen der Analyse nicht zugänglich ist, ist man in der Analyse auf die Anzeichen von Verstehen oder Nichtverstehen angewiesen (s. nächstes Kapitel). Schlagwortartig lautet aber meine Definition folgendermassen: ‚Verstehen‘ ist die Abwesenheit von Anzeichen, dass nicht alles störungsfrei läuft. Auch dies ist nicht ganz richtig, wie Falkner in seiner Studie zu Missverständnissen am Schluss bemerkt: Viele unaufgeklärte Missverständnisse gehen so als Verstehen durch, wenn sie nicht durch eine Analyse aufgedeckt werden (1997: 178).
Missverstehen steht zu Verstehen in einem ähnlichen Verhältnis wie Nichtverstehen: Auch hier kann man sich eine Skala von Zwischentönen denken, die zwischen den beiden Begriffen die Brücke schlägt. Von Missverstehen ist laut Falkner dann die Rede, wenn das von dem Sprecher Gemeinte nicht mit dem von der Hörerin Verstandenen übereinstimmt (1997: 1). Missverstehen wird zum Missverständnis, wenn sich diese Tatsache im Lauf des Gesprächs herausstellt. Es ist aber ein methodisch unsicherer Punkt, in einem Gespräch ‚Missverstehen‘ zu diagnostizieren wenn es keine äusseren Anzeichen gibt. Der Hinweis auf ein Missverstehen obliegt naturgemäss dem Sprecher, der es tolerieren oder zu reparieren versuchen kann. Da das Gewicht dieser Studie aber eher auf dem Umgang der Hörerin mit Nicht-Verstehen liegt, nimmt die Untersuchung von Missverstehen hier einen untergeordneten Rang ein.
4.2 Verstehensschwierigkeiten
4.2.0 Die Untersuchung von Verstehensschwierigkeiten versus die Untersuchung von gelungener Verständigung
In der theoretischen Einleitung zu seiner Studie fordert Hinnenkamp die gleichberechtigte Behandlung in der Forschung von funktionierender und nicht-funktionierender Kommunikation:
[Eine Theorie der interkulturellen Kommunikation muss] "das Funktionieren bzw. die Bedingungen des Funktionierens der Kommunikation genauso untersuchen wie das Nicht-Funktionieren bzw. die Bedingungen des Nicht-Funktionierens." (1989: 55)
Die Bedingungen und das Funktionieren der erfolgreichen Verständigung sind genauso untersuchenswert und interessant wie die Bedingungen und das Funktionieren der Verständigungsprobleme, wie es Hinnenkamp fordert. Hinter seinem Ansinnen steht die Beobachtung, dass in der Forschung – vor allem in der Untersuchung interkultureller Kommunikation – der Fokus auf den Verstehensproblemen liegt. Der Hauptgrund dafür ist u.a. die Tatsache, dass Verstehensprobleme deutlichere Konsequenzen auf ein Gespräch haben und somit klarer erkennbar sind. Gelungene Verständigung bleibt dagegen im Wesentlichen unmarkiert und nimmt in meinem Korpus in allen Gesprächen zwischen nicht-muttersprachlichen DeutschsprecherInnen den Grossteil des Raumes ein.
Die Begründung für die einseitige Bevorzugung der Untersuchung von schwieriger Verständigung liegt nicht nur in der besseren Verfügbarkeit von aussagekräftigen Stellen, sondern in der oft stillschweigenden Annahme, dass Verstehen und Nichtverstehen untrennbar miteinander verhängt sind, wie Rost-Roth anmerkt: "Aussagen über das Nicht-Funktionieren von Kommunikation implizieren ja immer auch Aussagen über Bedingungen funktionierender Kommunikation" (1994: 37). Dies ist im Prinzip richtig, dennoch stimme ich mit der impliziten Aussage im obengenannten Zitat von Hinnenkamp überein, dass das eine nicht die blosse Umkehrung des anderen ist. Die Untersuchung von Gesprächen zwischen Nicht-MuttersprachlerInnen bietet daher Gelegenheit, beide Seiten zu beleuchten: den Umgang der HörerInnen mit Verstehensproblemen (Kap. 6) und die Anstrengungen, die die SprecherInnen unternehmen, um das Verständnis daraufhin wieder herzustellen (Kap. 7).
Durch die enge Verflochtenheit der gegenseitigen Annahmen und die gegenseitige Abhängigkeit der Gesprächsbeiträge in einer Konversation treten Verstehensprobleme relativ häufig an die Oberfläche, wo sie sich im direkten Nachfragen oder in einer inkongruenten Fortsetzung äussern. Für die Analyse lässt sich deshalb vom Rauch auf ein Feuer schliessen, womit sich in Umkehrung der Definition von ‚Verstehen‘ in 4.1.2 sagen lässt: Verstehensschwierigkeiten sind erkennbar durch die Anwesenheit von Anzeichen, dass nicht alles rund läuft. Worin genau diese Anzeichen bestehen, ist das Thema des Kapitels 6.
4.2.1 Ursachen von Verstehensschwierigkeiten
Die Klassifizierung und Beschreibung der vielen Ebenen des Verstehens, die im vorhergehenden Abschnitt erfolgt ist, dient vielen AutorInnen der Illustration der Vielschichtigkeit des Prozesses. Dieser Vielschichtigkeit des Verstehens entspricht es, dass Verstehensschwierigkeiten grundsätzlich auf jeder Ebene auftreten können. Die Verwobenheit der Ebenen unter sich (Sprechakte, Lexikon, Grammatik, kommunikative Kompetenz, etc.) erschwert zusätzlich die Aufgabe, eine bestimmte Ebene als ‚problematisch‘ zu isolieren. Bremer et. al. betrachten daher Verstehensprobleme als grundsätzlich "multi-causal" (1993: 159). Die verschiedenen Ebenen folgen nicht aufeinander ab sondern laufen parallel nebeinander. Es besteht also das Problem, die Ebenen sozusagen voneinander abzutrennen und durch eine Gewichtung der Ebenen eine Konstellation von Faktoren auszumachen. Die Identifikation solcher Konstellationen ist ein Desideratum, das bisher nicht erfüllt werden konnte. Bremer stellt denn auch fest, dass bei Nicht-MuttersprachlerInnen anfänglich verhältnismässig "globale" Verstehensprobleme vorliegen, wie an der Hypothesenbildung der HörerInnen sichtbar werde (1996: 42).
Folgendes Beispiel soll verdeutlichen, wie schwierig es ist, bei einem Beispiel eine spezifische Ursache zu identifizieren.
Beispiel 2 Florim (Kosovo-Albaner)
und Suda (Tamilin) ![]()
| 1 | Fl | (-) also: wo haben sie: (-) DEUTSCH gelernt; |
| 2 | Su | ä::h s hh (-) wie bitte? |
| 3 | Fl | wo ha ((räuspern)) haben sie die: DEUTSCH gelernt, sprache, |
| 4 | Su | ä:h ik=mh sechs monat äh ä:hm bei kurs, (.) lernen, |
| 5 | Fl | m=h, |
Dank der Nachfrage von Suda und der darauf folgenden Wiederholung von Florim lässt sich erkennen, dass ein Verstehensproblem vorliegt. Das Beispiel 2 lässt aber sonst keine weitergehenden Rückschlüsse auf die genaue Ursache der Schwierigkeit zu: Suda spezifiziert ihr Problem nicht näher und Florims Wiederholung seiner Frage in Turn 3 ist nahezu identisch mit seiner ursprünglichen Äusserung. Nach Florims Wiederholung und der Paraphrasierung von ‚Deutsch‘ als ‚Sprache‘ scheint das Problem gelöst. Es ist jedoch höchst unwahrscheinlich, dass selbst eine schwache Deutschlernerin wie Suda den Zusammenhang zwischen ‚Deutsch‘ und ‚Sprache‘ nicht kennt. Die wirkliche Ursache tritt daher nicht an die Oberfläche.
An einigen Stellen im Korpus besteht der Redebeitrag der Hörerin in einer Nachfrage nach Zusatzinformation. Auch wenn die Hörerin eine Hypothese zu einem Problem hat, muss das nicht heissen, dass sie damit den ‚wahren‘ Grund für die Verstehensschwierigkeit kennt. Aus diesen Gründen spielt die Ursache der Verstehensprobleme in der vorliegenden Arbeit nur eine marginale Rolle.
4.2.2 Verstehensschwierigkeiten in der interkulturellen Kommunikation
Ein verhältnismässig grosser Teil der Forschung zum Thema interkulturelle Kommunikation untersucht spezifisch die Problematik der kulturellen Unterschiede im Sprachgebrauch. Damit sind Verstehensschwierigkeiten gemeint, die nicht (oder nicht nur) auf Schwächen in der Sprachkompetenz zurückgehen, sondern die das Feld der in der jeweiligen Sprechgemeinschaft geregelten Sprachverwendung betreffen. So notiert Rost-Roth:
"Kennzeichnend für Untersuchungen aus dem Bereich der linguistischen Pragmatik ist, dass Verständigungsprobleme vorrangig auf kulturspezifische Wissensstrukturen zurückgeführt werden, die zu unterschiedlichen Erwartungen in Bezug auf die zu realisierenden Handlungsmuster in den jeweiligen Institutionen führen. Der Sprache selbst und in diesem Falle der jeweiligen deutschsprachigen Kompetenz, wird dabei weniger Bedeutung zugeschrieben." (1994: 28)
Der Forschung liegt meist die Annahme zugrunde, dass Verständigungsprobleme häufig da auftreten, wo die Interagierenden einander mittels Kontextualisierungshinweisen auf den der Situation zugrundeliegenden activity type hinweisen. Beispiele zeigen, dass in interkulturellen Kontaktsituationen solche Hinweise oft verloren gehen, da sie nicht immer explizit ausgedrückt werden. Als Beispiel mag hier ein Ausschnitt aus dem Post-Interview dienen, das ich mit den GesprächsteilnehmerInnen führte und ebenfalls auf Minidisc aufnahm:
Beispiel 3 Burhanuddin (Afghane) und J.M. ![]()
|
1 |
JM | wieviele monate bist du in der schweiz; |
|
2 |
Bu | ähm zwei jahre. |
|
3 |
JM | (---) äm welche sprachen sprichst du; |
|
4 |
Bu | ä:=afghanisch. |
|
5 |
JM | <<aufzählende Intonation> afGHAnisch?> |
|
6 |
Bu | =ja. (6.0) |
|
7 |
JM | m: alle sprachen die du sprichst. |
|
8 |
Bu | (--) AHA. m: |
|
9 |
JM | englisch russisch |
|
10 |
Bu | m: persisch- |
In der Annahme, dass Afghanisch nicht die einzige Sprache sei, die er spreche, wollte ich in Turn 5 mit der hoch ansteigenden Intonation anzeigen, dass ich ‚Afghanisch‘ nur als ersten Punkt in einer Liste von Aufzählungen betrachtete. Die eigentliche Botschaft bestand nur in dem Hinweis auf ‚unfertige Aufzählung‘, den Burhanuddin als einfaches Hörersignal nahm. Nach der für ein Gespräch langen Pause von 6 Sekunden wurde mir klar, dass wir uns missverstanden hatten und verbalisierte meine Aufforderung deutlicher. Gleichzeitig zeigt dieses Beispiel, dass verschiedene verdeckte Annahmen über das Schema einer Interviewsituation vorliegen. Ich erwartete von Burhanuddin eine komplette Auskunft über all seine Sprachkenntnisse, während Burhanuddin mit der Erwähnung einer Sprache die Frage beantwortet sah.
Das gegenseitige Aufzeigen, ob man (gerade) miteinander redet, wer (gerade) mit wem spricht, was man (gerade) tut, worüber man (gerade) miteinander spricht, sowie wie man zueinander steht, ist andauernd präsent (s. Auer 1986: 27). Diese Kontextualisierung beinhaltet Intonation – wie das Beispiel oben – , die Verwendung von fixen sprachlichen Formeln, (Gumperz 1982: 173-175) und Ähnliches. Eine Beschränkung auf den paraverbalen Teil wäre aber nach Auer (1986: 25) verkehrt. Als Kontextualisierungshinweis kann auch z.B. ein Lexem ‚Libero‘ auf das Schema ‚Fussball‘ verweisen, ebenso wie alle Formen der Sprachverwendung Kontextualisierungsfunktionen übernehmen können.
Gerade hier besteht ein wesentlicher Nachteil des Korpus darin, dass so viele verschiedene Nationalitäten an den Aufnahmen teilnahmen. Da die Kulturabhängigkeit solcher Kontextualisierungshinweise hinlänglich erwiesen ist, müssen für die Analyse die Gesprächsnormen der Teilnehmenden so weit wie möglich bekannt sein. Brinker / Sager verlangen denn auch:
"Analysiere nur die Gespräche, die du auf der Grundlage deines Alltagswissens (deiner alltagssprachlichen Kompetenz) auch selber zu führen in der Lage bist." (1996: 120)
Die Vielfalt der Muttersprachen und kulturellen Hintergründe erschwert hier aber das Aufzeigen der Normen und ihres kulturellen Kontextes sowie die Aufdeckung ihrer Anwendung und Konstruktion in der Konversation, da die Beherrschung aller zugrundeliegenden Sprachen und Gesprächsnormen den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
4.3 Muster der Problembehandlung
4.3.0 Beispiel einer Problembehandlung
Da Verstehen grundsätzlich interaktiv hergestellt wird, ist auch die Behandlung von Verstehensproblemen die Angelegenheit beider GesprächspartnerInnen. Normalerweise folgt einem Nichtverstehen ein Austausch zwischen beiden GesprächspartnerInnen, der den unterbrochenenen Gesprächsfluss wieder herstellt. Dass dies jedoch nur ein Idealbild ist, das nicht immer gleich auszusehen braucht, wird am Beispiel der Abbrüche im Korpus klar. Beim vorliegenden Korpus muss allerdings immer berücksichtigt werden, dass die Aufnahmen in einer eigentlichen Laborsituation stattfanden und die Anwesenden daher nicht eine unabhängige Motivation für das Gespräch hatten.
Das Gewicht liegt ausdrücklich bei ‚Behandlung‘, da für die Hörerin bei Nichtverstehen auch Wege offenstehen, die eine Klärung, d.h. weiterführende Behandlung des Problems, ausschliessen oder zumindest erschweren (s. Kap. 6.2). Entschliesst sie sich für Ignorieren oder Abbrechen, nimmt die Problembehandlung von jenem Moment an einen anderen Verlauf. Ist umgekehrt die Signalisierung des Nichtverstehens deutlich genug, liegt der Ball wieder beim Sprecher, der nun für eine Reformulierung oder Wiederholung seiner Äusserung zuständig ist. Darauf wiederum nimmt die Hörerin den Ball auf und zeigt damit, dass die Unterhaltung weitergehen kann, wenn nicht ein weiterer Zyklus der Verstehensnegotiation daran anschliesst. Dieses Kapitel konzentriert sich vorerst nur auf die interaktive Behandlung von Verstehensschwierigkeiten, wie sie in der obigen Beschreibung eines ‚Ballwechsels‘ illustriert wurde. Diese interaktive Behandlung ist die Grundlage für die meisten Modelle in der Literatur. Die anderen Möglichkeiten wie etwa ein abrupter Themawechsel werden speziell im Kapitel 6.2 behandelt. Die Beziehungen zwischen dieser Art von Problembehandlung und Reparaturen allgemein werden im Abschnitt 4.3.2 diskutiert.
Beinahe alle Modelle, die diese sequenzielle Organisation berücksichtigen, basieren auf der Unterscheidung zwischen Anzeigen von Nichtverstehen (oder dem Initiieren einer Reparatur) und Ausführen der Reaktion hierauf. Folgendes Beispiel zeigt einen besonders häufigen Typus, der den oben skizzierten ‚klassischen‘ Verlauf nimmt. Shakhawan zeigt ein Verstehensproblem an, worauf Asim seine Frage teilweise reformuliert. Mit der Beantwortung der ursprünglichen Frage reagiert Shakhawan auf Asims Reformulierung und zeigt, dass das Gespräch weitergehen kann.
Beispiel 4 Asim (Montenegro-Albaner) und Shakhawan
(Kurde) ![]()
|
1 |
As | ((...)) nur bleiben gehen so in tast- deutsch lernen ( ) <<all>was machst nach haus?> |
|
2 |
Sha | (---) was machen; |
|
3 |
As | =in freizeit. |
|
4 |
Sha | (--) ja das=e:h s:prechen=und LESEN und so. |
Das spezifische Muster dieses Beispiels wird im Abschnitt 4.3.3 diskutiert.
4.3.1 Einbindung in den Gesprächsverlauf
Häufig wird in der Literatur die Einbindung der Reparatur in den Gesprächsverlauf thematisiert, so von Jefferson (1972), später von Varonis / Gass (1985) und Günthner (1993). Allen gemeinsam ist die Beobachtung, dass die Reparatur sozusagen im Hauptgesprächsstrang ‚eingebettet‘ ist.
Jefferson spricht von ‚side sequence‘ oder von ‚subsidiary sequence‘ (1972: 309). Damit wird deutlich, dass die Nebensequenz eingeklammert wird und nicht denselben Status hat wie der Hauptstrang. Sie zeigt an einem Beispiel, dass die Sprechenden selbst die Klammer markieren. Dass sie sich wieder auf dem Hauptstrang befinden, zeigen die Sprechenden z.B. durch pronominale Referenz an, indem sie in einem Beispiel wieder ‚he‘ statt ‚you‘ verwenden (1972: 320). Gleichzeitig beobachtet sie, dass die Nebensequenzen – einmal abgeschlossen – im Gespräch nie wieder erwähnt werden, während andere Teile aus der Unterhaltung wieder benannt werden können, z.B. mit ‚als Al mit Ken Krach bekam‘.
"Once the side sequence is terminated, i.e. once the on-going sequence is successfully resumed, there is no recurrence of talk with reference to the side sequence. Once terminated, it is done with, once and for all." (1972: 324)
Obwohl die Signalisierung von Nichtverstehen oder die Korrektur von Missverstehen bei Jefferson einen grossen Raum einnimmt, umfasst ihre Untersuchung alle Arten von Nebensequenzen. Varonis / Gass, die sich mit Gesprächen unter Nicht-MuttersprachlerInnen beschäftigten, grenzen ihre Untersuchung auf non-understanding routines ein (1985: 73). Die Nicht-MuttersprachlerInnen wenden diese Reparatur-Nebensequenzen an, um als GesprächspartnerInnen mit ihrem Gegenüber auf dem gleichen Stand zu bleiben (ebd.). Dies gilt m.E. auch für Unterhaltungen unter MuttersprachlerInnen.
Das Modell, das von Varonis / Gass (1985) auf die Organisation der non-understanding routines angewandt wird, stammt aus der Computerliteratur (s. Varonis / Gass 1985, Anm. 6) und vergleicht ein Gespräch mit einem bestimmten Datentyp, dem Stapel. Dabei werden Daten wie bei einem Zeitungsstapel aufeinandergetürmt, wobei immer nur das letzte Element entfernt werden kann. Das Hinzufügen eines Elements wird hierbei als push und das Entfernen eines Elements als pop bezeichnet (Müller 1998: 99). Taucht nun in einem Gespräch eine Reparatur auf, so bewirkt sie einen temporären Stillstand im Verlauf. Die Hauptlinie ist nun für die Dauer der Klärung der Reparatur unterbrochen und kann erst weitergeführt werden, wenn die Reparatur abgeschlossen wird. Diese Einklammerung der Reparatur wird nun als push bezeichnet, während die Rückkehr zum Hauptstrang pop heisst.
Mit diesem Modell weisen die Autorinnen darauf hin, dass Nebensequenzen in sich weiter verschachtelt sein können, wenn darin weitere Verstehensschwierigkeiten auftreten. Diese Unter-Untersequenzen müssen prioritär behandelt werden, damit die sich ‚auftürmenden‘ Schwierigkeiten abgebaut werden können. Die Metapher stösst dort an ihre Grenzen, wo die Beziehungen zwischen den Ebenen beschrieben werden sollen: Die Reparaturen sind nicht monolithische Blöcke, sondern mit ihren Vorgängerebenen durch Auslöser und Indikator verbunden. Dies zeigt sich z. B. daran, dass ein einziger Auslöser mehrere Reparatursequenzen auslösen kann (ebd.: 80).
4.3.2 Verhältnis zum Konzept ‚Reparatur‘
Die hier vorgestellten interaktiven Behandlungsroutinen von Nichtverstehen stützen sich alle auf das Konzept der ‚Reparatur‘, das von Schegloff, Jefferson & Sacks (1990, orig. 1977) in die Linguistik eingeführt wurde. Diese Behandlungsroutinen bilden allerdings innerhalb des Reparaturmodells nur eine kleine Untergruppe. Dennoch ist der Ansatz von Schegloff, Jefferson & Sacks für das Verständnis von Verstehensschwierigkeiten von zentraler Bedeutung, weshalb er hier kurz vorgestellt wird.
Das Modell, das die AutorInnengruppe in dem klassischen Artikel "The Preference for Self-Correction in the Organization of Repair in Conversation" entwickelt, soll die Mechanismen beschreiben, mittels derer die SprecherInnen mit problematischen Stellen umgehen. Die genaue Beobachtung der Phänomene führt sie dazu, den ursprünglichen Terminus ‚Korrektur‘ durch den allgemeineren der ‚Reparatur‘ zu ersetzen und die Korrekturen darin als Unterkategorie einzuordnen. Die SprecherInnen selbst entscheiden, ob eine Äusserung oder ein Element einer Äusserung in einem Gespräch als Fehler, d.h. als ‚reparaturwürdig‘ (repairable oder trouble source, ebd.: 33) einschätzen. Weder ist aber jede Äusserung, die als ‚Störungsquelle‘ repariert wird, aus Sicht der Analysierenden ein Fehler, noch wird jeder Fehler in einem Gespräch automatisch repariert (ebd.: 33).
Schegloff, Jefferson & Sacks heben bei der Analyse zwei Faktoren besonders hervor: a) Die Unterscheidung zwischen selbstinitiierter und fremdinitiierter Reparatur und b) bei der Ausführung die Unterscheidung zwischen Selbstreparatur und Fremdreparatur. Selbstinitiiert bedeutet, dass der Anstoss von Sprecher A kommt, während bei der Fremdinitiierung die Aufforderung dazu von Sprecher B ausgeht.
Typische Fremdinitiierungen sind z.B. Nachfragen. Durch die Kombination beider Faktoren erhält man eine 2 x 2 – Tabelle (modifiziert aus Frischherz 1997: 121):
|
Selbstreparatur |
Fremdreparatur |
|
|
Selbstinitiierung |
Selbstinitiierte Selbstreparatur |
Bitte um Ausdruckshilfe – Fremdreparatur |
|
Fremdinitiierung |
Nachfragen – Selbstreparatur |
Fremdinitiierte Fremdreparatur |
Tabelle 4: Reparaturen
Die AutorInnen versuchen nun aufzuzeigen, dass diese drei Möglichkeiten (die schattierte kommt in ihrem Artikel nicht vor) in einer geordneten Beziehung zueinander stehen und somit einander nicht in die Quere kommen können. Jeder dieser Reparaturtypen hat seinen festen Platz in einer Abfolge und wirkt von dort aus als Möglichkeit, die zwar nicht umgesetzt werden muss, aber von den Sprechenden stets in Betracht gezogen wird.
Die Abfolge sieht folgendermassen aus (modifiziert nach Levinson 1990: 339):
|
1. Gelegenheit: Eigener Redebeitrag. Platz für selbstinitiierte Selbstreparatur. 2. Gelegenheit: Übergang zwischen eigenem und nächstem Redebeitrag. Platz für selbstinitiierte Selbstreparatur. 3. Gelegenheit: Nächster Redebeitrag. Platz für fremdinitiierte Selbstreparatur. 4. Gelegenheit: Nächster Redebeitrag. Platz für fremdinitiierte Fremdreparatur. |
Die Stärke dieses Ansatzes ist es wahrscheinlich, durch dieses einfache Modell die plausible Hypothese aufstellen zu können, dass vor der Fremdkorrektur dreimal die Gelegenheit zur Selbstkorrektur gegeben ist, selbst wenn die Initiative dazu vom Gesprächspartner ausgeht. Dies erklärt nochmals den Titel des Aufsatzes, der auf die "Präferenz zur Selbstkorrektur" hinweist.
Es wird vom AutorInnenteam ausdrücklich erwähnt, dass dieses Präferenzsystem nicht unversell gültig ist, sondern die Beziehungen ausdrückt, die zwischen Gleichgestellten (weissen NordamerikanerInnen, J.M.) gelten, die darum bemüht sind, das Gesicht des Gegenübers zu wahren. Die Bereitschaft zur Fremdkorrektur kann sich signifikant erhöhen, wenn an dem Gespräch jemand teilnimmt, der "not yet competent in some domain" ist (Schegloff, Jefferson & Sacks 1990: 54).
Der prototypische Fall der Problembehandlung bei Verstehensschwierigkeiten zwischen Menschen, die nicht dieselbe Muttersprache haben, ist indes nur einer der vier oben genannten theoretischen Fälle (s. Tabelle 4). Da die Störungsquelle (‚das Problem‘) bei Verstehensschwierigkeiten nur im Nachhinein erkennbar ist, kann es keine Selbstreparatur im selben Redebeitrag geben. Der Sprecher ist auf die – positive oder problematisierende – Rückmeldung der Hörerin angewiesen, um die Verständlichkeit seiner Äusserung beurteilen zu können. Aus der Tabelle 4 bleibt somit vor allem der Fall links unten übrig: die fremdinitiierte Selbstreparatur, die sich in der Sequenz Nachfragen – Selbstreparatur äussert. Durch die faktische Reduktion der vier Möglichkeiten auf eine einzige geht naturgemäss die Explanationskraft der regelgeleiteten Organisation verloren. Die Studien, die sich mit der interaktiven Problembehandlung von Verstehensproblemen beschäftigen, orientieren sich denn auch nur am Schema der Abfolge von Sprecher – Hörerin, ohne auf die modelltheoretische Beziehung von Selbst- zu Fremdreparaturen weiter einzugehen.
4.3.3 Eine typische Konstellation der Problembehandlung
Zur besseren Illustration zitiere ich noch einmal das Beispiel aus 4.3.0 und kommentiere es in den Termini, die in der Literatur dafür vorgeschlagen werden.
Beispiel 5 Asim (Montenegro-Albaner) und Shakhawan
(Kurde) ![]()
|
T |
1 |
As | ((...)) nur bleiben gehen so in tast- deutsch lernen ( ) <<all>was machst nach haus?> |
|
I |
2 |
Sha | (---) was machen; |
|
R |
3 |
As | =in freizeit. |
|
RR |
4 |
Sha | (--) ja das=e:h s:prechen=und LESEN und so. |
Für die Analyse dieser vier Turns schlagen Varonis / Gass (1985) in ihrem Artikel folgendes Modell vor: Den problemauslösenden Turn 1 nennen sie trigger (‚Auslöser‘). Darauf folgt der indicator (‚Anzeiger‘) in Turn 2, die response (‚Antwort‘) und schliesslich die reaction to the response (‚Reaktion auf die Antwort‘). Indicator, response und die reaction to the response fassen sie unter dem Begriff resolution (‚Auflösung‘) zusammen.
Redebeitrag 4 – die Reaktion auf die Antwort – kann auch nur eine kleine Bestätigung der Antwort enthalten (‚aha‘, ‚ok‘, etc.), worauf der ursprüngliche Sprecher weiterfährt. Hier im Beispiel ist hingegen die RR mit dem folgenden Beitrag von Shakhawan in der Beantwortung der Frage nach der Freizeit verschmolzen.
Die Benennung der verschiedenen Teile des Musters ist bei verschiedenen AutorInnen verschieden, aber bei allen Modellen ist der Einfluss des Konzepts der Reparatur in grösserem oder geringerem Masse deutlich, weshalb in der folgenden Aufstellung auch die Terminologie von Schegloff, Jefferson & Sacks (1990; orig. 1977) noch einmal wiederholt wird.
| Schegloff et. al. (1990) | Schwartz (1980) | Varonis / Gass (1985) | Günthner (1993) | Bremer (1997) | Frischherz (1997) |
| trouble source, repairable | trouble source | trigger (T) | Problem- äusserung | Bezugs- äusserung | Störung |
| initiation | initiation | indicator (I) | Aufforderung zur Klarifikation | Problem- manifestation (PM) | Initiierung |
| repair | repair | response (R) | Durchführung der Reparatur / Klarifikation | Reaktion auf die PM | Durchführung |
| reaction to the response (RR) | Ratifizierung der Klarifikation | Aufnehmen der Bearbeitung | Bestätigung | ||
| Fortsetzung der Hauptaktivität |
Tabelle 5. Vergleich der Terminologie zur Behandlung von Verstehensproblemen
Obwohl die Terminologie sich – wie aus der Tabelle deutlich ersichtlich wird – stark ähnelt, möchte ich mich im Folgenden an die Vorschläge von Varonis / Gass anlehnen, da ihr Modell der Behandlung von Verstehensproblemen mir am meisten ausgearbeitet scheint.
Der trigger oder die trouble source ist grundsätzlich anderer Natur als die übrigen Teile des Musters. Jeder der Redebeiträge – indicator, response oder die reaction to the response – ist selbst wieder eine potentielle Störquelle. Durch diese rekursive Struktur entstehen die eingebetteten Problembehandlungen, die vor allem Varonis / Gass (1985) behandeln. Diese Rückbezüglichkeit wird an folgendem abgewandelten Modell von Varonis / Gass deutlich:
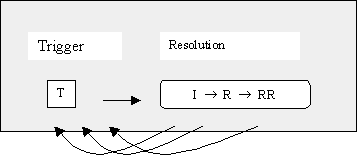 |
Abbildung 2 Modell für Nichtverstehen modifiziert nach Varonis / Gass (1985:74)
Es ist allerdings auffallend, dass ineinander verschachtelte Seitensequenzen im vorliegenden Korpus unter den Asylsuchenden nicht auftauchen. Der Grund dafür ist schwer ermittelbar, liegt aber schwerlich an der Sprachbeherrschung der Teilnehmenden, da sich hier keine Unterschiede zwischen besseren und schwächeren DeutschsprecherInnen ergeben. Möglicherweise spielt aber der persönliche Hintergrund der Teilnehmenden eine Rolle, da z.B. Varonis und Gass (1985) SprachstudentInnen aufnahmen, die alle in den USA einen Sprachaufenthalt machten und am Erlernen der Kommunikationssprache sehr interessiert waren. Es ist denkbar, dass einzelne längere Reparatursequenzen, die sich um Wortbedeutungen drehen, auf diesen Hintergrund zurückzuführen sind.
4.3.4 Ausgestaltung der Redebeiträge
Das Modell soll allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei der resolution, d.h. bei der aktuellen Aushandlung des Problems, die GesprächspartnerInnen beträchtliche Wahlmöglichkeiten haben. So stehen den HörerInnen, die einen Trigger nicht verstanden haben, mehrere Wege offen, das Verstehensproblem anzuzeigen. Die verschiedenen Ausgestaltungen dieser Aufgabe werden im Kapitel 6 ausführlich behandelt. Ähnliches gilt für die Klarifizierungsstrategien der SprecherInnen bei der response, die sich keineswegs nur auf eine kurze Paraphrase des vermeintlich schweren Wortes beschränken muss. Für die Darstellung von Sprecherstrategien ist das Kapitel 7 reserviert.