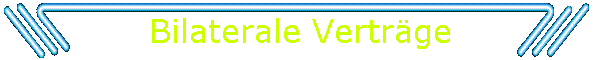
|
|
|
Die bilateralen Verträge sind momentan das zentrale Thema. Am kommenden 21. Mai stimmt
das Schweizer Volk über diese zukunftsweisenden wirtschaftlichen Weg ab. Nachfolgend finden Sie die Bilateralen Verträge, wie sie Ende 1999 ausgehandelt wurden. Diese Schriften sind im Acrobate Reader 4.0-Format geschrieben.
Meine persönliche Meinung Am 6. Dezember 1992 brach für die linksgerichteten Schweizer die Welt in sich zusammen. Im folgenden beschritt unsere Regierung den von der SVP vorgeschlagenen bilateralen "Weg", über den wir am kommenden 21. Mai abstimmen werden. Bei diesen Abkommen stehen sich die Schweiz und die Europäische Union als gleichberechtigte Partner gegenüber. Jede der beiden Parteien hat Rechte und Pflichten. Die Schweiz ist zwar ein kleines Land, doch unsere Lage im Herzen Europas bewirkt, dass wir von unseren Nachbarn nicht ignoriert werden können. Unser Staatswesen entspricht mehrheitlich der europäischen Rechtsordnung; wir sind ein Rechtsstaat und der Wirtschaftsstandort Schweiz kann sich behaupten. Unsere Infrastruktur ist in gutem Zustand, unser Bildungswesen und die Arbeitsmoral der Bevölkerung sind weltweit vorbildlich. Trotzdem ist es für ein kleines Land schwierig, unter solchen vorteilhaften Voraussetzungen Lösungen herauszuarbeiten, da der 50 Mal grössere Partner einen grossen Einfluss auf die hiesigen Entscheide hat. Ein Alleingang der Schweiz ist für unsere international ausgerichtete Wirtschaft kaum empfehlenswert, vor allem unter Anbetracht, dass 70 Prozent unserer Exporte in die EU-Länder gehen (hauptsächlich Deutschland). Somit muss die Schweiz fast zwangsläufig eine engere Anbindung aushandeln. Zugegeben, Verhandlungen sind mühsam und langwierig, doch die resultierenden Lösungen sind (meistens) tragfähig. Ein EU-Beitritt bringt schwerwiegende Nachteile Ich jedenfalls diese bilaterale Art der Annäherung mit der EU einem Beitritt vor. Ein zentralistisches Gebilde ist in der föderalistischen Schweiz unvorstellbar, denken wir nur einmal an den "Kantönligeist" im Schulwesen. Wir Bürger hätten keinen Einfluss auf EU-Recht, das die Schweiz einfach übernehmen müsste. Einen Mehrwertsteuersatz von mindestens 15 Prozent, die Übernahme der bürgerfremden EU-Bürokratie und der Verzicht auf die erfolgreiche eigenständige Aussen- und Sicherheitspolitik wären die nachgewiesenen Bedingungen einer solchen Integration in die Europäische Union. Damit verbunden sind Lohneinbussen, steigende Zinsen für Hypotheken und Investitionen und jährliche Zahlungen von zirka sechs Milliarden Schweizer Franken an den Europäischen Rechnungshof. Handelshemmnisse sind abzubauen Der Abbau von bürokratischen Hürden für ausländische und Schweizer Produkte sorgen für eine effizientere und bessere Allokation der finanziellen Mittel. Der Abbau der Handelshemmnisse sorgt für den Wegfall von Doppelprüfungen und die gegenseitige Anerkennung von Zertifikaten. Der Wegfall der Handelsschranken wirkte sich innerhalb der EFTA aus Schweizer Sicht allemal positiv aus. Forschungsstandort Schweiz stärken Dieses Dossier ermöglicht den Hochschulen an den Forschungsprojekten der
EU teilzunehmen und von dessen zu profitieren. Dieses Angebot kommt insbesondere der
Nord-Westschweiz zugute. Luftverkehr liberalisieren Im Luftverkehrsabkommen werden unsere Fluggesellschaften denen der EU
praktisch gleichgestellt. Besondere Genehmigungen für Landerechte und Preise gehören der
Vergangenheit an. Das Abkommen gibt der Schweiz das Recht, Passagiere nach einem EU-Land
zu befördern, Fluggäste zurückzufliegen oder in ein anderes EU-Land zu bringen. Einzig
Inlandflüge in einem EU-Land sind schweizerischen Fluggesellschaften noch verwehrt, über
dieses Recht soll jedoch noch später verhandelt werden. Öffentliches Ausschreiben In diesem Dossier wird festgehalten, dass grössere Aufträge der öffentlichen Hand ausgeschrieben werden müssen. Kein Anbieter darf bei der Auftragsvergabe diskriminiert werden. Schweizer Firmen, die im Ausland offerieren, werden durch dieses Abkommen begünstigt. Auf der anderen Seite können jedoch auch ausländische Geschäfte in der Schweiz arbeiten, was eine Konkurrenzierung der einheimischen Wirtschaft führt. Seit Herbst letzten Jahres besteht ein Gesetz, das die Mindestanforderungen an Lohn, Arbeitsbedingungen und Gesundheitsschutz von Arbeitgebern genau regelt. Das heikelste Dossier: Der Personenverkehr Schweizer werden den EU-Bürgern gleichgestellt und besitzen das Recht, sich überall im Wirtschaftsraum niederzulassen. Die Sozialversicherungen koordinieren ihre Arbeit mit den Partnerländern. Natürlich gilt die Niederlassungsfreiheit wie auch die Arbeitsbewilligung ebenfalls für EU-Arbeiter. Die Auswirkungen sind momentan noch nicht vollständig absehbar, die Prognosen kalkulieren Mehrausgaben von 600 Millionen Schweizer Franken für die Sozialversicherungen. Landverkehr Ausländische Lastwagen bekommen Kontingente für die Durchfahrt auf Schweizer Strassen. Nach Inkrafttreten der Abkommen dürfen neu 40 Tonnen Güter pro Camion transportiert werden. Das Sonntags- und Nachtfahrverbot bleiben glücklicherweise bestehen. Dieses Dossier sorgt für erheblich grössere Konkurrenz im Transportgewerbe. Der Bund wird sich an den Kosten der neuen Infrastruktur beteiligen und restriktivere Kontrollen durchführen. Die Landwirtschaft wird zum Bauernopfer Den Schweizer Bauern weht schon seit längerer Zeit ein rauher Wind ins Gesicht. Die Produktepreise für Produkte des ersten Sektors werden auf dasjenige des übrigen Europas sinken. Den Konsumenten freut's - den Bauern nicht. Der Schutz der einheimischen Lebensmittel fällt weitgehend dahin. Im Gegenzug wird der EU-Markt für Schweizer Bauern geöffnet. Ich fasse zusammen: Keine Berufsgruppe wird mit den bilateralen Abkommen restlos glücklich,
doch bilden diese sieben Dossiers einen mehrheitlich tragfähigen Kompromiss. Alles in
allem dienen sie dem Wohl der Schweizer Bevölkerung, welches durch verstärktes
Wirtschaftswachstum zwangsläufig profitieren wird. Die bilateralen Verträge ermöglichen
der Schweiz eine Annäherung an die EU, ohne jedoch politisch abhängig zu werden. Die
Schweiz bleibt in jedem Fall nach wie vor politisch selbständig und hat mit diesen
Verträgen das Bestmögliche aus Schweizer Sicht herausgearbeitet. Doch dies ist nur der
Anfang, die Schweiz muss ihren Weg weitergehen und die angestrebten "Bilateralen
II" durchsetzten. Denn Stehenbleiben bedeutet Rückschritt! © by Christoph Banik
|